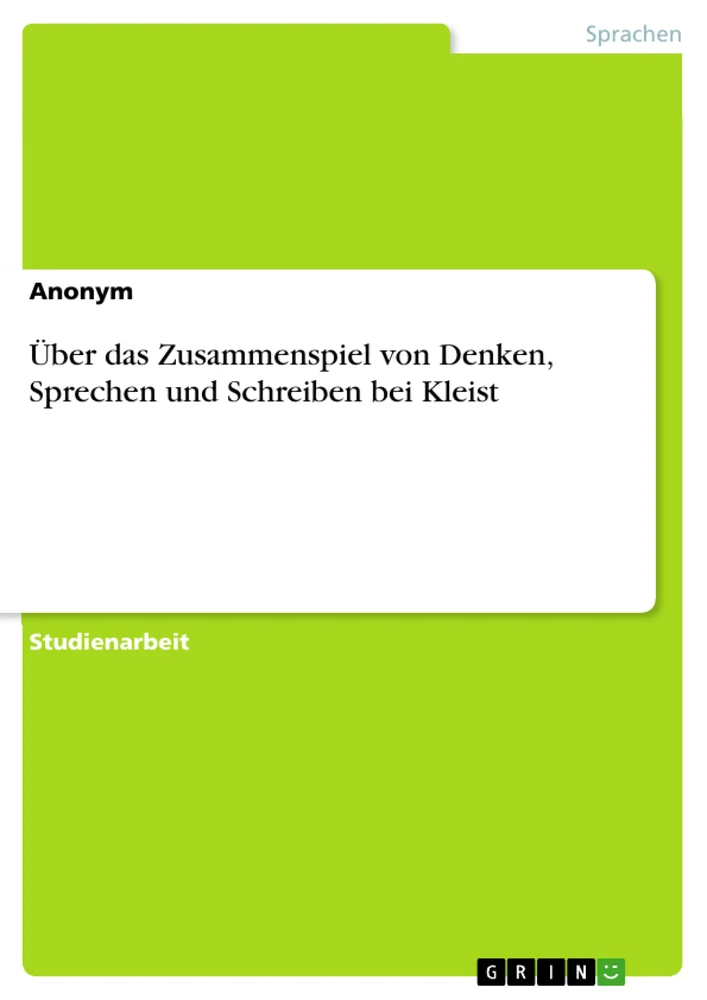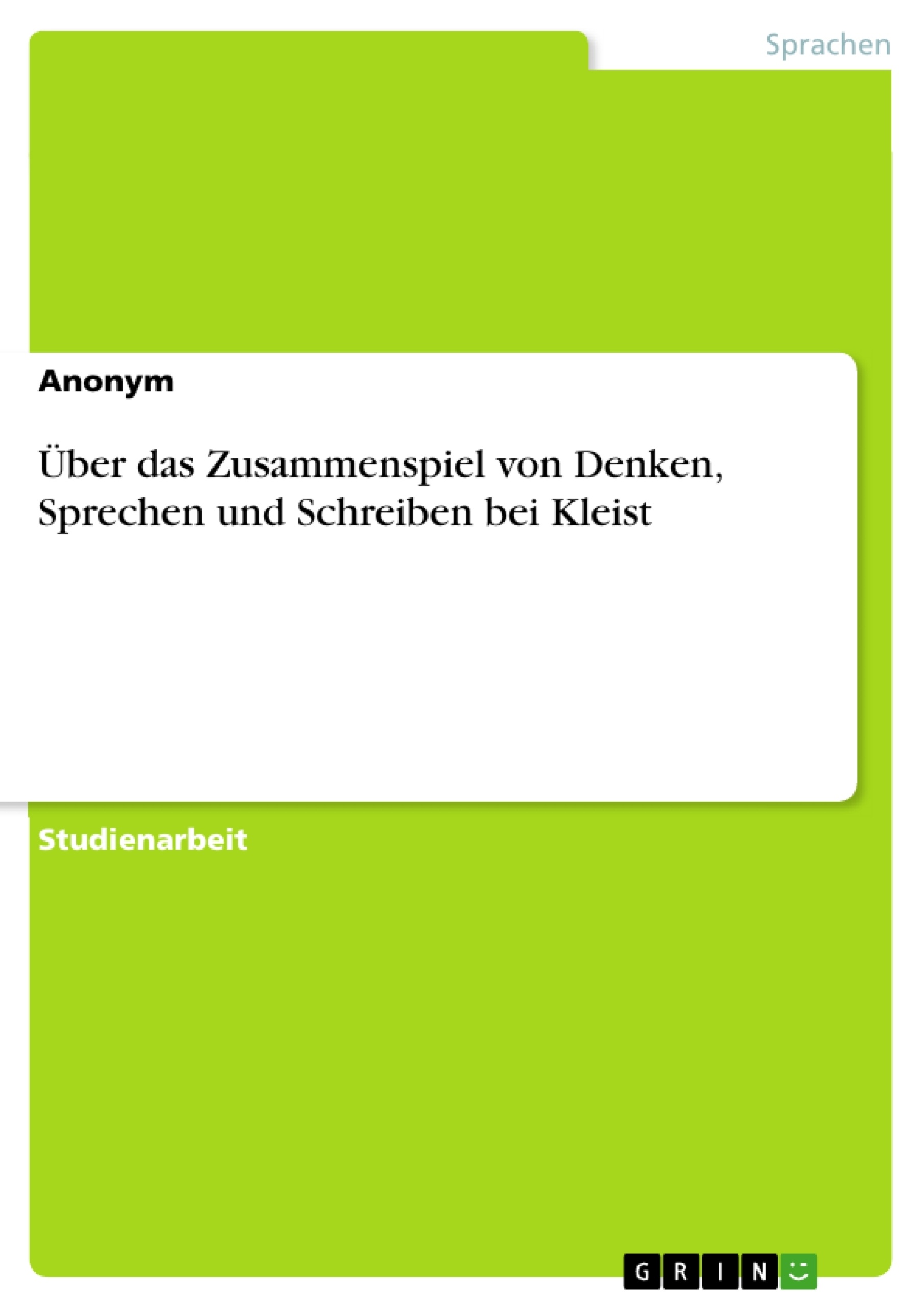Heinrich von Kleists Aufsatz "Über die allmählige Verfertigung der Gedanken beim Reden" stellt die konventionelle Klugheitsregel "Erst denken, dann sprechen" gewaltig auf den Kopf. Vermutlich ist mir Kleists Sichtweise so sehr im Gedächtnis geblieben, weil mir die Vorstellung, dass die Gedanken erst beim Sprechvorgang entwickelt werden, bisher fremd war und doch auf den ersten Blick sehr interessant und nachvollziehbar erscheint.
Ich möchte in dieser Ausarbeitung ganz allgemein der Frage nachgehen, wie Denken, Sprechen und auch Schreiben zusammenhängen. Letzteres findet in dem zugrunde liegenden Aufsatz zwar weniger Beachtung, aber ich finde es dennoch erwähnenswert.
Zunächst möchte ich Inhalt und Aufbau des Aufsatzes untersuchen und herausstellen, welche Erkenntnis Kleist gewinnt. Seine Argumentation soll daraufhin kritisch betrachtet werden und ich werde auf mögliche Paradoxien aufmerksam machen.
Bezüglich Kleists Behauptungen stelle ich folgende These auf: Kleist widerspricht seiner eigenen These, dass Denken und Sprechen synchron ablaufen müssen, in dem Moment, in dem er sie erläutert. Wo erscheint seine Argumentation nachvollziehbar, wo finden sich Ungereimtheiten?
In diesem Zusammenhang gehe ich auf einen weiteren Aufsatz Kleists: "Von der Überlegung (Eine Paradoxe)" ein, da Kleist hier von einem sehr ähnlichen Thema spricht, nämlich von der Abfolge von Überlegung und Handlung.
Darauf folgend möchte ich nicht nur Denken und Sprechen betrachten, sondern auch das Schreiben und dabei der Frage nachgehen, ob Kleist bei seinem Schreibprozess eher planlos vorging und er die Gedanken erst beim Schreiben entwickelte oder ob die Gesamtkonzeption bereits zu Beginn feststand. Dies ist schwer zu untersuchen, da wir Kleist nicht beim Schreiben beobachten konnten, aber ich werde in seinem Werk "Das Erdbeben in Chili" nach Anhaltspunkten suchen, die ihn zu einem der beiden Schreibtypen zuordnen lassen.
Zuletzt wird versucht, ein Fazit aus den Erkenntnissen zu ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Untersuchung von Inhalt und Aufbau
- Die Schwester
- Molière und seine Magd
- Mirabeau und der Gesandte des Königs
- Die Lafontainesche Fabel von Fuchs und Löwe
- Reden in der Gesellschaft
- Der Student und seine Examinatoren
- Belege und Widersprüchlichkeiten
- Aggressionen als Motor des Schaffensprozesses
- Gedanken beim Reden - Gedanken beim Schreiben
- Vorgang des Schreibprozesses
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Aufsatz „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ von Heinrich von Kleist beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Denken, Sprechen und Schreiben. Kleist stellt dabei die konventionelle Klugheitsregel „Erst denken, dann sprechen“ in Frage und argumentiert, dass die Gedanken erst beim Sprechen vollendet werden.
- Das Verhältnis von Denken, Sprechen und Schreiben
- Die Rolle der Sprache bei der Gedankenbildung
- Die Bedeutung von Erregung und Affekt im Schaffensprozess
- Kleists These der „allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden“
- Die performative Funktion der Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet Kleists These der „allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden“ und stellt die zentrale Frage der Ausarbeitung: Wie hängen Denken, Sprechen und Schreiben zusammen?
Das Kapitel „Untersuchung von Inhalt und Aufbau“ analysiert Kleists Argumentation anhand von sechs Beispielen: Die Schwester, Molière und seine Magd, Mirabeau und der Gesandte des Königs, die Lafontainesche Fabel von Fuchs und Löwe, Reden in der Gesellschaft und der Student und seine Examinatoren. Kleist argumentiert, dass die Anwesenheit eines Gegenübers den Redner in einen angespannten und erregten Gemütszustand versetzt, welcher die Gedanken strukturiert und zur Lösung führt.
Das Kapitel „Belege und Widersprüchlichkeiten“ befasst sich mit der kritischen Analyse von Kleists Argumentation. Es werden mögliche Paradoxien aufgezeigt und die Frage gestellt, inwiefern Kleists eigene Argumentation seine These widerlegt.
Im Kapitel „Aggressionen als Motor des Schaffensprozesses“ wird die Rolle von Affekten und Emotionen im Schaffensprozess untersucht. Kleist zeigt, wie die Erregung in bestimmten Situationen zu einer gesteigerten sprachlichen Produktivität führt.
Das Kapitel „Gedanken beim Reden - Gedanken beim Schreiben“ untersucht die Frage, ob Kleist bei seinem Schreibprozess eher planlos vorging oder ob die Gesamtkonzeption bereits zu Beginn feststand.
Das Kapitel „Vorgang des Schreibprozesses“ beleuchtet die Frage, wie Kleist bei seinem Werk „Das Erdbeben in Chili“ vorgegangen ist. Es werden Anhaltspunkte gesucht, die auf einen der beiden Schreibtypen schließen lassen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe des Aufsatzes sind: Denken, Sprechen, Schreiben, Gedankenbildung, Sprache, Erregung, Affekt, performative Funktion der Sprache, „allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“. Der Aufsatz beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern die Sprache nicht nur Ausdruck, sondern auch Gestalterin der Gedanken ist. Weiterhin werden Aspekte von Kleists Schaffensprozess und seine Nutzung von Beispielen und Metaphern untersucht.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Kleists These der „allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden“?
Kleist stellt die Regel „Erst denken, dann sprechen“ auf den Kopf und argumentiert, dass Gedanken oft erst während des Sprechvorgangs durch die sprachliche Artikulation Form annehmen.
Welche Rolle spielt das Gegenüber bei Kleists Theorie?
Die Anwesenheit eines Zuhörers versetzt den Redner in einen Zustand der Erregung, der die Gedanken strukturiert und zur Lösung eines Problems beitragen kann.
Wie hängen Denken, Sprechen und Schreiben laut der Analyse zusammen?
Die Arbeit untersucht, ob Gedanken auch beim Schreiben erst allmählich entstehen oder ob Kleist seine Werke (wie „Das Erdbeben in Chili“) nach einem festen Plan konzipierte.
Welche Paradoxien finden sich in Kleists Argumentation?
Es wird kritisch hinterfragt, ob Kleist seine eigene These widerlegt, indem er sie schriftlich und wohlüberlegt erläutert, während er für die Spontaneität des Redens plädiert.
Was bedeutet die "performative Funktion" der Sprache bei Kleist?
Sprache ist bei Kleist nicht nur ein bloßes Ausdrucksmittel fertiger Gedanken, sondern ein aktiver Gestalter, der den Denkprozess erst vollendet.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Über das Zusammenspiel von Denken, Sprechen und Schreiben bei Kleist, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/434753