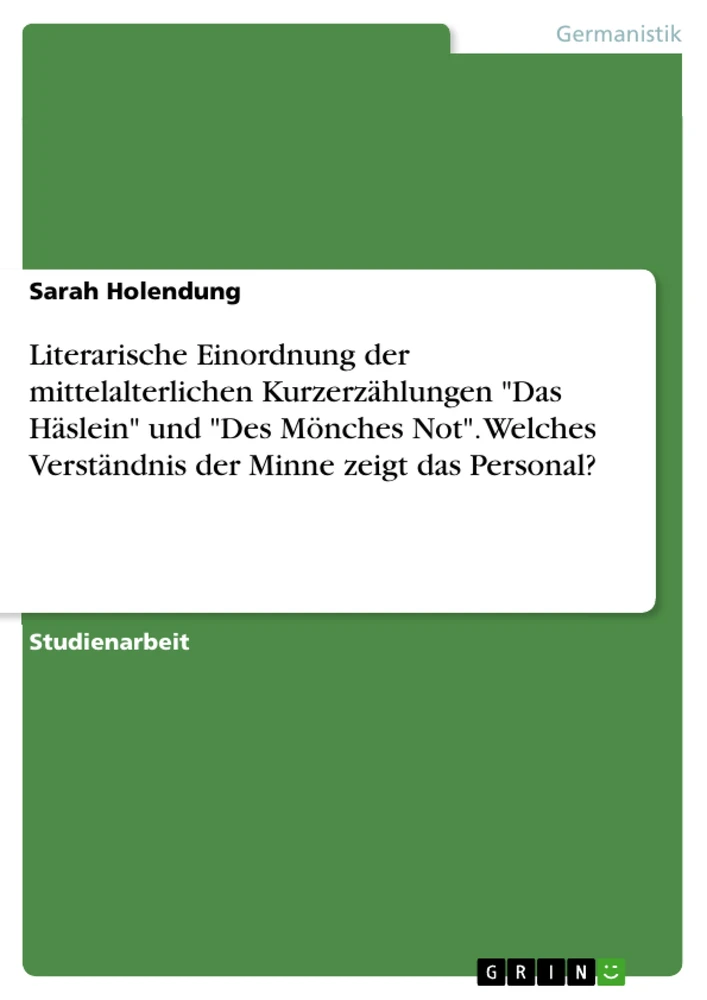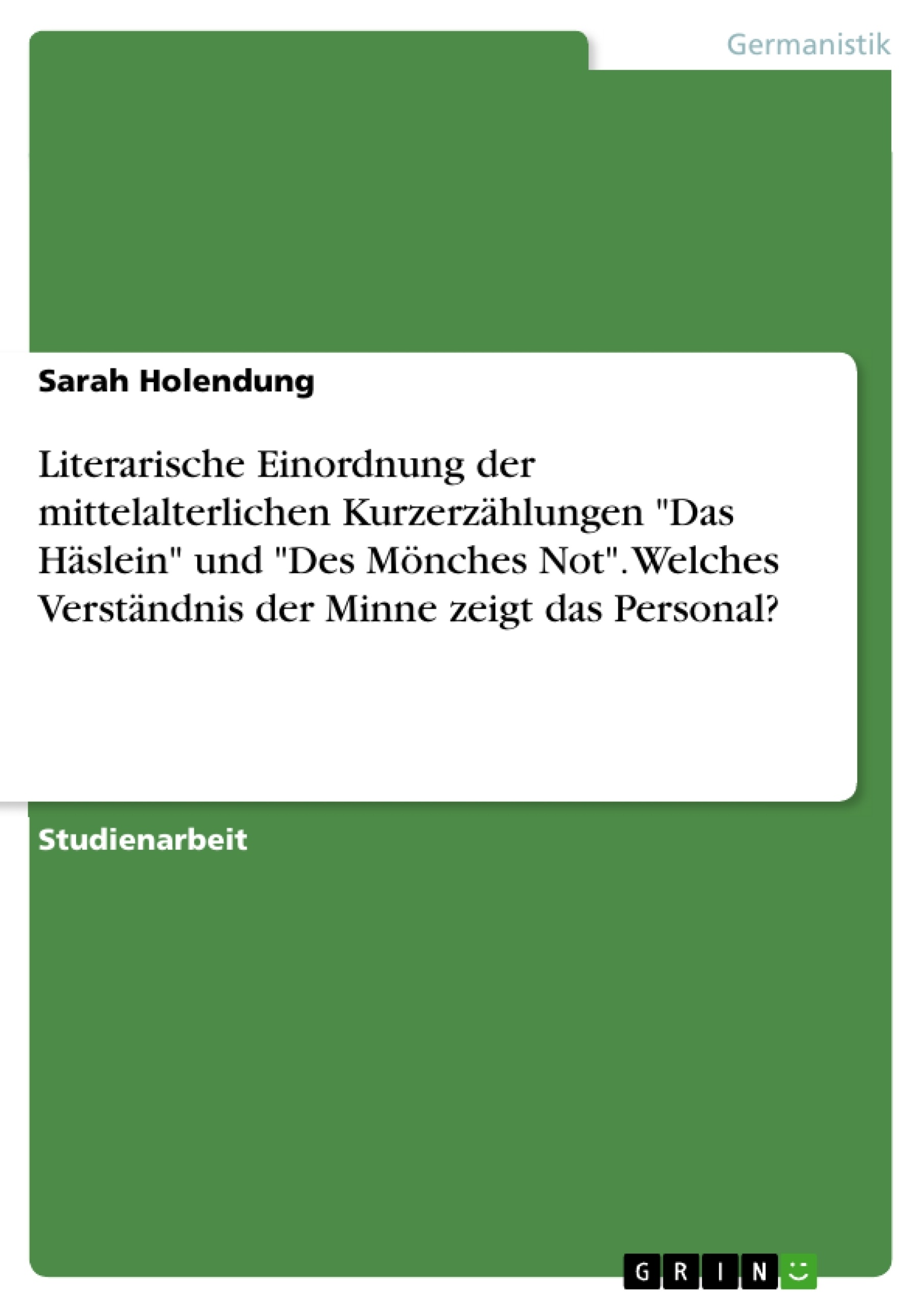Im Mittelalter waren die meisten Menschen Analphabeten, auch viele Adlige. Das bedeutete, dass die Menschen ihren Wissensdurst nur durch mündliche Überlieferungen stillen konnten und abhängig von Boten waren. Dabei konnte durch Mundpropaganda jeder ein Bote sein, Gedichte und Lieder wurden meist von Minnesängern oder Spielleuten übermittelt. Die Gedichte, beziehungsweise die Märendichtung, ist neben der höfischen Epik und der Heldenepik die wichtigste literarische Einheit ab dem Hochmittel-alter (ab ca. 1170). Laut dem bedeutenden Tübinger Mediävisten Hanns Fischer zeichnet sich das Maere formal durch seine paarweise gereimten, viertaktischen Verse (500-2000) aus.
In dieser Arbeit geht es zum einen um die Typisierung der Kurzerzählungen und zum anderen um das Verständnis der Minne innerhalb der Texte. Zuerst sollen neben dem Begriff minne noch weitere grundlegende Begriffe geklärt werden. Anhand der Begriffsdefinitionen und der Analyse der Texte „Das Häslein" und „Des Mönches Not“ soll dann herausgestellt werden, ob es sich dabei um schwankhafte Märe handelt und wie der Minnebegiff innerhalb der Texte eingesetzt und vom Personal verstanden wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begrifflichkeiten
- 3. „Das Häslein“ - Minne-Begriff und Gattung
- 3.1 Minne-Verständnis des Personals
- 3.2 Minne-Symbolik im „Häslein“
- 3.3 Gattung und Ergebnis
- 4. „Des Mönches Not“ - Minne-Begriff und Gattung
- 4.1 Minne-Verständnis des Personals
- 4.2 Minne-Symbolik in „Des Mönches Not“
- 4.3 Gattung und Ergebnis
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Typisierung der Kurzerzählungen „Das Häslein“ und „Des Mönches Not“ und analysiert das Verständnis von Minne innerhalb dieser Texte.
- Begriffliche Klärung des Maeres und des Minne-Begriffs
- Einteilung von Maeren nach Hanns Fischer in drei Typen und zwölf Themenkreise
- Definition des Schwanks und seiner Charakteristika
- Analyse des Minne-Verständnisses im Personal der beiden Texte
- Bewertung, ob die Texte als schwankhafte Märe einzuordnen sind
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung von Wissen für die Menschen im Mittelalter, insbesondere im Kontext der mündlichen Überlieferung. Die Märendichtung wird als wichtige literarische Einheit neben der höfischen und Heldenepik im Hochmittelalter vorgestellt. Das Maere zeichnet sich durch seine spezifische Form und seinen diesseitigen, fiktiven Inhalt aus.
Kapitel 2: Begrifflichkeiten
Dieses Kapitel erläutert detaillierter den Begriff des Maeres und bietet eine Einteilung in drei Typen und zwölf Themenkreise nach Hanns Fischer. Es werden die charakteristischen Merkmale des Schwanks sowie die spezifischen Komik-Elemente beleuchtet.
Kapitel 3: „Das Häslein“ - Minne-Begriff und Gattung
Das Kapitel analysiert das Minne-Verständnis des Personals im „Häslein“ und untersucht die Minne-Symbolik innerhalb des Textes. Abschließend wird die Einordnung des Textes in eine literarische Gattung und die daraus resultierenden Ergebnisse diskutiert.
Kapitel 4: „Des Mönches Not“ - Minne-Begriff und Gattung
Kapitel 4 befasst sich mit dem Minne-Verständnis des Personals in „Des Mönches Not“. Es werden die Minne-Symbole im Text analysiert und eine Einordnung des Werks in eine literarische Gattung vorgenommen. Die gewonnenen Ergebnisse werden zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Maere, Schwank, Minne, Minne-Begriff, höfisch-galantes Maere, moralisch-exemplarisches Maere, schwankhaftes Maere, Themenkreise, komische Darstellung, Minne-Symbolik, literarische Gattung, Personalkonstellation.
Häufig gestellte Fragen
Was charakterisiert die Gattung des "Maere" im Mittelalter?
Ein Maere ist eine paarreimige Kurzerzählung in Versen (ca. 500-2000 Verse) mit fiktionalem, diesseitigem Inhalt. Nach Hanns Fischer wird es in drei Typen unterteilt: höfisch-galant, moralisch-exemplarisch und schwankhaft.
Wie wird "Minne" in den Erzählungen "Das Häslein" und "Des Mönches Not" verstanden?
Die Arbeit analysiert, ob das Personal ein idealisiertes, höfisches Minneverständnis zeigt oder ob die Minne eher als körperliches Begehren oder im Rahmen komischer Verwechslungen (Schwank) dargestellt wird.
Was ist ein "schwankhaftes Maere"?
Es handelt sich um eine Erzählung, bei der die Komik im Vordergrund steht, oft durch List, Betrug oder sexuelle Anspielungen. Die Arbeit prüft, ob die beiden Texte dieser Gattung zuzuordnen sind.
Welche Rolle spielt die Minne-Symbolik im Text "Das Häslein"?
Das Symbol des Hasen wird im Text als metaphorisches Element für die Minne und das Werben eingesetzt. Die Arbeit untersucht die tiefere Bedeutung dieser Bildsprache.
Warum war mündliche Überlieferung für diese Texte so wichtig?
Da im Mittelalter ein Großteil der Bevölkerung, auch des Adels, Analphabeten waren, wurden Maeren meist durch Minnesänger oder Spielleute mündlich verbreitet.
- Arbeit zitieren
- Sarah Holendung (Autor:in), 2017, Literarische Einordnung der mittelalterlichen Kurzerzählungen "Das Häslein" und "Des Mönches Not". Welches Verständnis der Minne zeigt das Personal?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/434759