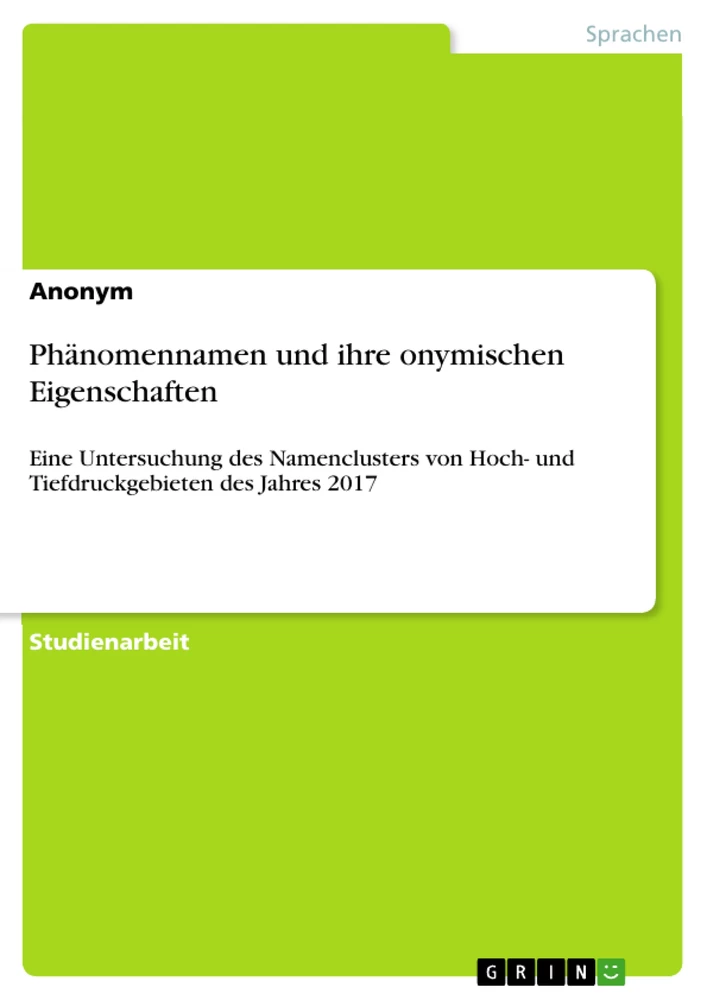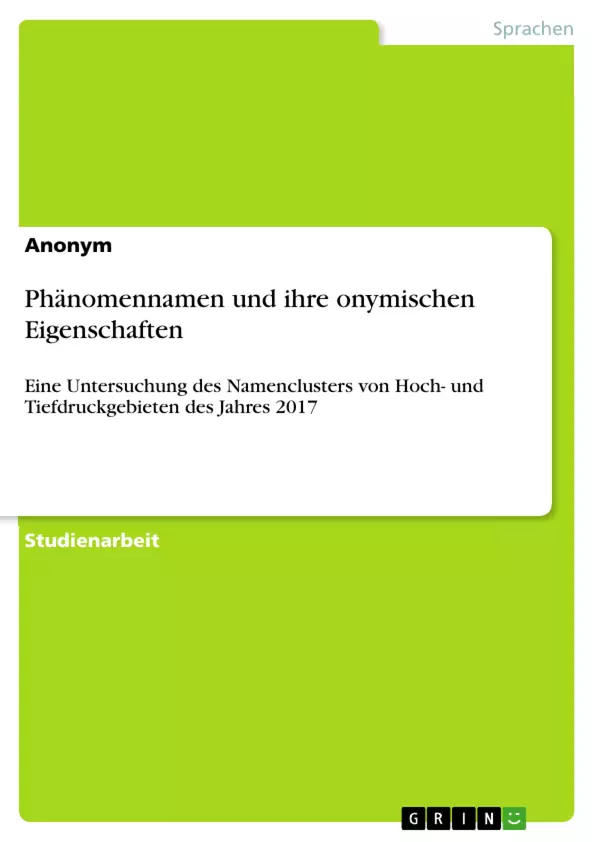Im Spiegel heißt es Anfang Januar diesen Jahres: „Sturmtief Axel – 25 Millionen Euro für Schäden an der Ostseeküste “. Nur wenige Tage später schreibt der Focus: „Hoch „Angelika“ hat Deutschland nach wie vor im eisigen Griff und bringt klirrende Kälte. “ Damit sind das erste Tief- und das erste Hochdruckgebiet des Jahres 2017 eingeleitet. Bei der Benennung der folgenden Wetterereignisse wird eine alphabetische Liste abgearbeitet, die sich aus den Namen der Menschen zusammensetzt, die eine sogenannte Wetterpatenschaft eingegangen sind.
In dieser Ausarbeitung möchte ich untersuchen, aus welchen Namen sich die 54 Hochs und 116 Tiefs 2017 zusammensetzen und welches Gesamtbild sich ergibt. Ich werde die Namen nach den Kriterien Beliebtheit, Herkunft, Bedeutung und Kurz-/Langformen untersuchen und anhand dessen Aussagen darüber treffen, aus welchen Generationen die Namen tendenziell stammen. Für diese Untersuchung werde ich Listen zur Verteilung der Namen erstellen, Auszählungen vornehmen und die Ergebnisse vergleichen.
Hochs und Tiefs gehören der Namenklasse der Phänonyme an, die durch bestimmte onymische Eigenschaften gekennzeichnet ist. Der Zusatz durch die Rufnamen (das Hoch Anna) lässt jedoch gänzlich gegenteilige onymische Eigenschaften erkennen, da Rufnamen der Klasse der Anthroponyme zuzuordnen sind. Man kann behaupten, dass eine Anthropomorphisierung der Hochs und Tiefs stattfindet. Welche Auswirkungen hat dies für die Funktion der Hoch- und Tiefnamen? Erlangen sie möglicherweise eine Bedeutsamkeit oder Wertigkeit? Ich werde die onymischen Eigenschaften im Folgenden genauer erläutern und dem Grund für die Ambiguität nachgehen.
Inhaltsverzeichnis
- Ziel, Gegenstand, Methoden der Arbeit
- Theoretische Grundpositionen und Forschungsstand
- Unterschied Gattungsnamen - Eigennamen
- Onymisierung - Deonymisierung
- Onymische Eigenschaften
- Geschichte der Benennung von Hochs und Tiefs
- Arbeitshypothesen
- Materialanalyse
- Beliebtheit
- Herkunft
- Bedeutung
- Kurz-/ Langformen
- Besonderheiten
- Anthropomorphisierung der Hochs und Tiefs
- Ergebnisse der Arbeit / Auswertung
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Namensgebung von Hoch- und Tiefdruckgebieten im Jahr 2017, um die onymischen Eigenschaften dieses Namenclusters zu untersuchen. Die Untersuchung umfasst die Analyse der Namen nach Kriterien wie Beliebtheit, Herkunft, Bedeutung und Kurz-/Langformen, um Rückschlüsse auf die Generationen zu ziehen, aus denen die Namen stammen.
- Analyse der onymischen Eigenschaften von Hoch- und Tiefnamen im Kontext der Anthropomorphisierung
- Untersuchung der Herkunft und Bedeutung der Namen
- Beurteilung der Auswirkungen der Namen auf die Wahrnehmung von Wetterereignissen
- Vergleich der onymischen Eigenschaften von Anthroponymen und Phänonymen
- Identifizierung von Trends und Mustern in der Namensgebung von Hoch- und Tiefdruckgebieten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema der Untersuchung und die methodischen Ansätze erläutert. Die zweite Sektion beleuchtet die theoretischen Grundlagen und den Forschungsstand, insbesondere den Unterschied zwischen Gattungsnamen und Eigennamen sowie die onymische Eigenschaften verschiedener Namenklassen. Die darauf folgenden Kapitel befassen sich mit der Geschichte der Benennung von Hochs und Tiefs, den Arbeitshypothesen, der Materialanalyse und den Ergebnissen der Untersuchung. Die Arbeit vertieft die Thematik der Anthropomorphisierung und beleuchtet, welche Auswirkungen die Namensgebung von Hoch- und Tiefdruckgebieten auf die Funktion und Bedeutung der Namen hat. Die Arbeit schliesst mit einem Anhang und einem Literaturverzeichnis.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Themenbereich der Onomastik und analysiert die onymischen Eigenschaften von Hoch- und Tiefnamen. Die Untersuchung umfasst die Analyse von Anthroponymen, Phänonymen, Gattungsnamen, Eigennamen, Onymisierung, Deonymisierung und Anthropomorphisierung. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Namen für die Wahrnehmung und Bewertung von Wetterereignissen und die Rolle der Namen in der Kommunikation über das Wetter. Weitere wichtige Konzepte sind Beliebtheit, Herkunft, Bedeutung und Kurz-/Langformen von Namen.
Häufig gestellte Fragen
Wie werden Hoch- und Tiefdruckgebiete benannt?
Die Benennung erfolgt nach einer alphabetischen Liste, die sich aus den Namen von Menschen zusammensetzt, die eine Wetterpatenschaft übernommen haben.
Was ist die „Anthropomorphisierung“ von Wetterereignissen?
Damit ist die Vermenschlichung von unbelebten Phänomenen gemeint, indem ihnen menschliche Vornamen (z.B. „Tief Axel“) gegeben werden.
Was sind Phänonyme in der Onomastik?
Phänonyme sind eine Namenklasse für Naturereignisse. Durch die Verknüpfung mit Rufnamen (Anthroponymen) entstehen interessante onymische Mischformen.
Welche Auswirkungen hat die Namensgebung auf die Wahrnehmung?
Die Namen können den Wetterereignissen eine subjektive Bedeutsamkeit oder Wertigkeit verleihen und die mediale Berichterstattung beeinflussen.
Nach welchen Kriterien werden die Namen analysiert?
Die Namen werden nach Kriterien wie Beliebtheit, Herkunft, Bedeutung sowie Kurz- und Langformen untersucht.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Phänomennamen und ihre onymischen Eigenschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/434760