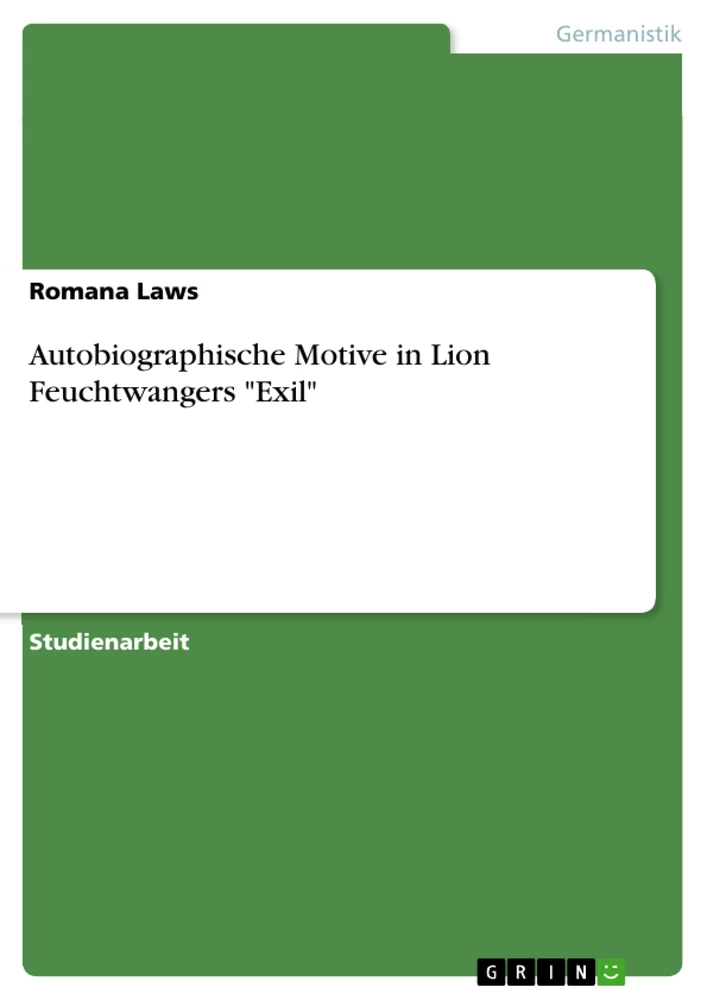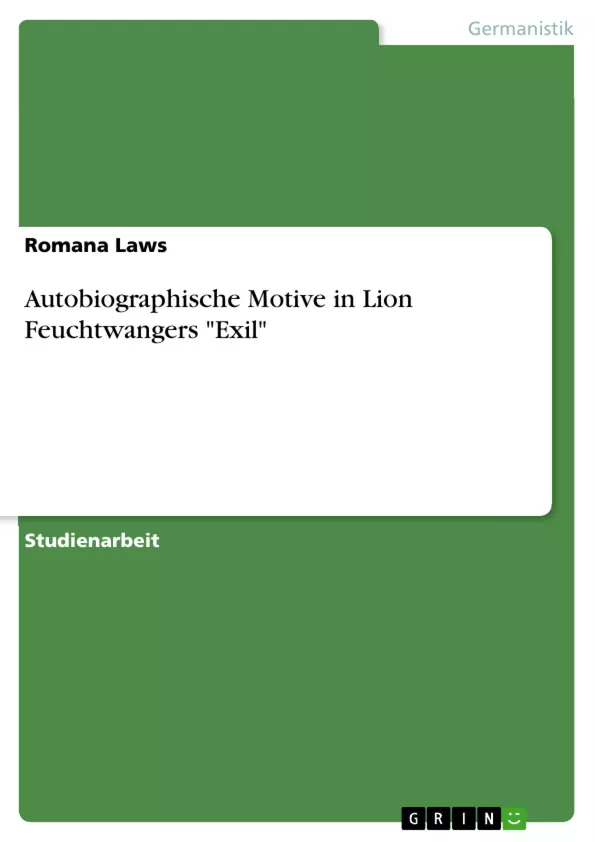In dieser Hausarbeit, soll versucht werden, die autobiographischen Motive des Autors in dem Roman „Exil“ zu analysieren. Es soll sich hier auf seine Zeit in Frankreich und die Reise nach Moskau beschränkt werden. Dies ergibt sich schon alleine aus der Tatsache, dass für die Motive des Autors selbstverständlich nur die Zeit bis zur Fertigstellung dieses Romans eine Rolle spielen kann, da spätere Erfahrungen nicht in das Buch mit eingeflossen sind. Andererseits wird in dieser Arbeit nicht auf seine Exilzeit vor Frankreich eingegangen, da aufgrund des gewählten Ortes und den behandelten Problemen innerhalb des Buches vor allem die Zeit in Frankreich die Motive des Autors beeinflusst zu haben scheint.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Handlung und Hauptcharaktere des Romans „Exil“
- Lion Feuchtwangers Exil von 1933 bis 1939
- Parallelen des Romans zu Feuchtwangers Exilerfahrungen
- Reflexionen privater Problematiken
- Alltägliche Probleme
- Reaktionen der Einheimischen
- Der Versuch, die Haltung zu wahren
- Politische Reflexionen im Exil
- Reflexionen über die Naziherrschaft
- Reflexionen über den Kommunismus
- Reflexionen privater Problematiken
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Analyse der autobiographischen Motive des Autors Lion Feuchtwanger in seinem Roman „Exil“. Der Fokus liegt dabei auf Feuchtwangers Zeit in Frankreich und seiner Reise nach Moskau, wobei die spätere Exilzeit außer Acht gelassen wird, da diese nicht in den Roman mit eingeflossen sind.
- Die Verflechtung von Fiktion und autobiographischen Elementen in „Exil“
- Die Darstellung der Vielschichtigkeit des Exils und der unterschiedlichen Erfahrungen deutscher Emigranten
- Die Auswirkungen des Exils auf die Psyche und die politische Haltung der Figuren
- Die Rolle des Kommunismus und der Naziherrschaft in Feuchtwangers Roman
- Die politische und gesellschaftliche Situation der deutschen Emigranten in Frankreich
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Autor Lion Feuchtwanger und seinen Roman „Exil“ vor, der Teil der „Wartesaal-Trilogie“ ist. Sie beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Romans und die besonderen Herausforderungen des Schreibens im Exil, insbesondere den Kampf gegen die Geschichtsfälschung der Nazis.
- Handlung und Hauptcharaktere des Romans „Exil“: Dieses Kapitel beschreibt die Handlung des Romans, der im Jahr 1935 in Paris spielt. Der Musiker Sepp Trautwein emigriert nach Paris und entwickelt sich im Laufe der Geschichte zu einem politisch engagierten Menschen, der sich für die Befreiung des entführten Journalisten Friedrich Benjamin einsetzt. Neben der Hauptfigur Sepp Trautwein werden auch andere Charaktere wie sein Sohn Hans, der sich für den Kommunismus begeistert, und seine Frau Anna, die am Exil zerbricht, vorgestellt. Der Antagonist des Romans ist Erich Wiesener, ein Opportunist, der seine politische Haltung zugunsten der Nazis aufgibt.
- Lion Feuchtwangers Exil von 1933 bis 1939: Dieses Kapitel befasst sich mit den Lebensumständen von Lion Feuchtwanger im Exil. Es beleuchtet die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die er im Exil erlebte, und sein Engagement gegen den Nationalsozialismus.
- Parallelen des Romans zu Feuchtwangers Exilerfahrungen: Dieses Kapitel untersucht die Parallelen zwischen Feuchtwangers autobiographischen Erfahrungen und den Inhalten seines Romans „Exil“. Es beleuchtet sowohl die privaten Problematiken, wie die Suche nach einer neuen Heimat und die Schwierigkeiten der Integration, als auch die politischen Reflexionen über die Naziherrschaft und den Kommunismus.
Schlüsselwörter
Die Analyse der autobiographischen Motive in Lion Feuchtwangers „Exil“ beschäftigt sich mit Themen wie der deutschen Emigration, der politischen Situation der NS-Zeit, den Erfahrungen und Herausforderungen des Exils in Frankreich, der Darstellung von Alltagsleben und politischen Verhältnissen im Exil sowie der Rolle des Kommunismus und der Naziherrschaft im Roman.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Lion Feuchtwangers Roman "Exil"?
Der Roman spielt 1935 in Paris und schildert das Leben deutscher Emigranten, ihren Kampf gegen die Naziherrschaft und die persönlichen Krisen im Exil.
Welche autobiographischen Motive enthält das Buch?
Feuchtwanger verarbeitet seine eigenen Erfahrungen als Exilant in Frankreich, die Suche nach Identität, die Reaktionen der Einheimischen und seine politische Haltung.
Welche Rolle spielt der Kommunismus im Roman?
Durch Figuren wie Hans Trautwein werden die Hoffnungen und Reflexionen über den Kommunismus als Gegenentwurf zum Nationalsozialismus thematisiert.
Wie wird die Situation der Emigranten in Frankreich dargestellt?
Der Roman zeigt die Vielschichtigkeit des Exils: vom täglichen Überlebenskampf über die Bürokratie bis hin zum Versuch, die menschliche Würde und Haltung zu wahren.
Wer ist der Antagonist Erich Wiesener?
Erich Wiesener ist ein Opportunist, der seine politische Überzeugung aufgibt, um unter den Nazis Karriere zu machen, und stellt den moralischen Gegenpol zu den Emigranten dar.
- Arbeit zitieren
- Romana Laws (Autor:in), 2017, Autobiographische Motive in Lion Feuchtwangers "Exil", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/434844