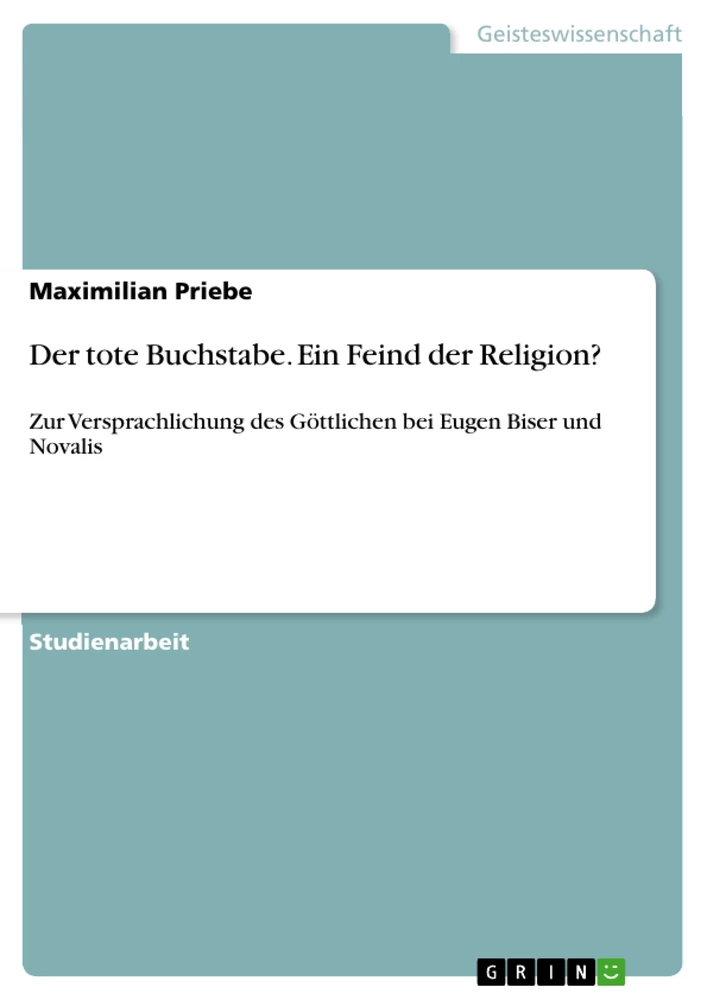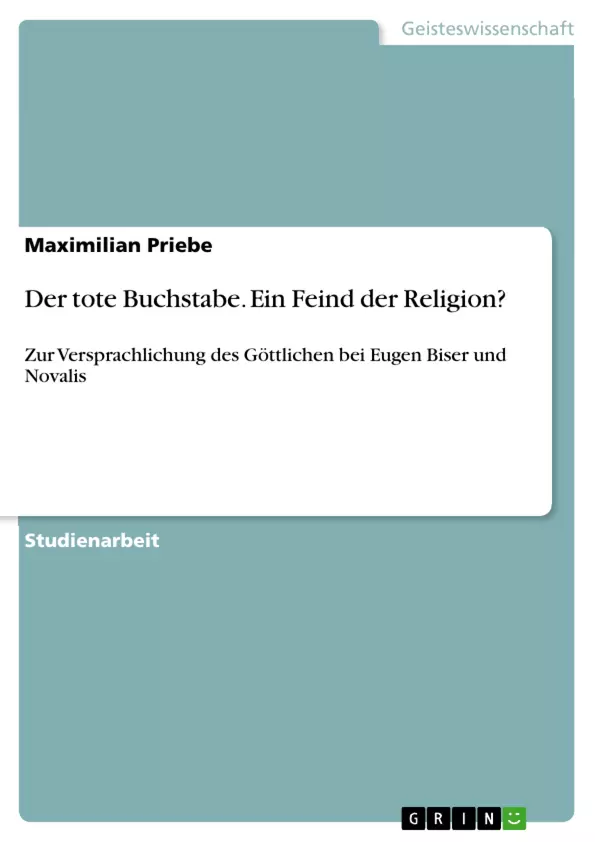Eine heilige Schrift und das eigene Erlebnis göttlicher Größe stellen gegensätzliche Letztbegründungen von Religion dar. Am Werk von Eugen Biser lässt sich dies zeigen. Er stellt die Frage, wie es möglich ist, das Wort Gottes zu erfassen und zu bereden. Die Sphäre des Göttlichen leitet er dabei aus der schriftlichen Überlieferung ab.
An einem Verweis auf die Dichtung Novalis‘ zeigt sich aber, dass das Erfassen des Göttlichen wiederum in subjektiven Grenzerfahrungen verwurzelt ist. Es steht infrage, ob sich Transzendenzbezüge allein aus textgebundener Reflexion erschließen. Dies zieht die Frage nach sich, ob eine weitere Grundlegung religiöser Sprache in persönlichen Schwellenerlebnissen Auswirkungen auf die Vermittlung religiöser Botschaften hat.
Im Folgenden werde ich herausarbeiten, wie sich religiöse Texte und subjektive Transzendenzerfahrungen gegenseitig bedingen. Dies geschieht anhand der religionsphilosophischen Konzepte von Eugen Biser und Novalis. Ich werde mich in erster Linie an Bisers 1970 veröffentlichter Habilitationsschrift Theologische Sprachtheorie und Hermeneutik orientieren, sowie an dem 1971 publizierten Aufsatz Theologische Sprachbarrieren. Eine Problemskizze, der eine Übersicht über die zentralen Themenfelder der Habilitationsschrift gibt. Novalis Hymnen an die Nacht sowie seine Rede Die Christenheit oder Europa entnehme ich beide dem Band Nr. 21 der Insel-Bücherei, herausgegeben von Richard Benz. Zum Abschluss der Thematik wage ich einen Ausblick auf die Frage, wie es möglich ist, unter Rückbezug auf die Lebenswelt des Einzelnen wirksam über das Göttliche zu reden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Eugen Biser und die Grenzen der religiösen Sprache
- 1. Das Problem der Sprachbarrieren
- 2. Das Sprachbild als Veranschaulichung von Gottes Wort
- III. Novalis und die Frühromantik
- 1. Die Grenzerfahrung
- 2. Die Kritik am Buchstaben
- IV. Fazit: Wie kann Göttliches sprachlich dargestellt werden?
- 1. Der lebensweltliche Rückbezug
- 2. Die Kunst als Sphäre des Sakralen
- 3. Die Schau des Universums
- 4. Das Sprachproblem in der sozialen Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Grenzen der religiösen Sprache am Beispiel von Eugen Bisers Werk. Sie untersucht, wie sich die schriftliche Überlieferung des Wortes Gottes mit subjektiven Grenzerfahrungen der Transzendenz verbindet. Die Arbeit hinterfragt, ob religiöse Sprache allein aus textgebundener Reflexion erschlossen werden kann oder ob persönliche Schwellenerlebnisse einen Einfluss auf die Vermittlung religiöser Botschaften haben.
- Grenzen der religiösen Sprache
- Verhältnis von schriftlicher Überlieferung und subjektiver Erfahrung
- Sprachbilder und Veranschaulichung des Göttlichen
- Kritik am Buchstaben und die Rolle der Kunst
- Die Bedeutung des lebensweltlichen Rückbezugs für die religiöse Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und beleuchtet den Gegensatz zwischen heiliger Schrift und persönlicher Erfahrung als Grundlage von Religion. Sie beschreibt Bisers Frage nach der Erfassung und Beredung des Wortes Gottes und zeigt, wie die Dichtung Novalis die Verbindung zwischen Text und subjektiver Grenzerfahrung illustriert.
II. Eugen Biser und die Grenzen der religiösen Sprache
1. Das Problem der Sprachbarrieren
Dieses Kapitel erläutert Bisers Konzept der Sprachbarrieren, die das theologische Reden von Gott erschweren. Biser untersucht die Einschränkungen der Sprache, die sowohl von außen als auch von innen her entstehen und die Vermittlung der göttlichen Botschaft erschweren.
2. Das Sprachbild als Veranschaulichung von Gottes Wort
Hier analysiert Biser die Bedeutung von Sprachbildern, die in der Sprache angelegt sind und die Offenheit für eine Dimension jenseits der bloßen Information ermöglichen. Novalis' "Grenzgebirge der Welt" dient als Beispiel für ein solches Sprachbild, das die transzendente Erfahrung verdeutlicht.
III. Novalis und die Frühromantik
1. Die Grenzerfahrung
Dieses Kapitel beleuchtet Novalis' romantische Sehnsucht, die in seinen Hymnen an die Nacht zum Ausdruck kommt. Seine Werke zeigen die Verbindung zwischen individueller Grenzerfahrung und der Erfahrung des Göttlichen.
2. Die Kritik am Buchstaben
Novalis' Kritik am Buchstaben und seine Verlagerung des Fokus auf die persönliche Erfahrung werden hier beleuchtet.
IV. Fazit: Wie kann Göttliches sprachlich dargestellt werden?
1. Der lebensweltliche Rückbezug
Dieser Abschnitt stellt die Frage nach der Bedeutung der Lebenswelt des Einzelnen für die sprachliche Vermittlung des Göttlichen.
2. Die Kunst als Sphäre des Sakralen
Die Kunst wird als ein Bereich betrachtet, in dem das Sakrale zum Ausdruck gebracht werden kann.
3. Die Schau des Universums
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Bedeutung des Universums als Quelle für die Erfahrung des Göttlichen.
4. Das Sprachproblem in der sozialen Praxis
Die Arbeit analysiert die Herausforderungen der sprachlichen Vermittlung religiöser Botschaften in der sozialen Praxis.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der religiösen Sprache, der Grenzen der Sprache, des Wortes Gottes, der Sprachbarrieren, der Transzendenz, der subjektiven Erfahrung, der Dichtung, der Frühromantik, Novalis, Eugen Biser, der Theologie, der Hermeneutik und dem lebensweltlichen Rückbezug.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „der tote Buchstabe“ in der Religion?
Es beschreibt die rein schriftliche Überlieferung religiöser Texte, die ohne das lebendige, subjektive Erlebnis göttlicher Größe starr und unzureichend bleiben kann.
Wer war Eugen Biser?
Eugen Biser war ein bedeutender Religionsphilosoph und Theologe, der sich intensiv mit Sprachtheorie, Hermeneutik und den Grenzen religiöser Sprache auseinandersetzte.
Wie hängen religiöse Texte und subjektive Erfahrungen zusammen?
Texte und Erfahrungen bedingen sich gegenseitig: Während die Schrift die Sphäre des Göttlichen ableitet, verwurzelt sich das Erfassen dieser Botschaft oft in persönlichen Grenzerfahrungen.
Welche Rolle spielt Novalis in dieser Untersuchung?
Die Dichtung von Novalis (z.B. „Hymnen an die Nacht“) dient als Beispiel dafür, wie Transzendenz durch subjektive Schwellenerlebnisse und Kunst erfahrbar wird.
Was sind „theologische Sprachbarrieren“?
Das sind Hindernisse in der Sprache, die es erschweren, das Unaussprechliche des Göttlichen angemessen in Worte zu fassen und zu vermitteln.
Kann Kunst als Sphäre des Sakralen dienen?
Ja, die Untersuchung zeigt, dass Kunst und Sprachbilder Räume schaffen können, in denen religiöse Botschaften jenseits rein rationaler Information vermittelt werden können.
- Arbeit zitieren
- Maximilian Priebe (Autor:in), 2018, Der tote Buchstabe. Ein Feind der Religion?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/434860