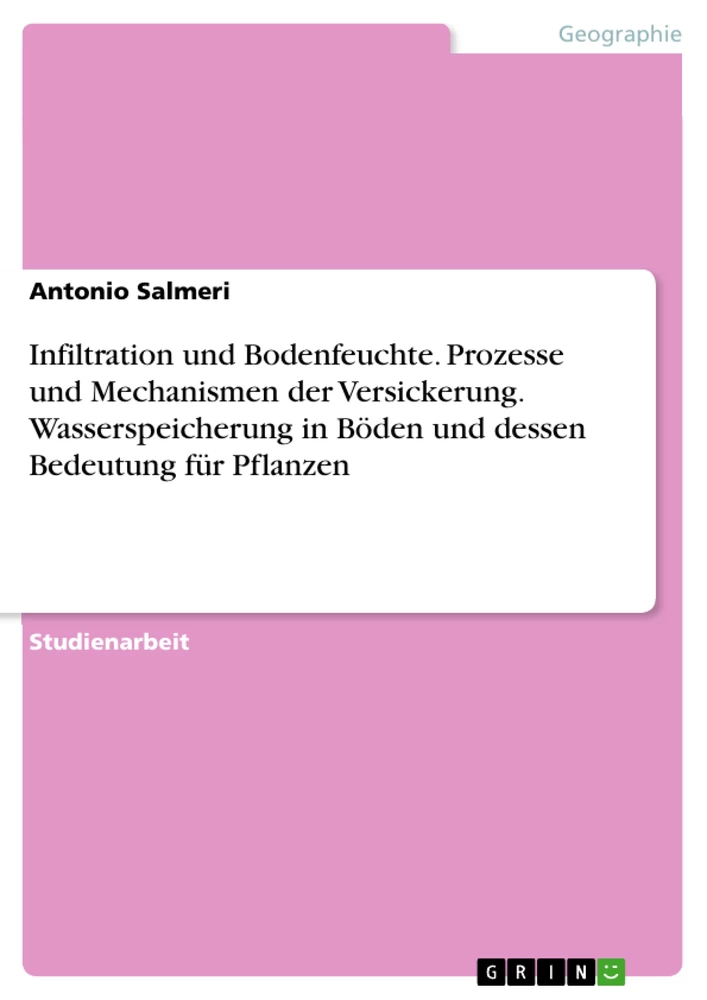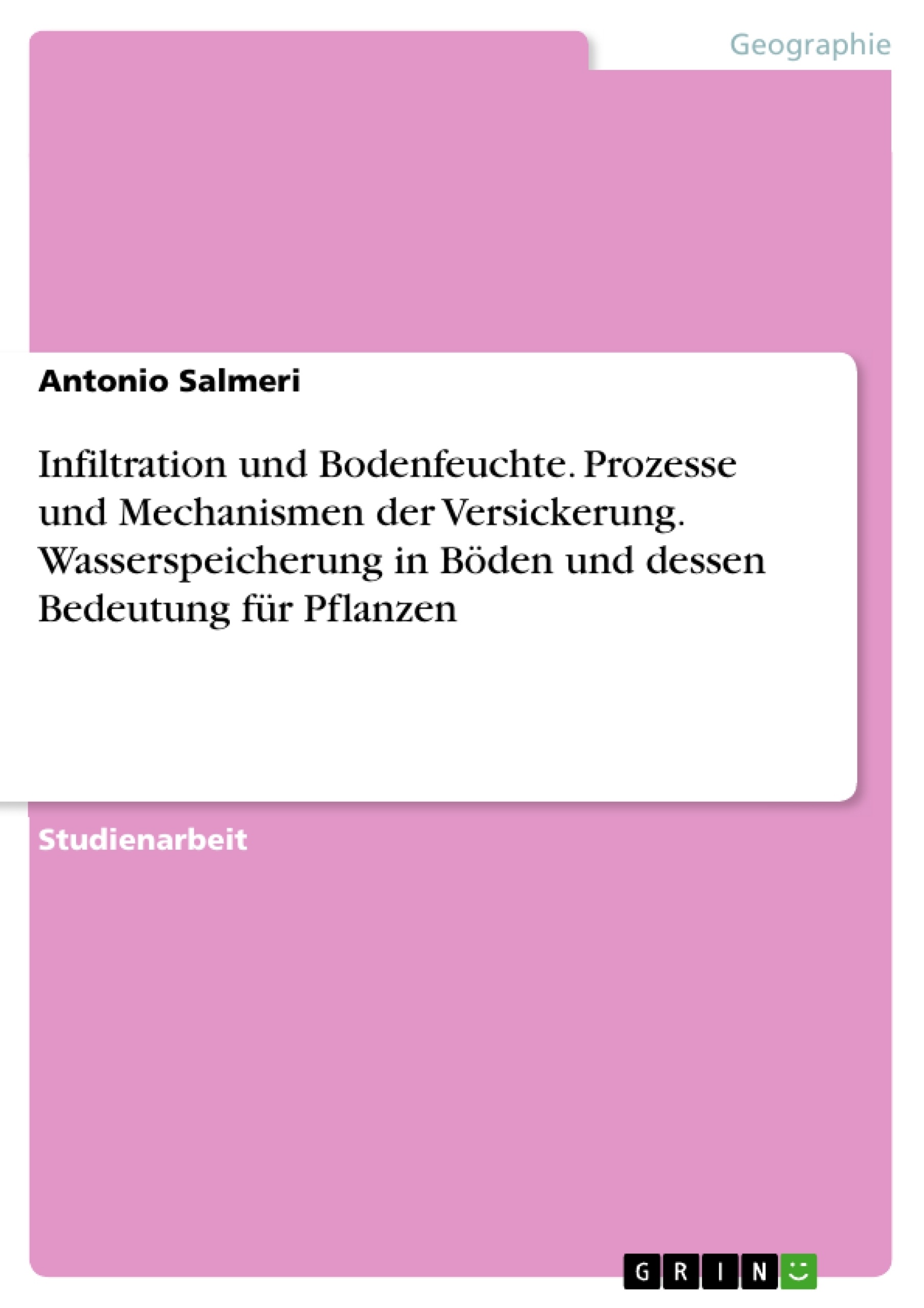Die existentielle Bedeutung des Wassers ist natürlich fest im Kollektivbewusstsein der Menschen verankert und nicht zuletzt aufgrund dieser Erkenntnis wird das lebensspendende Element als eines der wertvollsten Güter der Zukunft gehandelt. Tatsächlich aber spielt diese wertvolle Ressource, abseits ihrer primären Nutzung als Nahrungsmittel, auch in anderen Bereichen des Systems Erde eine tragende Rolle, welche sich schlußendlich als ebenso lebensnotwendig für den Menschen erweist.
„Den Lauf des Wassers von den Bergen zu den Tälern, von dem Lande zum Meere sehen wir unaufhörlich vor unseren Augen sich vollziehen, und dennoch wird das Meer nicht voller und die Quellen und Ströme versiegen nicht.“ (Pfaff 1870) Diesen poetischen Ausführungen liegt die Tatsache zugrunde, dass die globalen Wasserressourcen durch verschiedene Speicherglieder hinweg einen geschlossenen Kreislauf bilden. Wassermengen die über den Ozeanen verdunsten werden zu einem Großteil in Form von Niederschlag an die Weltmeere retourniert. Ein kleiner Teil des verdunsteten Wassers wird durch den Wasserdampftransport der Atmosphäre über den Landmassen wieder abgeregnet.
Im Zuge meiner Seminararbeit möchte ich lediglich diesen kleineren Ausschnitt des globalen Wasserkreislaufs betrachten und mich vor allem mit den Charakteristika des Bodens als fundamentales Speichermedium auseinandersetzen. Beginnend werde ich die Prozesse und Mechanismen der Versickerung behandeln, um im Hauptteil meiner Proseminararbeit verstärkt die Wasserspeicherung in Böden, sowie dessen Bedeutung für Pflanzen zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Weg des Wassers
- 2.1. Interzeption
- 2.2. Evapotranspiration
- 3. Oberflächenwasser und Infiltration
- 3.1. Oberflächenwasser
- 3.2. Infiltration
- 3.3. Exkurs: Struktur von Böden
- 3.3.1. Die Infiltrationsrate
- 3.3.2. Gesättigte und Ungesättigte Bodenzone
- 3.3.3. Einfluss des Menschen auf die Infiltrationskapazität
- 3.4. Stauwasser
- 3.4.1. Beispiel: Pseudogley
- 4. Haftwasser
- 4.1. Feldkapazität
- 4.2. Adsorptionswasser
- 4.3. Kapillarwasser
- 5. Bewegung des Wassers
- 5.1. Bewegung des Kapillarwassers
- 6. Bodenwasser und Pflanzen
- 7. Die Wasserspannungskurve
- 8. Schwarzerde
- 9. Tensiometer
- 10. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Proseminararbeit untersucht den kleineren Ausschnitt des globalen Wasserkreislaufs, der sich auf die Wasserspeicherung im Boden und deren Bedeutung für Pflanzen konzentriert. Die Arbeit beleuchtet die Prozesse der Versickerung und detailliert die Wasserspeicherung im Boden.
- Prozesse der Infiltration und Versickerung
- Wasserspeicherung in Böden
- Bedeutung von Bodenstruktur und -textur für die Wasseraufnahme
- Zusammenhang zwischen Bodenwasser und Pflanzen
- Einfluss des Menschen auf die Infiltrationskapazität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die essentielle Bedeutung von Wasser und seinen Einfluss auf das System Erde. Sie beschreibt den globalen Wasserkreislauf und fokussiert auf den Teil, der sich mit der Wasserspeicherung im Boden befasst. Die Arbeit kündigt die Untersuchung der Versickerungsprozesse und der Bedeutung der Wasserspeicherung im Boden für Pflanzen an.
2. Der Weg des Wassers: Dieses Kapitel beschreibt den Weg des Wassers vom Niederschlag bis zum Boden. Es erklärt die Prozesse der Interzeption (Abfangung von Niederschlag durch Vegetation) mit ihren Unterpunkten Kronendurchlass, sekundäre Interzeption und Hangabfluss. Weiterhin wird die Evapotranspiration (Verdunstung und Transpiration) als wichtiger Prozess im Wasserkreislauf erläutert.
3. Oberflächenwasser und Infiltration: Dieses Kapitel behandelt die Prozesse des Oberflächenabflusses und der Infiltration. Es beschreibt, wie überschüssiges Wasser bei Überschreitung der Bodenaufnahmekapazität als Oberflächenwasser abfließt und die damit verbundenen Folgen wie Erosion und Verschlammung. Der Infiltrationsprozess wird erklärt, einschließlich der Abhängigkeit von der Permeabilität des Bodens. Ein Exkurs erläutert die Bedeutung der Bodenstruktur und -textur für die Wasserdurchlässigkeit und -speicherung. Die verschiedenen Porengrößen und deren Einfluss auf die Wasserdynamik werden detailliert besprochen.
4. Haftwasser: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die verschiedenen Formen des Haftwassers im Boden: Feldkapazität, Adsorptionswasser und Kapillarwasser. Es beschreibt die Eigenschaften und die Bedeutung dieser Wasserformen für die Pflanzenverfügbarkeit.
5. Bewegung des Wassers: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bewegung des Wassers im Boden, insbesondere der Bewegung des Kapillarwassers. Es erläutert die physikalischen Kräfte, die die Bewegung des Wassers beeinflussen.
6. Bodenwasser und Pflanzen: Dieses Kapitel beschreibt den essentiellen Zusammenhang zwischen Bodenwasser und Pflanzenwachstum. Es erläutert die Wasseraufnahme durch Pflanzenwurzeln und die Bedeutung der Bodenfeuchtigkeit für die Pflanzenentwicklung.
7. Die Wasserspannungskurve: Dieses Kapitel beschreibt die Beziehung zwischen Wassergehalt und Wasserspannung im Boden. Die Wasserspannungskurve gibt Aufschluss über die Wasserverfügbarkeit für Pflanzen.
Schlüsselwörter
Infiltration, Bodenfeuchte, Wasserkreislauf, Wasserspeicherung, Bodenstruktur, Permeabilität, Evapotranspiration, Interzeption, Pflanzenverfügbarkeit, Kapillarwasser, Oberflächenwasser.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Proseminar: Wasserspeicherung im Boden
Was ist der Gegenstand dieses Proseminars?
Das Proseminar untersucht einen Ausschnitt des globalen Wasserkreislaufs, der sich auf die Wasserspeicherung im Boden und deren Bedeutung für Pflanzen konzentriert. Im Fokus stehen die Prozesse der Versickerung und die detaillierte Beschreibung der Wasserspeicherung im Boden.
Welche Themen werden im Proseminar behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Prozesse der Infiltration und Versickerung, die Wasserspeicherung in Böden, den Einfluss der Bodenstruktur und -textur auf die Wasseraufnahme, den Zusammenhang zwischen Bodenwasser und Pflanzen und den Einfluss des Menschen auf die Infiltrationskapazität.
Welche Kapitel umfasst das Proseminar und worum geht es in jedem Kapitel?
Das Proseminar gliedert sich in mehrere Kapitel: Die Einleitung betont die Bedeutung von Wasser und den globalen Wasserkreislauf. "Der Weg des Wassers" beschreibt den Weg des Wassers vom Niederschlag zum Boden (Interzeption und Evapotranspiration). "Oberflächenwasser und Infiltration" behandelt Oberflächenabfluss, Infiltration und die Bodenstruktur. "Haftwasser" konzentriert sich auf Feldkapazität, Adsorptionswasser und Kapillarwasser. "Bewegung des Wassers" befasst sich mit der Bewegung des Wassers im Boden, insbesondere des Kapillarwassers. "Bodenwasser und Pflanzen" beschreibt den Zusammenhang zwischen Bodenwasser und Pflanzenwachstum. "Die Wasserspannungskurve" beschreibt die Beziehung zwischen Wassergehalt und Wasserspannung. Zusätzlich gibt es Kapitel zu Schwarzerde und Tensiometer sowie ein Fazit.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Proseminars wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Infiltration, Bodenfeuchte, Wasserkreislauf, Wasserspeicherung, Bodenstruktur, Permeabilität, Evapotranspiration, Interzeption, Pflanzenverfügbarkeit und Kapillarwasser.
Wie ist die Struktur des Dokuments aufgebaut?
Das Dokument beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Welche Prozesse werden im Detail erklärt?
Die Prozesse der Interzeption (mit Unterpunkten Kronendurchlass, sekundäre Interzeption und Hangabfluss), Evapotranspiration, Infiltration, Oberflächenabfluss und die Bewegung des Kapillarwassers werden detailliert erläutert.
Welche Rolle spielt die Bodenstruktur?
Die Bodenstruktur und -textur spielen eine entscheidende Rolle für die Wasserdurchlässigkeit und -speicherung. Die verschiedenen Porengrößen und deren Einfluss auf die Wasserdynamik werden ausführlich besprochen.
Welche Bedeutung hat die Wasserspeicherung im Boden für Pflanzen?
Die Wasserspeicherung im Boden ist essentiell für das Pflanzenwachstum. Das Dokument erläutert die Wasseraufnahme durch Pflanzenwurzeln und die Bedeutung der Bodenfeuchtigkeit für die Pflanzenentwicklung.
Welchen Einfluss hat der Mensch auf die Infiltrationskapazität?
Der Einfluss des Menschen auf die Infiltrationskapazität wird ebenfalls untersucht.
- Citation du texte
- Antonio Salmeri (Auteur), 2012, Infiltration und Bodenfeuchte. Prozesse und Mechanismen der Versickerung. Wasserspeicherung in Böden und dessen Bedeutung für Pflanzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/434960