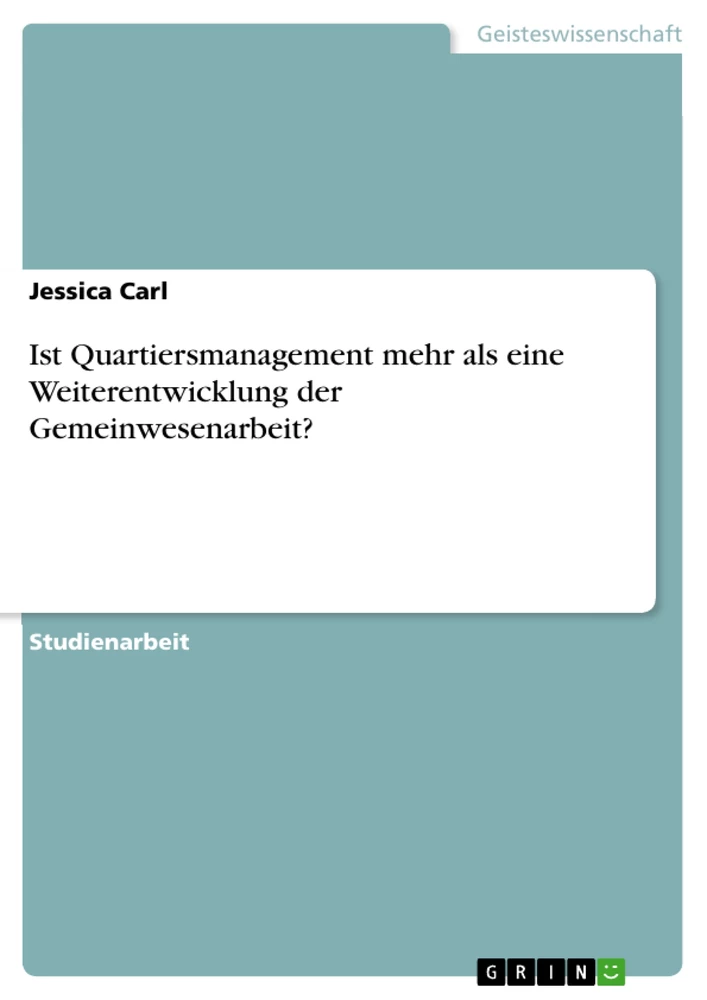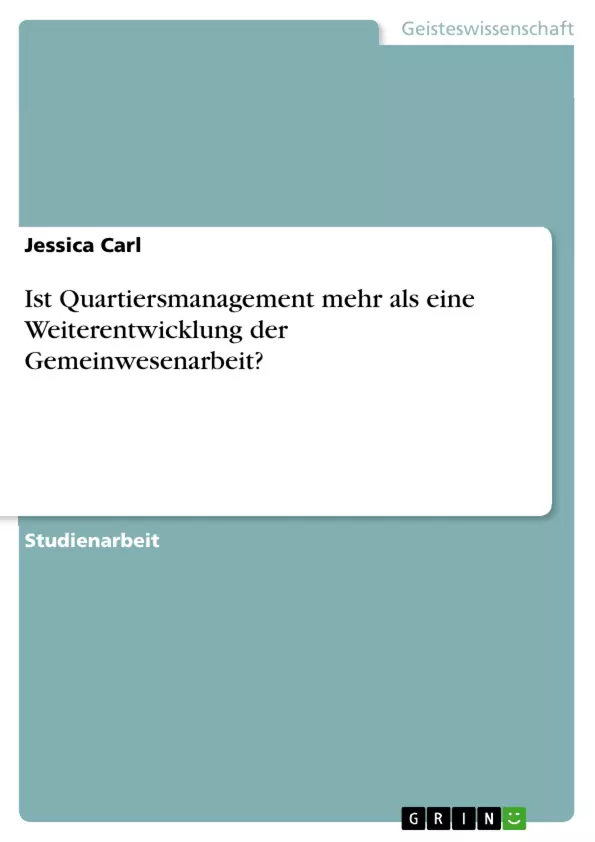Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Quartiersmanagement und der Forschungsfrage, ob Quartiersmanagement mehr als eine Weiterentwicklung der Gemeinwesenarbeit ist. Diese These wird unterstützt durch die Betrachtung der Theorie der Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch in Bezug auf das Seminar Theorien Sozialer Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Konzept des Quartiersmanagements
- 2.1 Die Entstehung des Quartiersmanagements
- 2.2 Aufgaben und Handlungsfelder
- 2.3 Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt"
- 2.4 Qualifikationen von Quartiersmanager*innen
- 2.5 Gemeinwesenarbeit: eine Kernkompetenz im Quartiersmanagement
- 2.6 Voraussetzungen für ein erfolgreiches Quartiersmanagement
- 3 Quartiersmanagement als präventive Sozialpolitik
- 4 Lebensweltorientierte Soziale Arbeit nach Hans Thiersch und Quartiersmanagement
- 4.1 Das Konzept der Lebensweltorientierung
- 4.1.1 Historischer Kontext
- 4.1.2 Traditionslinien
- 4.1.3 Alltag bzw. Lebenswelt
- 4.2 Lebensweltorientierte Soziale Arbeit mit Betrachtung des Quartiersmanagementkonzeptes
- 4.2.1 Ziele
- 4.2.2 Dimensionen
- 4.2.3 Struktur- und Handlungsmaxime
- 4.2.4 Aufgaben
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht das Quartiersmanagement als eine raumbezogene Methode der Sozialen Arbeit und beleuchtet die Frage, ob es sich dabei um eine Weiterentwicklung der Gemeinwesenarbeit handelt. Der Fokus liegt auf der Entstehung und Entwicklung des Quartiersmanagements, seiner Einordnung in die Soziale Arbeit und den Aufgaben eines Quartiersmanagers im Vergleich zur Gemeinwesenarbeit.
- Die Entstehung und Entwicklung des Quartiersmanagements
- Die Einordnung des Quartiersmanagements in die Soziale Arbeit
- Aufgaben und Handlungsfelder des Quartiersmanagements
- Die Rolle der Gemeinwesenarbeit im Quartiersmanagement
- Das Konzept der Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch im Zusammenhang mit dem Quartiersmanagement
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel beleuchtet das Konzept des Quartiersmanagements, insbesondere die Entstehung und die Entwicklung des Konzepts. Es betrachtet auch die Aufgaben und Handlungsfelder des Quartiersmanagements, wobei die "soziale Stadt" als wichtiges Beispiel für die praktische Anwendung des Konzepts dient.
Im dritten Kapitel wird das Quartiersmanagement als eine präventive Sozialpolitik vorgestellt, die auf die Verbesserung der Lebensbedingungen in benachteiligten Stadtgebieten abzielt.
Kapitel vier befasst sich mit dem Konzept der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit nach Hans Thiersch und untersucht die Beziehung zwischen diesem Konzept und dem Quartiersmanagement. Es analysiert die Ziele, Dimensionen, Struktur- und Handlungsmaximen sowie Aufgaben der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit in Verbindung mit dem Quartiersmanagement.
Schlüsselwörter
Quartiersmanagement, Gemeinwesenarbeit, Soziale Arbeit, Lebensweltorientierung, Stadtteile mit besonderen Entwicklungsbedarf, "Soziale Stadt", präventive Sozialpolitik, Hans Thiersch, Sozialraumorientierung, Gentrifizierung, soziale Segregation.
Häufig gestellte Fragen
Ist Quartiersmanagement nur eine Form der Gemeinwesenarbeit?
Die Arbeit untersucht, ob Quartiersmanagement über die klassische Gemeinwesenarbeit hinausgeht, indem es raumbezogene Methoden und präventive Sozialpolitik kombiniert.
Was bedeutet Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch?
Dieses Konzept stellt den Alltag und die konkrete Lebenswelt der Menschen in den Mittelpunkt der Sozialen Arbeit, um Hilfe zur Selbsthilfe im vertrauten Umfeld zu leisten.
Was ist das Programm "Soziale Stadt"?
Es ist ein Beispiel für die praktische Anwendung von Quartiersmanagement in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf, um soziale Segregation zu verhindern.
Welche Aufgaben hat ein Quartiersmanager?
Quartiersmanager koordinieren Handlungsfelder wie Wohnumfeldverbesserung, soziale Integration und wirtschaftliche Belebung in benachteiligten Gebieten.
Wie hängen Sozialraumorientierung und Gentrifizierung zusammen?
Quartiersmanagement versucht oft, die negativen Folgen von Gentrifizierung und sozialer Segregation durch gezielte Interventionen im Sozialraum abzufedern.
- Quote paper
- Jessica Carl (Author), 2018, Ist Quartiersmanagement mehr als eine Weiterentwicklung der Gemeinwesenarbeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/435100