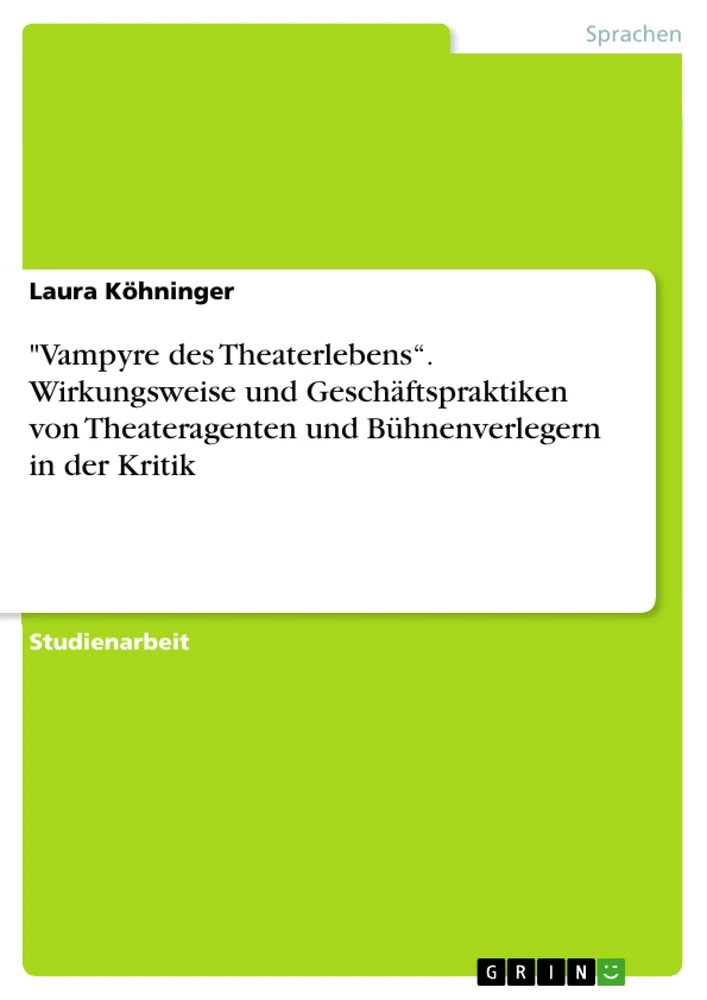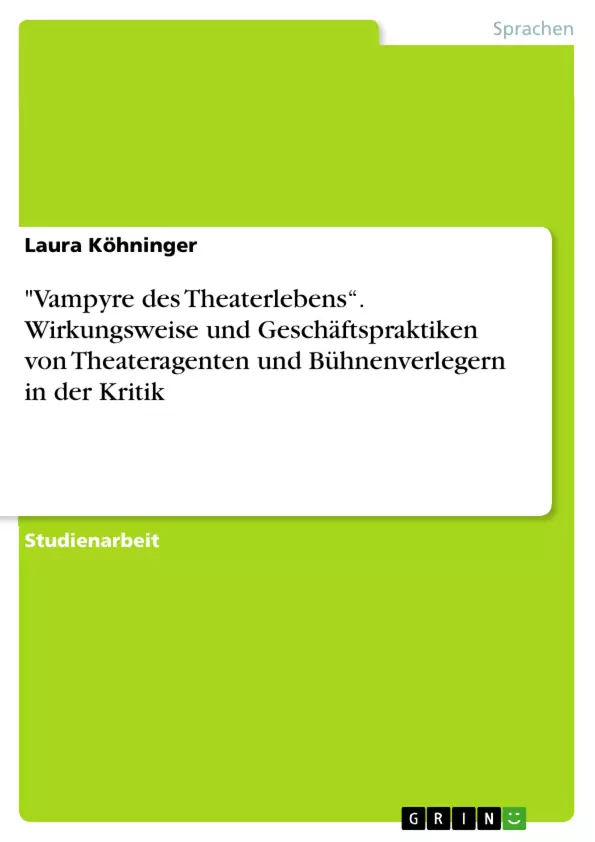Die Beschreibung der Vermittler des zeitgenössischen Theaterleiter und Reformer Eduard Devrient in seiner „Geschichte der deutschen Schauspielkunst“ von 1848 birgt verschiedenste Ansatzpunkte in sich. Die Stellenvermittler und Bühnenverleger, die sich in den Anfängen des 19. Jahrhunderts als Vermittlungsinstanzen zwischen Schauspielern bzw. Autoren dramatischer Werke und den Bühnendirektoren etablierten, nahmen die materielle Verwertung literarischer Erzeugnisse im Auftrag ihrer Klienten wahr. Die „geordneten Rechtszustände“ können in Devrients Aussage einer kritischen Betrachtung nicht standhalten, da die urheberrechtliche und finanzielle Lage der dramatischen Autoren noch bis ins letzte Drittel des 19. Jahrhunderts unbefriedigend war und Anlass zu einem langen Kampf für vollen Rechtsschutz für gedruckte und ungedruckte Manuskripte, ausschließliche Aufführungsrechte sowie eine angemessene Gewinnbeteiligung gab, von dem hier einleitend berichtet wird. Diese rechtliche Auseinandersetzung bildet auch die zeitlich begrenzenden Eckpunkte dieser Arbeit, beginnend mit dem preußischen „Gesetz zum Schutze des Eigenthums an Werken der Wissenschaft und der Kunst“ von 1837 und beschließend mit dem vollen Rechtsschutz des Urheberrechts in der Verfassung des neu gegründeten Deutschen Reich 1871. In dieser Zeit, nach napoleonischen Kriegen und Wiener Kongress, gewann das Theater als Bildungsstätte und Freizeitangebot an großer Bedeutung, die Zunahme der Bühnen und der Zuschauerzahlen führten durch die gestiegene Konkurrenz zu kommerziellen geleiteten und gewinnorientierten Theatern. Dabei ereilte das Theaterstück wie auch der Bühnenkünstler das gleiche Schicksal: beide bekamen den Status einer „Ware“ zugesprochen und unterlagen so den wirtschaftlichen Gesetzen. Die Theateragenten bzw. die sich nach deren Vorbild entwickelten Bühnenverleger und Bühnenvertriebe boten dieses Gut feil, waren prozentual am Honorar beteiligt und beeinflussten das Theaterwesen durch ihre Arbeitsweisen und ihr Geschäftsgebaren, die anschließend an einen geschichtlichen Abriss der Entwicklung der Theateragenturen erläutert werden. Um das Agenturwesen im 19. Jahrhundert zu vervollständigen, folgt auch ein Exkurs über literarische Agenturen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Urheberrechtliche Voraussetzungen für die Entstehung von Vermittlern
- Gesetz zum Schutze des Eigenthums an Werken der Wissenschaft und der Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung von
- Ausweitung des Schutzes des dramatischen Werkes unter Vorbehalt und die Einführung der Tantieme
- Voller Rechtsschutz durch das Reichsgesetz
- Entwicklung und Wirkungsweise von Theateragenten und Bühnenverlegern
- Neues Berufsbild: Der Vermittler im Theaterbetrieb
- Theateragenten
- Bühnenvertriebe/Bühnenverleger
- Aufgabengebiete
- Honorar, Provision und Tantiemen
- Exkurs: Entwicklung der Literaturagenturen
- „Vampyre des Theaterlebens“ - Geschäftsgebaren der Agenten in der Kritik
- Der geldgierige Geschäftsmann
- Einflussnahme auf das Theaterwesen
- Abhängigkeit der Klienten vom Agenten
- Fehlendes Kunstverständnis
- Gegenbeispiele
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Wirkungsweise und Geschäftspraktiken von Theateragenten und Bühnenverlegern im 19. Jahrhundert. Sie beleuchtet die Entstehung dieser Berufsgruppe im Kontext der Entwicklung des Urheberrechts und der zunehmenden Kommerzialisierung des Theaterwesens. Die Arbeit untersucht die Kritik am Geschäftsgebaren der Vermittler und beleuchtet, inwieweit diese als „Vampyre des Theaterlebens“ bezeichnet werden können.
- Entwicklung des Urheberrechts im 19. Jahrhundert
- Entstehung und Entwicklung von Theateragenten und Bühnenverlegern
- Kritik am Geschäftsgebaren der Agenten
- Einfluss der Agenten auf das Theaterwesen
- Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Agenten und Künstlern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Seminararbeit vor und erläutert den historischen Kontext der Entstehung von Theateragenten und Bühnenverlegern. Sie skizziert die rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen, die zur Entwicklung dieser Berufsgruppe führten.
Der erste Kapitelteil widmet sich den urheberrechtlichen Voraussetzungen für die Entstehung von Vermittlern. Er beleuchtet die Entwicklung des Urheberrechts im 19. Jahrhundert, insbesondere in Bezug auf dramatische Werke. Der Fokus liegt auf der Einführung des "Gesetzes zum Schutze des Eigenthums an Werken der Wissenschaft und der Kunst" von 1837 und der Ausweitung des Schutzes für dramatische Werke im Jahr 1854.
Der zweite Kapitelteil behandelt die Entwicklung und Wirkungsweise von Theateragenten und Bühnenverlegern. Er erläutert die neuen Berufsrollen im Theaterbetrieb und die Aufgabenbereiche der Vermittler. Dieser Teil der Arbeit untersucht auch die Entwicklung der Literaturagenturen und stellt den Zusammenhang zur Entwicklung der Theateragenturen her.
Der dritte Kapitelteil befasst sich mit der Kritik am Geschäftsgebaren der Theateragenten. Er analysiert die Vorwürfe, die gegen die Vermittler erhoben wurden, insbesondere im Hinblick auf ihre Machtposition, ihre Gewinnorientierung und ihre Einflussnahme auf das Theaterwesen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Urheberrecht, Theateragenten, Bühnenverleger, Theaterwesen, Kommerzialisierung, Kritik, Einflussnahme, Abhängigkeitsverhältnisse und Geschäftspraktiken. Die Untersuchung fokussiert sich auf die Entwicklung des Urheberrechts für dramatische Werke im 19. Jahrhundert und die Rolle der Vermittler in der sich verändernden Theaterlandschaft.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurden Theateragenten im 19. Jahrhundert als "Vampyre" bezeichnet?
Kritiker wie Eduard Devrient warfen ihnen vor, Künstler finanziell auszubeuten und ohne echtes Kunstverständnis nur aus Profitgier zu handeln.
Wie entwickelte sich das Urheberrecht für Theaterstücke?
Ein wichtiger Meilenstein war das preußische Gesetz von 1837. Erst 1871 gab es im Deutschen Reich einen vollen Rechtsschutz für dramatische Werke.
Welche Aufgaben hatten Bühnenverleger?
Sie vermittelten Manuskripte an Bühnendirektoren, verwalteten Aufführungsrechte und sorgten für die Einziehung von Honoraren und Tantiemen.
Was ist der Unterschied zwischen Agenten und Bühnenvertrieben?
Theateragenten vermittelten primär Schauspieler, während Bühnenvertriebe und -verleger auf die materielle Verwertung literarischer Werke spezialisiert waren.
Wie veränderte die Kommerzialisierung das Theaterwesen?
Theaterstücke und Künstler bekamen den Status einer „Ware“, was zu einem verstärkt gewinnorientierten Betrieb und zur Entstehung von Vermittlungsinstanzen führte.
- Quote paper
- Laura Köhninger (Author), 2012, "Vampyre des Theaterlebens“. Wirkungsweise und Geschäftspraktiken von Theateragenten und Bühnenverlegern in der Kritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/435107