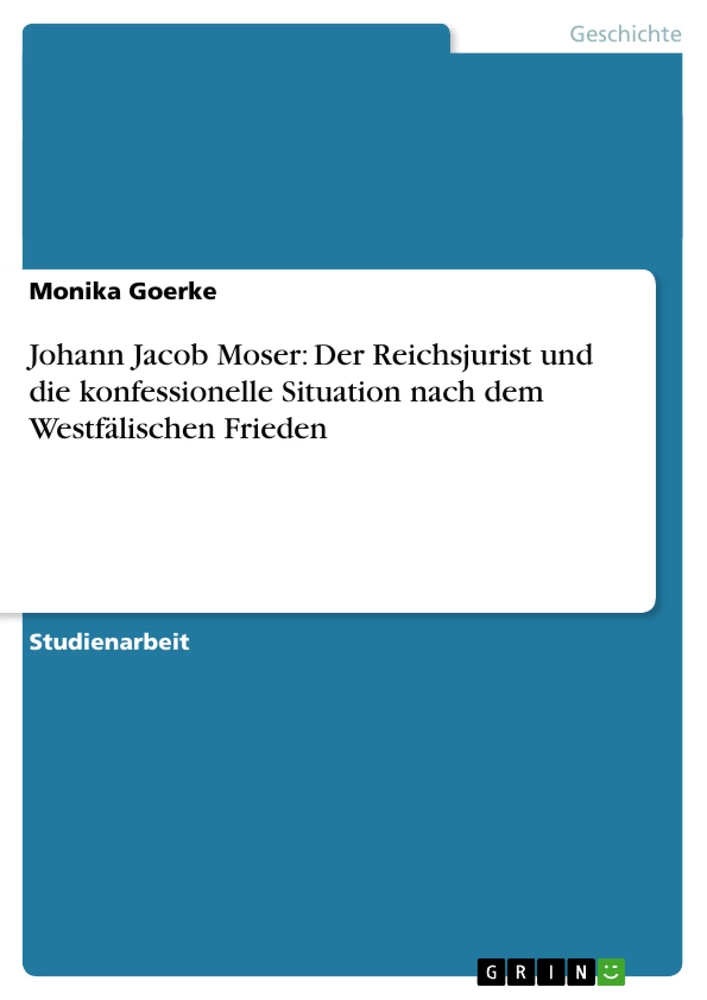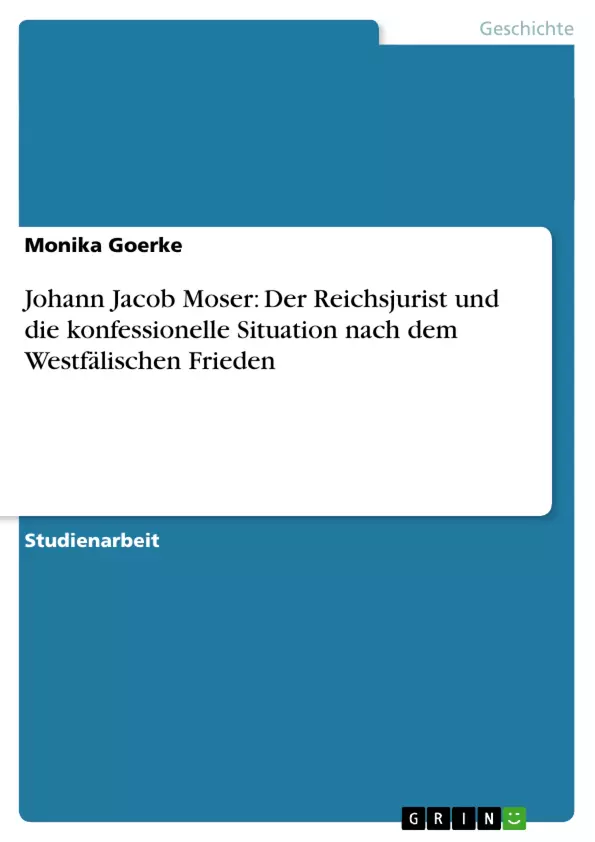Nach einer Zeit wirtschaftlicher, kultureller und politischer Verirrung durch den Dreißigjährigen Krieg war der Westfälische Frieden, der 1648 in Münster und Osnabrück geschlossen wurde, für das Heilige Römische Reich quasi Symbol für einen geordneten Neuanfang. Die Menschen erhofften sich eine Zeit der Gerechtigkeit, der Versöhnung und Ruhe. In den Augen der Staatsrechtler stellte der Frieden außerdem das wichtigste Grundgesetz des Reiches dar . Er bildete bei Verhandlungen über die Wahlkapitulationen oder in den Kurien des Regensburger Reichstages die oberste Richtschnur. Bis ins 19. Jahrhundert hinein waren die Verträge sowohl in Deutschland wie auch außerhalb maßgebendes Vorbild für die Beilegung von internationalen Konflikten .
Der Westfälische Frieden brachte für die Verfassung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation etliche Neuerungen. Auch das Verhältnis der Konfessionen zueinander wurde durch den Frieden neu geordnet. Das Vertragswerk ergänzte den Augsburger Religionsfrieden von 1555. Dabei wurden die bis dahin offen ausgetragenen konfessionellen Gegensätze politisch entschärft und durch die lange verhandelten Vertragsformeln juristisch überlagert. Vielfach gilt der Westfälische Frieden damit als Endpunkt des sog. „Konfessionellen Zeitalters“.
Allerdings trat der konfessionelle Gegensatz als politische Kategorie allein aufgrund des Friedens nicht zurück. Vielerorts wurden gegenreformatorische Bewegungen erst nach 1648 abgeschlossen. In manchen Regionen wurden Protestanten noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zur Emigration gezwungen . Die Bedeutung der konfessionellen Identität für die Menschen und das Zusammenleben unterschiedlicher religiöser Gruppen in der damaligen Zeit ist aus heutiger Sicht nicht immer einfach nachzuvollziehen. In der folgenden Seminararbeit wird dem Leser die konfessionelle Situation im Reich unter anderem mit Hilfe der Ausarbeitungen des Staatsrechtlers Johann Jacob Moser nähergebracht.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Johann Jacob Moser: der Reichsjurist
- I. Biographie
- II. Werk
- III. Bedeutung und Würdigung
- C. Die konfessionelle Situation im Reich
- I. Die Entstehung der Konfessionen im Deutschen Reich
- II. Die Religionsbestimmungen im Westfälischen Frieden
- III. Die konfessionelle Wirklichkeit im Deutschland des 18. Jahrhunderts
- D. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit dem Reichsjuristen Johann Jacob Moser und seiner Rolle in der konfessionellen Situation des Heiligen Römischen Reiches nach dem Westfälischen Frieden. Die Arbeit analysiert Mosers Lebensweg, sein umfangreiches Werk und seine Bedeutung für die Rechtswissenschaft. Dabei werden die konfessionellen Gegebenheiten im Alten Reich nach dem Westfälischen Frieden beleuchtet und die Auswirkungen des Friedens auf die Konfessionen im Reich untersucht.
- Der Lebensweg und das Werk des Reichsjuristen Johann Jacob Moser
- Die Entstehung der Konfessionen im Deutschen Reich
- Die Religionsbestimmungen des Westfälischen Friedens
- Die konfessionelle Wirklichkeit im Deutschland des 18. Jahrhunderts
- Die Auswirkungen des Westfälischen Friedens auf die Konfessionen im Reich
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung
Die Einleitung erläutert den historischen Kontext des Westfälischen Friedens und seine Bedeutung für das Heilige Römische Reich. Sie betont den Anspruch des Friedens auf einen geordneten Neuanfang nach dem Dreißigjährigen Krieg und seine Bedeutung als Grundgesetz des Reiches. Die Einleitung beleuchtet die Auswirkungen des Friedens auf die Verfassung des Reiches und die Neuordnung des Verhältnisses der Konfessionen zueinander. Sie verweist auf die Bedeutung des Westfälischen Friedens als Endpunkt des Konfessionellen Zeitalters und zeigt gleichzeitig, dass der konfessionelle Gegensatz als politische Kategorie nicht allein aufgrund des Friedens zurücktrat.
B. Johann Jacob Moser: der Reichsjurist
Kapitel B widmet sich der Person und dem Werk des Reichsjuristen Johann Jacob Moser, der trotz seiner Bedeutung im 19. Jahrhundert heute weitgehend unbekannt ist. Der Abschnitt beleuchtet Mosers ereignisreichen Lebensweg, sein umfangreiches Werk und seine Bedeutung für die Rechtswissenschaft. Der Fokus liegt dabei auf Mosers Engagement für die Erfassung der geltenden Verfassungswirklichkeit im Deutschen Reich und seiner Beschäftigung mit den Konfessionen und den Gesetzen, die ihr Zusammenleben regelten.
C. Die konfessionelle Situation im Reich
Kapitel C zeichnet die konfessionellen Gegebenheiten im Alten Reich nach dem Westfälischen Frieden nach. Es beleuchtet zunächst die Entstehung der Konfessionen in Deutschland und stellt anschließend die Religionsbestimmungen des Westfälischen Friedens dar. Auf der Grundlage von Mosers reichsrechtlichen Darstellungen wird ein Überblick über die konfessionelle Realität im Reich nach dem Friedensschluss gegeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen des Westfälischen Friedens, Johann Jacob Moser, Konfessionen, Reichsrecht, Religionsbestimmungen, konfessionelle Situation, konfessionelle Wirklichkeit, Deutsches Reich, 18. Jahrhundert, und die Bedeutung des Westfälischen Friedens als Endpunkt des Konfessionellen Zeitalters.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Johann Jacob Moser und welche Bedeutung hatte er?
Johann Jacob Moser war ein bedeutender Staatsrechtler des 18. Jahrhunderts, der als "Reichsjurist" bekannt wurde. Er widmete sein Werk der Erfassung der tatsächlichen Verfassungswirklichkeit des Heiligen Römischen Reiches.
Welche Auswirkungen hatte der Westfälische Frieden auf die Konfessionen?
Der Westfälische Frieden von 1648 ordnete das Verhältnis der Konfessionen neu, ergänzte den Augsburger Religionsfrieden und gilt oft als Endpunkt des "Konfessionellen Zeitalters", indem er religiöse Gegensätze juristisch überlagerte.
Blieb der konfessionelle Gegensatz nach 1648 politisch relevant?
Ja, trotz des Friedensschlusses blieb die konfessionelle Identität eine wichtige politische Kategorie. Gegenreformatorische Bewegungen hielten teils an, und noch im 18. Jahrhundert kam es zu konfessionell bedingten Emigrationen.
Was sind die zentralen Religionsbestimmungen des Westfälischen Friedens?
Der Frieden legte die rechtliche Gleichstellung der Konfessionen (Katholiken, Lutheraner und nun auch Reformierte) fest und schuf Regeln für das Zusammenleben und die Religionsausübung im Reich.
Warum ist Mosers Werk für die Untersuchung der konfessionellen Wirklichkeit wichtig?
Moser lieferte detaillierte reichsrechtliche Darstellungen, die zeigen, wie die Gesetze und die konfessionelle Realität im Deutschland des 18. Jahrhunderts tatsächlich ineinandergriffen.
- Arbeit zitieren
- Monika Goerke (Autor:in), 2004, Johann Jacob Moser: Der Reichsjurist und die konfessionelle Situation nach dem Westfälischen Frieden, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43525