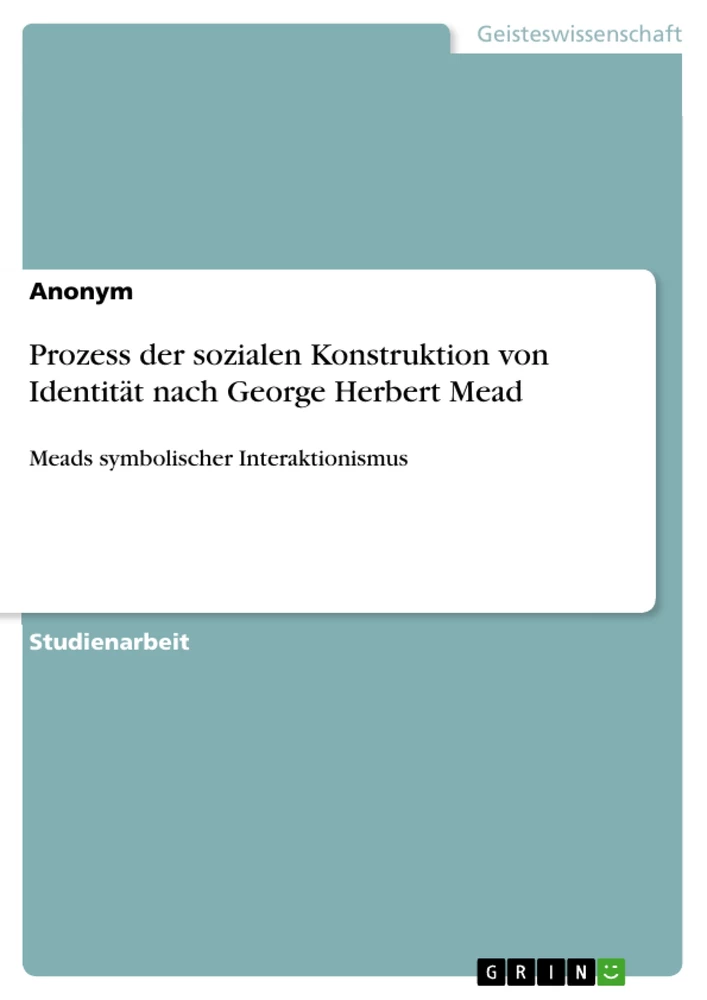Diese Hausarbeit behandelt den Prozess der sozialen Konstruktion von Identität nach George Herbert Mead. Entsprechend seiner Kernthese: „Der Prozeß, aus dem heraus sich die Identität entwickelt, ist ein gesellschaftlicher Prozeß, der die gegenseitige Beeinflussung der Mitglieder der Gruppe, also das vorherige Bestehen der Gruppe selbst voraussetzt“ soll beleuchtet werden, inwieweit die Bildung der Identität eines Individuums durch die Gesellschaft beeinflusst und vorangetrieben wird.
Der Hauptteil dieser Arbeit ist unter dem ersten Abschnitt, soziale Konstruktion von Identität, in drei Teilabschnitte gegliedert. Zunächst wird im ersten Teilabschnitt der Symbolische Interaktionismus vorgestellt, welcher sich mit der Vermittlung von gesellschaftlichen Regeln durch Sprache und Symbole auseinandersetzt und bis heute eine der bekanntesten Theorien aus Meads Sozialpsychologie darstellt. Im darauffolgenden zweiten Teilabschnitt wird das Augenmerk auf die eigentliche Entwicklung der Identität gelegt, die bereits im frühen Kindesalter beginnt und im Kern darin besteht, dass das Kind verschiedene Rollen übernimmt. Zuletzt wird im dritten Teilabschnitt der Aufbau der menschlichen Identität genauer beleuchtet und untersucht, wie sich Diese aus dem sogenannten Ich und ICH zusammensetzt.
Der zweite Abschnitt des Hauptteiles beschäftigt sich vornehmlich mit dem gesellschaftlichen Einfluss auf die Identitätsbildung und schlägt somit die Brücke zur eigentlichen Kernthese. In diesem Rahmen befasst sich die Arbeit mit dem - mit der Identität eng verknüpften - Thema der Moral, so wie Mead diese verstand.
Am Ende dieser Arbeit folgt eine Schlussbetrachtung, in welcher zum einen Kritik an Meads Theorie geübt und diese zum anderen kurz in den Kontext vergleichbarer oder folgender Theorien eingebettet wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Prozess der sozialen Konstruktion von Identität
- Symbolischer Interaktionismus als Voraussetzung der Identitätsbildung
- Entwicklung der Identität durch Perspektivübernahme
- Die Beschaffenheit der Identität
- Die Identität des Individuums als Teil der Gesellschaft
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der sozialen Konstruktion von Identität nach George Herbert Mead. Sie untersucht, wie die Bildung der Identität eines Individuums durch die Gesellschaft beeinflusst wird.
- Symbolischer Interaktionismus
- Entwicklung der Identität
- Beschaffenheit der Identität
- Gesellschaftlicher Einfluss
- Moral und Identität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Arbeit analysiert die soziale Konstruktion von Identität nach George Herbert Mead und beleuchtet den Einfluss der Gesellschaft auf die Identitätsbildung. Sie beschreibt den Aufbau der Arbeit und ihre Gliederung.
Prozess der sozialen Konstruktion von Identität
Dieser Abschnitt stellt den symbolischen Interaktionismus als Voraussetzung der Identitätsbildung vor und erläutert, wie die Identität durch Perspektivübernahme entwickelt wird. Schließlich wird die Beschaffenheit der Identität näher betrachtet und erklärt, wie sie sich aus Ich und ICH zusammensetzt.
Die Identität des Individuums als Teil der Gesellschaft
Dieser Abschnitt behandelt den gesellschaftlichen Einfluss auf die Identitätsbildung und beleuchtet, wie Moral und Identität miteinander verbunden sind.
Schlüsselwörter
Soziale Konstruktion von Identität, George Herbert Mead, Symbolischer Interaktionismus, Perspektivübernahme, Ich, ICH, Gesellschaftlicher Einfluss, Moral.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernthese von George Herbert Mead zur Identität?
Mead vertritt die Ansicht, dass Identität ein gesellschaftlicher Prozess ist, der die Interaktion mit Gruppenmitgliedern und die gegenseitige Beeinflussung voraussetzt.
Was versteht Mead unter „Ich“ (I) und „ICH“ (Me)?
Das „Ich“ (I) ist die spontane, impulsive Seite der Identität. Das „ICH“ (Me) repräsentiert die internalisierten Erwartungen der Gesellschaft und die soziale Kontrolle.
Wie funktioniert Identitätsbildung durch Perspektivübernahme?
Schon im Kindesalter lernen Individuen, die Rollen anderer zu übernehmen (Play und Game), um sich selbst aus der Perspektive der Mitmenschen wahrzunehmen.
Was ist Symbolischer Interaktionismus?
Es ist eine Theorie, die besagt, dass soziale Realität durch die Vermittlung von Regeln, Sprache und Symbolen in der Interaktion zwischen Menschen konstruiert wird.
Welchen Einfluss hat die Gesellschaft auf die Moral des Einzelnen?
Moral ist eng mit der Identität verknüpft. Mead sieht Moral als Ergebnis der Übernahme des „verallgemeinerten Anderen“, also der Normen der gesamten Gemeinschaft.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Prozess der sozialen Konstruktion von Identität nach George Herbert Mead, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/436016