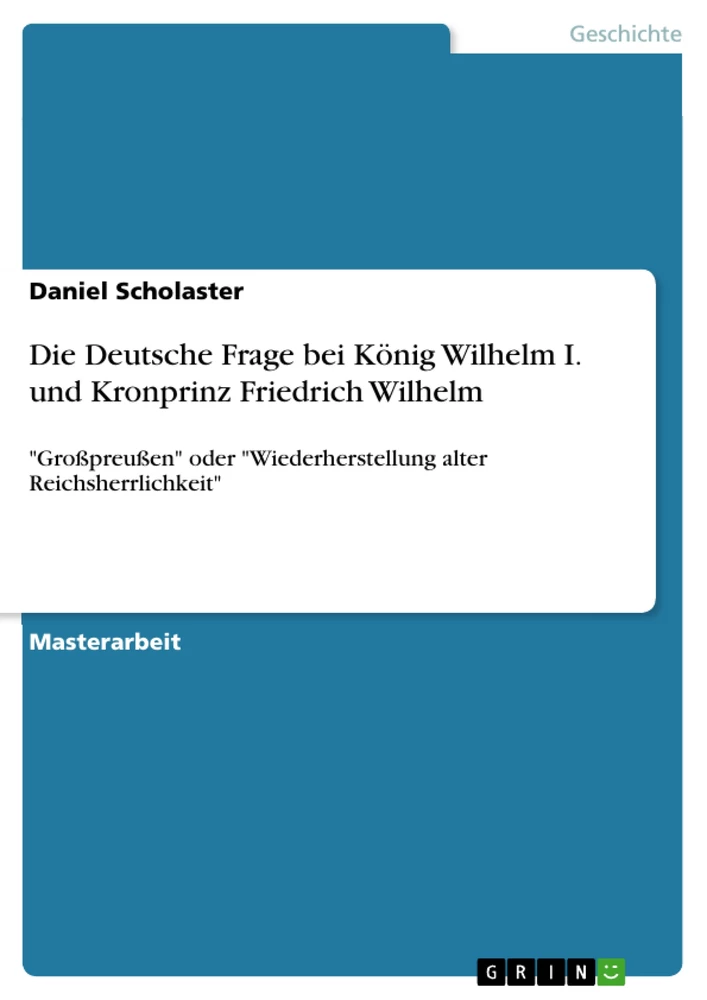Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Reichsgründung von 1871 mit besonderem Augenmerk auf den ersten Deutschen Kaiser Wilhelm I. und seinen Sohn, den späteren Kaiser Friedrich III. Ihre unterschiedlichen Ansichten in Bezug auf den Charakter des neuen deutschen Nationalstaats werden einander gegenübergestellt. Im Vordergrund stehen vor allem die Rolle des Kaisers als neuem Staatsoberhaupt, sowie die Beziehungen zu den Habsburgern und den deutschen Fürsten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Das Kaisertum - Zwischen preußischem Absolutismus, konstitutioneller Monarchie und mittelalterlichem Heerkönigtum
- 1. Das preußische Königtum
- a. Der preußische Absolutismus im 19. Jahrhundert
- b. Die Verfassung von 1848
- c. Das Amtsverständnis Wilhelms I. und die Krönung in Königsberg
- d. Die Verfassungskrise
- e. Die Danziger Rede des Kronprinzen
- f. Preußens Aufgabe in Deutschland
- 2. Der Kaiserplan von 1870
- 3. Die Kaiserproklamation in Versailles
- a. Die Reichstagsdelegation
- b. Die Titelfrage
- c. Die Zeremonie
- d. Reichsinsignien, Adler, Fahnen und Wappen
- II. Die Habsburger – Konkurrenten um die Vorherrschaft im Deutschen Bund
- 1. Der alte Dualismus
- a. Das Kaisertum der Habsburger
- b. Katholische Habsburger und protestantische Hohenzollern
- c. Gleichrangigkeit und Partnerschaft
- 2. Königgrätz – Schonung oder Demütigung des Gegners?
- 3. Die Hohenzollern als Erben der Habsburger?
- III. Die deutschen Fürsten - Verbündete oder Lehnsleute des Kaisers?
- 1. Preußen und die anderen Mitgliedsstaaten im Deutschen Bund nach 1848
- a. Die Verwandten und Freunde
- b. Die Gegner
- 2. Der Frankfurter Fürstentag
- 3. Die Hohenzollern und die deutschen Fürsten nach Königgrätz
- a. Die Unglücklichen – Der König von Hannover, der Kurfürst von Hessen und der Herzog von Nassau
- b. Die neuen Verbündeten – Der Großherzog von Baden und die Könige von Württemberg und Bayern
- c. Der Norddeutsche Bund
- 4. Die Reichsgründung
- a. Die Novemberverträge
- b. Der Kaiserbrief
- c. Die Huldigung der Fürsten in Versailles
- d. Der Kaiser als primus inter pares?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vorstellungen von König Wilhelm I. und Kronprinz Friedrich Wilhelm zur Gestaltung des neuen Deutschen Reiches nach 1870, insbesondere im Hinblick auf das Kaisertum. Im Fokus steht der Vergleich ihrer Ansichten und deren Beitrag zum Verständnis der „Deutschen Frage“. Der traditionelle Fokus auf Bismarck wird erweitert, um einen neuen Zugang zu diesem wichtigen historischen Thema zu ermöglichen.
- Das preußische Königtum und seine Ausprägung im 19. Jahrhundert.
- Die Rolle der Habsburger im Kontext der deutschen Einigung.
- Die Beziehungen zwischen Preußen und den anderen deutschen Fürstenhäusern.
- Die verschiedenen Konzepte des Kaisertums und die damit verbundenen politischen Debatten.
- Die Vorstellungen Wilhelms I. und Friedrich Wilhelms zur Ausgestaltung des neuen Reiches.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Kaiserproklamation von 1871 als einen der berühmtesten Momente der deutschen Geschichte und führt in die Thematik der unterschiedlichen Auffassungen vom neuen Deutschen Kaiserreich ein. Sie begründet die Wahl von Wilhelm I. und seinem Sohn Friedrich Wilhelm als zentrale Figuren der Untersuchung und erläutert die Forschungslücke hinsichtlich einer detaillierten Betrachtung der beiden Hohenzollern im Kontext der Reichsgründung, im Gegensatz zur bisherigen Fokussierung auf Bismarck. Die Arbeit kündigt eine analytische Betrachtung in drei Kapiteln an, welche die politischen Vorstellungen der beiden Protagonisten beleuchten sollen.
I. Das Kaisertum - Zwischen preußischem Absolutismus, konstitutioneller Monarchie und mittelalterlichem Heerkönigtum: Dieses Kapitel analysiert das preußische Königtum im 19. Jahrhundert, beginnend mit dem preußischen Absolutismus, der Verfassung von 1848 und dem Amtsverständnis Wilhelms I. Es untersucht die Verfassungskrise, die Danziger Rede des Kronprinzen und die Rolle Preußens innerhalb Deutschlands. Weiterhin beleuchtet es den Kaiserplan von 1870 und die Kaiserproklamation in Versailles, inklusive der damit verbundenen politischen und zeremoniellen Aspekte. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des preußischen Königtums hin zum deutschen Kaisertum und den damit verbundenen Kompromissen und Herausforderungen.
II. Die Habsburger – Konkurrenten um die Vorherrschaft im Deutschen Bund: Das Kapitel untersucht den Dualismus zwischen den Habsburgern und den Hohenzollern um die Vorherrschaft im Deutschen Bund. Es analysiert das Kaisertum der Habsburger, den religiösen Unterschied zwischen den katholischen Habsburgern und den protestantischen Hohenzollern, und die Frage der Gleichrangigkeit und Partnerschaft zwischen beiden Dynastien. Die Schlacht von Königgrätz wird im Hinblick auf die Schonung oder Demütigung des Gegners untersucht. Schließlich wird die Frage der Hohenzollern als Erben der Habsburger diskutiert, um die Entwicklung der Machtverhältnisse im Vorfeld der Reichsgründung zu verstehen.
III. Die deutschen Fürsten - Verbündete oder Lehnsleute des Kaisers?: Dieses Kapitel erörtert die Beziehungen zwischen Preußen und den anderen deutschen Fürstenhäusern nach 1848, indem es die verschiedenen Beziehungen zwischen Preußen und den anderen Mitgliedsstaaten des Deutschen Bundes differenziert betrachtet – sowohl die Verbündeten als auch die Gegner. Der Frankfurter Fürstentag und die Entwicklung nach Königgrätz werden analysiert, um die Rolle der verschiedenen Fürstenhäuser bei der Reichsgründung zu beleuchten. Die unterschiedlichen Reaktionen und die Bildung des Norddeutschen Bundes werden im Detail dargestellt, bis hin zur Reichsgründung und der Frage, ob der Kaiser als "primus inter pares" zu verstehen war. Der Fokus liegt auf der komplexen Dynamik der Machtverhältnisse und der Aushandlung der neuen politischen Ordnung.
Schlüsselwörter
Kaiser Wilhelm I., Kronprinz Friedrich Wilhelm, Deutsches Kaiserreich, Reichsgründung 1871, Preußisches Königtum, Habsburger, Deutsche Frage, Verfassung, Nationalstaat, Bismarck, Novemberverträge, Königgrätz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Das Deutsche Kaiserreich – Wilhelm I. und Friedrich Wilhelm im Kontext der Reichsgründung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Vorstellungen von Kaiser Wilhelm I. und Kronprinz Friedrich Wilhelm zur Gestaltung des Deutschen Kaiserreichs nach 1870. Im Mittelpunkt steht ein Vergleich ihrer Ansichten und deren Beitrag zum Verständnis der „Deutschen Frage“. Der Fokus liegt weniger auf Bismarck, sondern auf den beiden Hohenzollern und ihren individuellen Rollen bei der Reichsgründung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt das preußische Königtum im 19. Jahrhundert, die Rolle der Habsburger, die Beziehungen zwischen Preußen und anderen deutschen Fürstenhäusern, verschiedene Konzepte des Kaisertums, die politischen Debatten um die Reichsgründung und die konkreten Vorstellungen Wilhelms I. und Friedrich Wilhelms zur Gestaltung des neuen Reiches.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: Kapitel I untersucht das Kaisertum zwischen preußischem Absolutismus, konstitutioneller Monarchie und mittelalterlichem Heerkönigtum; Kapitel II analysiert die Habsburger als Konkurrenten um die Vorherrschaft im Deutschen Bund; und Kapitel III befasst sich mit den deutschen Fürsten als Verbündete oder Lehnsleute des Kaisers. Zusätzlich enthält die Arbeit eine Einleitung, ein Fazit, eine Zusammenfassung der Kapitel, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten und eine Liste der Schlüsselwörter.
Was sind die zentralen Fragen, die die Arbeit untersucht?
Zentrale Fragen sind: Wie prägten die Vorstellungen Wilhelms I. und Friedrich Wilhelms die Gestaltung des neuen Reiches? Welche Rolle spielten die Habsburger und die anderen deutschen Fürsten? Wie entwickelte sich das preußische Königtum zum deutschen Kaisertum? Welche Kompromisse und Herausforderungen waren damit verbunden?
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet? (Hinweis: Diese Frage kann nicht aus dem gegebenen HTML beantwortet werden.)
Die verwendeten Quellen sind aus dem gegebenen HTML nicht ersichtlich. Eine detaillierte Quellenangabe findet sich vermutlich im vollständigen Text der Arbeit.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit? (Hinweis: Diese Frage kann nur teilweise aus dem gegebenen HTML beantwortet werden.)
Das Fazit der Arbeit ist im gegebenen HTML nicht vollständig enthalten. Die Zusammenfassung der Kapitel gibt jedoch einen Einblick in die analytischen Schwerpunkte der einzelnen Kapitel und lässt vermuten, dass die Arbeit die komplexen Machtverhältnisse und die Aushandlungsprozesse bei der Reichsgründung detailliert untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kaiser Wilhelm I., Kronprinz Friedrich Wilhelm, Deutsches Kaiserreich, Reichsgründung 1871, Preußisches Königtum, Habsburger, Deutsche Frage, Verfassung, Nationalstaat, Bismarck, Novemberverträge, Königgrätz.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Wissenschaftler, Studenten und alle Interessierten gedacht, die sich mit der deutschen Geschichte, insbesondere der Reichsgründung von 1871, befassen. Sie bietet einen neuen Zugang zu diesem Thema durch die detaillierte Betrachtung der Rolle Wilhelms I. und Friedrich Wilhelms.
- Citation du texte
- Daniel Scholaster (Auteur), 2016, Die Deutsche Frage bei König Wilhelm I. und Kronprinz Friedrich Wilhelm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/436062