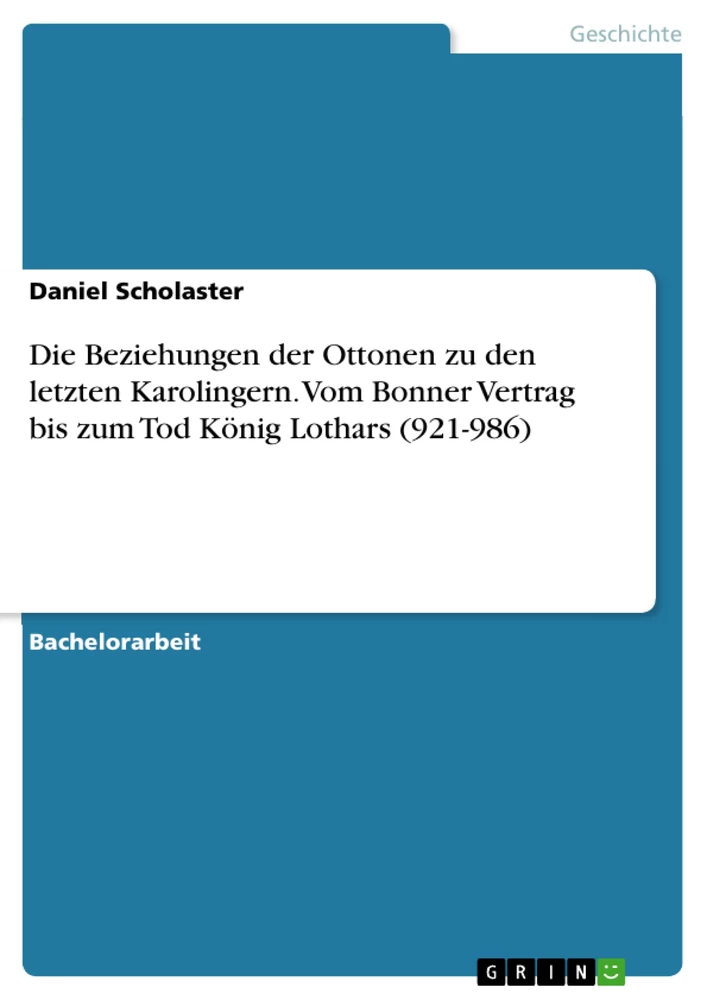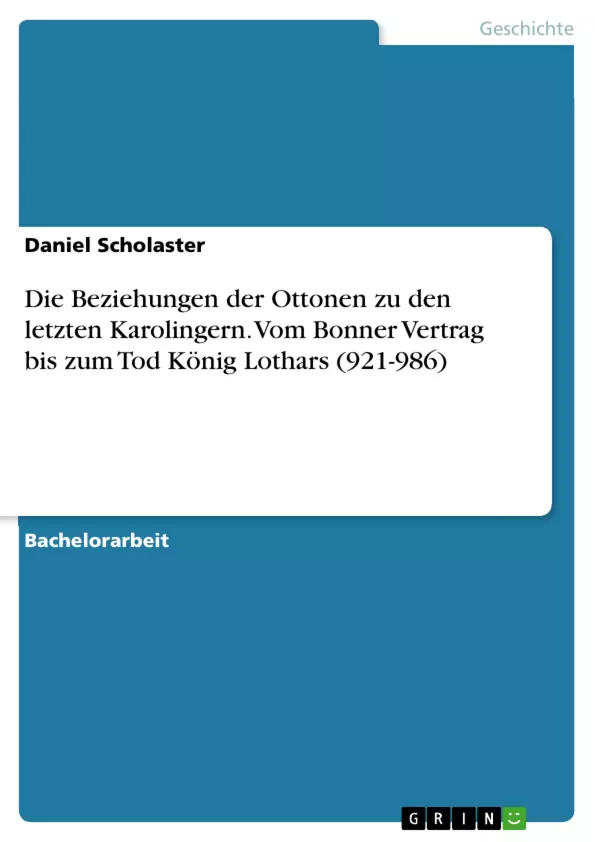Die Arbeit beschäftigt sich mit den Beziehungen der Ottonen und der Karolinger im 10. Jahrhundert. Dabei wurden die damaligen mittelalterlichen Geschichtsschreiber in Deutschland und Frankreich als hauptsächliche Quellen herangezogen. Besonderes Augenmerk lag auf der Darstellung der jeweils anderen Seite durch diese Geschichtsschreiber.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Forschungsstand
- 2. Quellen
- 3. Methodik
- II. Der Bonner Vertrag (921)
- III. Der Vertrag von Visé (942)
- IV. Die Synode von Ingelheim (948)
- V. Der Kölner Hoftag (965)
- VI. Der Frieden von Margut (980)
- VII. Fazit
- VIII. Literaturverzeichnis
- 1. Quellen
- 2. Forschungsliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende B.A.-Arbeit untersucht die Beziehungen zwischen den letzten Karolingern in Westfranken und dem neuen ottonischen Herrscherhaus in Ostfranken im Zeitraum von 921 bis 986. Sie analysiert die verschiedenen Formen der Beziehungen zwischen den beiden Geschlechtern – von Konflikten über Phasen der friedlichen Koexistenz bis hin zu verwandtschaftlichen Bindungen – anhand der historiografischen Quellen der Zeit.
- Die Konflikte um das Erbe Lothars II.
- Die Prozesse der Nationenbildung im Mittelalter.
- Die Bedeutung von Herrschertreffen für die Politik im frühen Mittelalter.
- Die westfränkische und ostfränkische Historiografie des 10. und frühen 11. Jahrhunderts.
- Die Einordnung der ottonischen Zeit in die deutsche Geschichte.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel liefert einen Überblick über den Forschungsstand zur Thematik der Beziehungen zwischen den Ottonen und den letzten Karolingern. Es werden verschiedene Positionen zur Entstehung der deutschen Geschichte und die zentralen Forschungsarbeiten zum Thema vorgestellt.
- Der Bonner Vertrag (921): Dieses Kapitel analysiert den Bonner Vertrag als ersten wichtigen Schritt in der Auseinandersetzung zwischen den Ottonen und den Karolingern um das Erbe Lothars II.
- Der Vertrag von Visé (942): Hier wird der Vertrag von Visé als ein weiteres Beispiel für die komplexen Beziehungen zwischen den beiden Herrscherhäusern betrachtet.
- Die Synode von Ingelheim (948): Dieses Kapitel beleuchtet die Synode von Ingelheim als ein wichtiges Ereignis, das den Konflikt zwischen den Ottonen und den Karolingern weiter eskalierte.
- Der Kölner Hoftag (965): Das Kapitel untersucht den Kölner Hoftag als ein bedeutendes Symbol der Macht und des Einflusses der Ottonen.
- Der Frieden von Margut (980): Dieses Kapitel stellt den Frieden von Margut als ein Zeichen der Versöhnung zwischen den beiden Herrscherhäusern dar.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Beziehungen zwischen den Ottonen und den letzten Karolingern, dem Erbe Lothars II., der Nationenbildung im Mittelalter, Herrschertreffen, historiografischen Quellen, der westfränkischen und ostfränkischen Historiografie, der Einordnung der ottonischen Zeit in die deutsche Geschichte. Zu den zentralen Konzepten gehören die Auseinandersetzung um das Erbe Lothars II., die Entstehung der deutschen Geschichte, die Bedeutung von Herrschertreffen für die politische Macht im frühen Mittelalter, die Rolle der Historiografie im Spannungsfeld zwischen Macht und Ideologie.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Zeitraum umfasst die Untersuchung der Ottonen und Karolinger?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Jahre 921 bis 986, vom Bonner Vertrag bis zum Tod von König Lothar.
Was war die Bedeutung des Bonner Vertrags von 921?
Der Vertrag gilt als erster wichtiger Schritt in der Auseinandersetzung zwischen den Ottonen und Karolingern um das Erbe Lothars II. und die Anerkennung der Herrschaft.
Welche Quellen wurden für die Arbeit genutzt?
Die Analyse basiert primär auf mittelalterlichen Geschichtsschreibern (Historiografie) aus Deutschland und Frankreich, um die gegenseitige Wahrnehmung zu untersuchen.
Wie wird die Nationenbildung im Mittelalter thematisiert?
Die Arbeit untersucht, wie die Beziehungen zwischen Westfranken und Ostfranken zur Entstehung der deutschen und französischen Identität beigetragen haben.
Was geschah beim Kölner Hoftag 965?
Der Kölner Hoftag wird als bedeutendes Symbol für die Macht und den wachsenden Einfluss des ottonischen Herrscherhauses analysiert.
- Citar trabajo
- Daniel Scholaster (Autor), 2014, Die Beziehungen der Ottonen zu den letzten Karolingern. Vom Bonner Vertrag bis zum Tod König Lothars (921-986), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/436276