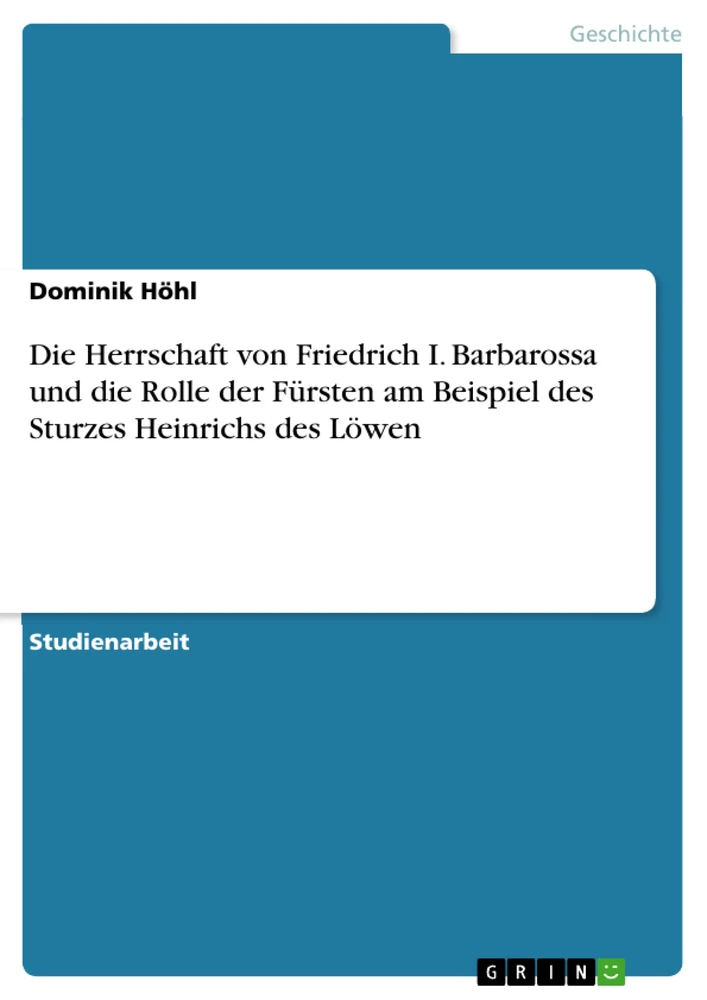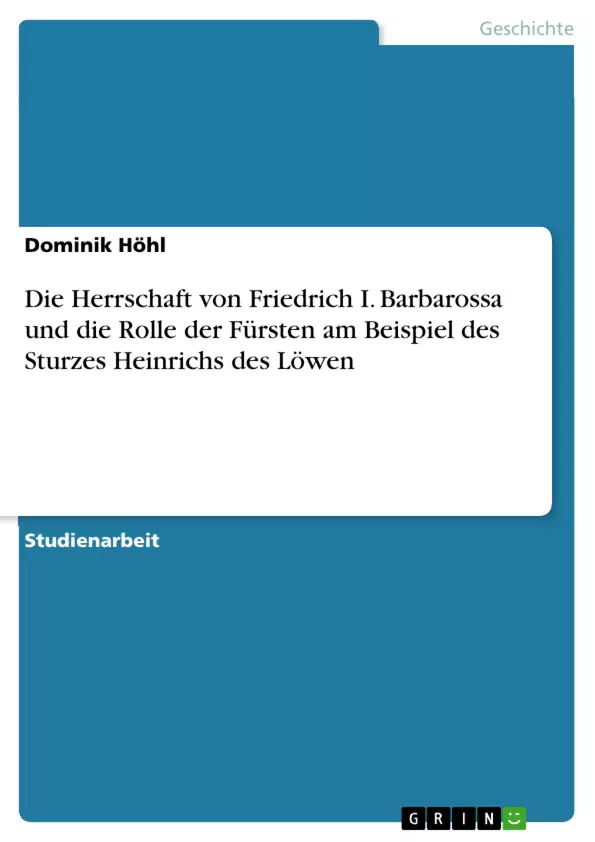Spätestens in der Folge des Wormser Konkordats sowie der Wahl Lothars III. wurden die Reichsfürsten vom König unabhängiger und stellten sich als Repräsentanten des römisch-deutschen Reiches heraus, also auch als Mit- oder Gegenspieler des Königs. Das Reich bildete sich demgemäß gemeinsam aus dem König und den Reichsfürsten zusammen. Ohne die Unterstützung der Fürsten konnte auch Friedrich I. Barbarossa seine Herrschaft nicht ausüben, deren Mitwirkung an der Regierung durch ein Zitat von Otto von Freising aus der Gesta Frederici greifbar wird:
„Nach Vollzug aller Krönungszeremonien zog sich der König in die Privatgemächer der Pfalz zurück; er berief aus der Zahl der Fürsten besonders erfahrene und bedeutende zu sich, beriet mit ihnen über die Lage des Reiches und ordnete an, dass Gesandte an Papst Eugen, an die Stadt Rom und ganz Italien geschickt würden, die seine Wahl zum König anzeigen sollten.“
Im Folgenden wird untersucht werden, welche Rolle und welchen Einfluss die Fürsten auf das Reichsgeschehen sowie auf die Handlungsspielräume Friedrich Barbarossas besaßen und ausübten. Die Untersuchung der genannten Fragestellung soll dabei am Beispiel des Sturzes Heinrichs des Löwen erfolgen. Zunächst werden die ersten Regierungsjahre des Kaisers kurz beleuchtet. Hierbei wird anfänglich die Einbindung der Fürsten in die Reichspolitik betrachtet, um anschließend auf die Förderung von Heinrich dem Löwen von Seiten Barbarossas einzugehen. In einem weiteren Schritt soll schließlich die Rolle der Fürsten am Sturz Heinrichs des Löwen näher beleuchtet werden. Dies geschieht zunächst unter der Betrachtung der Stellung des Löwen in seinem Herzogtum Sachsen. Nachdem ein näherer Blick auf die Bedeutung des Kölner Erzbischofs Philipp von Heinsberg hinsichtlich der Entmachtung des Löwen geworfen wird, erfolgt abschließend der Prozess gegen den Herzog. Die Auseinandersetzung mit Friedrich Barbarossa sowie Heinrich dem Löwen erfreut sich in der Forschung großer Beliebtheit und ist thematisch äußerst vielfältig. Im Rahmen dieser Arbeit können als grundlegend die Biographien von Ehlers, Opll, Laudage sowie insbesondere von Görich gelten. Neben literarischen Quellen erweist sich hinsichtlich der Entmachtung Heinrichs vor allem die Gelnhäuser Urkunde als überaus wichtige und nützliche Quelle.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die ersten Regierungsjahre Friedrich Barbarossas
- Die Einbindung der Fürsten in die Reichspolitik
- Die Förderung Heinrichs des Löwen seitens Friedrich Barbarossas
- Der Sturz Heinrichs des Löwen und die Rolle der Fürsten
- Die Machtstellung Heinrichs des Löwen in Sachsen
- Der Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg als Gegenspieler Heinrichs des Löwen
- Der Prozess
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Reichsfürsten auf die Herrschaft Friedrich Barbarossas, insbesondere im Kontext des Sturzes Heinrichs des Löwen. Die Analyse zielt darauf ab, die wechselseitigen Beziehungen zwischen Kaiser und Fürsten aufzuzeigen und deren Bedeutung für die Reichspolitik zu beleuchten.
- Die Einbindung der Fürsten in die Reichspolitik Friedrich Barbarossas
- Die Rolle des Lehnswesens als Grundlage des Verhältnisses zwischen Kaiser und Fürsten
- Die Förderung Heinrichs des Löwen durch Friedrich Barbarossa
- Der Sturz Heinrichs des Löwen und die beteiligten Fürsten
- Die Bedeutung des Kölner Erzbischofs Philipp von Heinsberg
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung legt die Forschungsfrage fest: Welche Rolle spielten die Reichsfürsten in der Herrschaft Friedrich Barbarossas, insbesondere beim Sturz Heinrichs des Löwen? Sie verweist auf die zunehmende Unabhängigkeit der Fürsten nach dem Wormser Konkordat und betont die Notwendigkeit ihrer Unterstützung für den Kaiser. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der die ersten Regierungsjahre Barbarossas, die Förderung Heinrichs des Löwen und dessen Sturz beleuchtet, um die Rolle der Fürsten zu analysieren. Die Bedeutung etablierter Biographien zu Friedrich Barbarossa und Heinrich dem Löwen für die Forschungsarbeit wird hervorgehoben.
2. Die ersten Regierungsjahre Friedrich Barbarossas: Dieses Kapitel analysiert die Einbindung der Fürsten in die Reichspolitik Barbarossas und seine Förderung Heinrichs des Löwen. Das Lehnswesen wird als zentrale Grundlage des Verhältnisses zwischen Kaiser und Fürsten dargestellt, wobei das consilium et auxilium (Rat und Hilfe) im Mittelpunkt steht. Barbarossas Politik der Privilegienvergabe an einzelne Fürsten, wie beispielsweise Welf VI. und Wladislaw von Böhmen, wird als Mittel zur Sicherung seiner Herrschaft interpretiert. Das Kapitel zeigt, wie Barbarossa die Interessen der Fürsten berücksichtigte, um deren Loyalität zu gewinnen, auch wenn dies zu Kompromissen in seiner Italienpolitik führte, wie der Verzicht auf einen geplanten Feldzug gegen Sizilien.
3. Der Sturz Heinrichs des Löwen und die Rolle der Fürsten: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Fürsten beim Sturz Heinrichs des Löwen. Zunächst wird die Machtposition Heinrichs in Sachsen analysiert, gefolgt von einer Betrachtung des Kölner Erzbischofs Philipp von Heinsberg als zentralen Gegenspieler. Das Kapitel beschreibt den Prozess gegen Heinrich den Löwen und verdeutlicht, wie verschiedene Fürsten durch ihre Handlungen und Bündnisse zum Sturz des Herzogs beitrugen. Die Zusammenfassung betont die Komplexität der Beziehungen zwischen den verschiedenen Fürsten und ihre unterschiedlichen Motive in diesem Konflikt. Die Gelnhäuser Urkunde wird als besonders wichtige Quelle genannt.
Schlüsselwörter
Friedrich Barbarossa, Heinrich der Löwe, Reichsfürsten, Lehnswesen, Reichspolitik, Italienpolitik, Privilegien, consilium et auxilium, Philipp von Heinsberg, Sturz, Sachsen, Macht, Konflikt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Rolle der Reichsfürsten in der Herrschaft Friedrich Barbarossas - Am Beispiel des Sturzes Heinrichs des Löwen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Einfluss der Reichsfürsten auf die Herrschaft Friedrich Barbarossas, insbesondere im Kontext des Sturzes Heinrichs des Löwen. Sie untersucht die wechselseitigen Beziehungen zwischen Kaiser und Fürsten und deren Bedeutung für die Reichspolitik.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Einbindung der Fürsten in die Reichspolitik Friedrich Barbarossas, die Rolle des Lehnswesens, die Förderung Heinrichs des Löwen durch Barbarossa, den Sturz Heinrichs des Löwen und die beteiligten Fürsten, sowie die Bedeutung des Kölner Erzbischofs Philipp von Heinsberg.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel über die ersten Regierungsjahre Friedrich Barbarossas, einem Kapitel über den Sturz Heinrichs des Löwen und seinen Einfluss auf die Fürsten, und einem Fazit. Jedes Kapitel analysiert die Rolle der Fürsten im jeweiligen Kontext.
Wie werden die ersten Regierungsjahre Friedrich Barbarossas dargestellt?
Das Kapitel analysiert die Einbindung der Fürsten in Barbarossas Reichspolitik und seine Förderung Heinrichs des Löwen. Es betont das Lehnswesen als Grundlage des Verhältnisses zwischen Kaiser und Fürsten, Barbarossas Politik der Privilegienvergabe und die Notwendigkeit von Kompromissen, um die Loyalität der Fürsten zu sichern.
Wie wird der Sturz Heinrichs des Löwen beschrieben?
Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Fürsten beim Sturz Heinrichs des Löwen. Es analysiert Heinrichs Machtposition in Sachsen, die Gegenspielerrolle des Kölner Erzbischofs Philipp von Heinsberg, den Prozess gegen Heinrich den Löwen und die Handlungen verschiedener Fürsten, die zu seinem Sturz beitrugen. Die Komplexität der Beziehungen zwischen den Fürsten und deren unterschiedliche Motive werden hervorgehoben.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf etablierte Biographien zu Friedrich Barbarossa und Heinrich dem Löwen sowie auf Quellen wie die Gelnhäuser Urkunde. Die Bedeutung des consilium et auxilium (Rat und Hilfe) wird im Zusammenhang mit dem Lehnswesen betrachtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Barbarossa, Heinrich der Löwe, Reichsfürsten, Lehnswesen, Reichspolitik, Italienpolitik, Privilegien, consilium et auxilium, Philipp von Heinsberg, Sturz, Sachsen, Macht, Konflikt.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Rolle spielten die Reichsfürsten in der Herrschaft Friedrich Barbarossas, insbesondere beim Sturz Heinrichs des Löwen?
- Arbeit zitieren
- Dominik Höhl (Autor:in), 2017, Die Herrschaft von Friedrich I. Barbarossa und die Rolle der Fürsten am Beispiel des Sturzes Heinrichs des Löwen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/436371