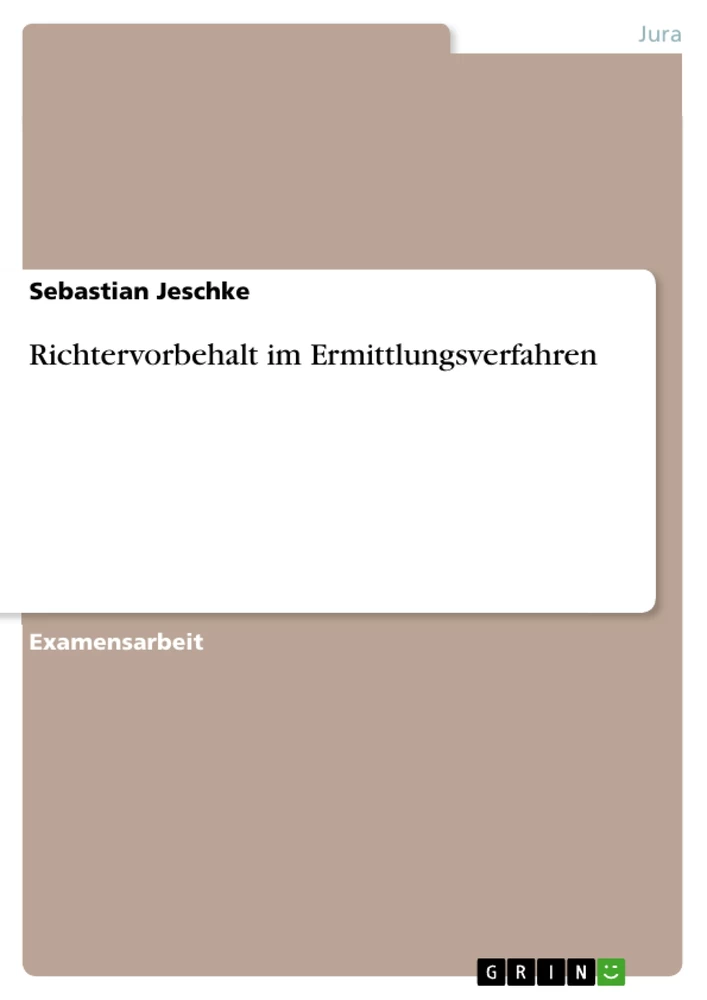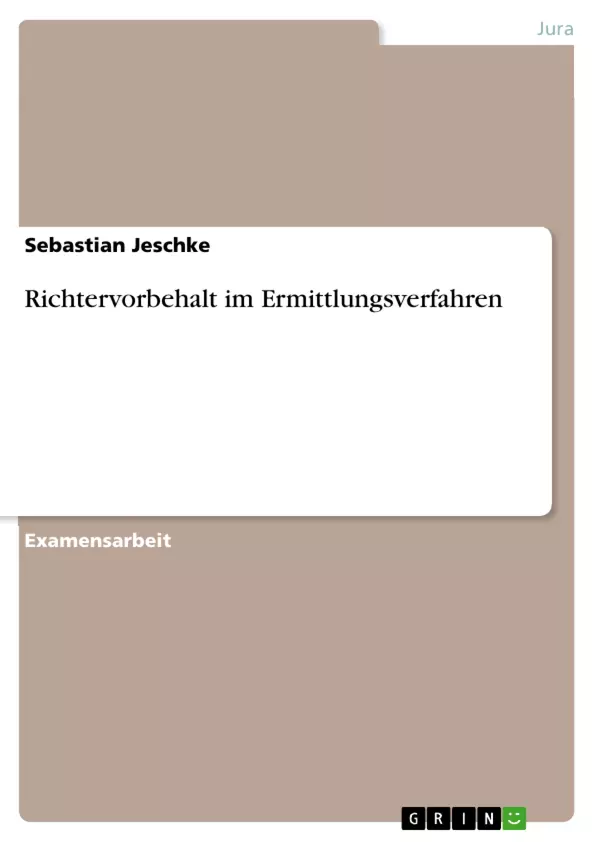Die Erforschung der Wahrheit, die prozessmäßige Gestaltung des Verfahrens, das Wiederherstellen des Rechtsfriedens. Pax et pius sind die Ziele des Strafverfahrens. Das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt das unabweisbare Bedürfnis einer wirksamen und daher effizienten Strafverfolgung betont. Doch dem Strafmonopol des Staates darf im Rechtsstaat nicht um jeden Preis zur Geltung verholfen werden.
Manchmal ist daher rechtlich nicht zulässig, was taktisch sinnvoll und technisch möglich wäre. Doch wer bremst die Behörden der Exekutive in ihren Ermittlungen? Wem kann die Aufgabe übertragen werden, die Rechte des Täters und unbeteiligten Dritten gegenüber den Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden zu schützen?
Im Jahr 1877 kannte der Gesetzgeber hierauf nur eine Antwort: Den Richtervorbehalt. Zu groß war das Misstrauen der Parlamentarier gegenüber den reaktionär gesinnten Strafverfolgungsbehörden. Im Jahr 2018 ist das Vertrauen des Parlaments und der Judikative in die Behörden der Exekutive grundsätzlich vorhanden. Der Staat sieht sich heute neben alten Phänomenen der Strafjustiz mit neuen Formen der Kriminalität konfrontiert. Neben den klassischen Formen der Alltagskriminalität greifen Kriminelle heutzutage auch auf moderne Mittel der Telekommunikation und internationale Strukturen zurück.
Es stellt sich in Anbetracht dieser Herausforderungen die Frage, wie effizient das Ermittlungsverfahren gestaltet werden kann und welche Rolle aus rechts- staatlichen Gesichtspunkten dabei einer Kontrollinstanz zukommt.
Spielt die Selbstkontrolle des Staates durch die Verzögerung des Strafverfahrens den Tätern in die Hände? Diese Arbeit soll die Frage aufgreifen, inwieweit eine richterliche Kontrolle repressiver Maßnahmen im Ermittlungsverfahren geboten ist und in welchen Bereichen eine Kompetenzverlagerung zu den Behörden der Exekutive möglich ist. Hierbei sollen auch Alternativen des Richtervorbehalts aufgezeigt und bewertet werden. Gesamtnote (Arbeit + Seminar): 12,2 Punkte.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Das Ermittlungsverfahren
- I. Zweck des Ermittlungsverfahrens
- II. Die Stellung des Beschuldigten im Ermittlungsverfahren im Verhältnis zu den Organen der Exekutive
- C. Der Richtervorbehalt im Ermittlungsverfahren
- I. Wesen des Richtervorbehalts
- 1. Begriff
- 2. Prüfungsumfang
- II. Systematik des Richtervorbehalts im deutschen Rechtswesen
- 1. Regelungsebenen
- 1.1. Verfassungsrechtliche Richtervorbehalte
- 1.2. Einfachgesetzliche Richtervorbehalte
- 2. Entscheidungsformen
- 2.1. Die vorherige richterliche Entscheidung
- 2.2. Die nachträgliche richterliche Entscheidung
- 1. Regelungsebenen
- III. Die Rechtsnatur von richterlichen Entscheidungen im Ermittlungsverfahren
- IV. Die Notwendigkeit des Richtervorbehalts im Ermittlungsverfahren
- 1. Der Richtervorbehalt als historisch gewachsenes Erfordernis
- 1.1. Der Ursprung des Richtervorbehalts im deutschen Strafprozess
- 1.2. Rechtsverletzungen während des Nationalsozialismus
- 2. Der Richtervorbehalt als verfassungsrechtlich garantiertes Rechtsinstitut
- 2.1. Allgemeine Feststellungen
- 2.2. Art. 19 IV GG als verfassungsrechtliche Grundlage des Richtervorbehalts
- 2.3. Art. 13 und Art. 104 GG als analogiefähige Vorschriften?
- 2.4. Argument der Schwere des Grundrechtseingriffs
- 1. Der Richtervorbehalt als historisch gewachsenes Erfordernis
- V. Das Institut des Richtervorbehalts: Überholtes Verfahrenshindernis oder wirksamer Schutz vor Rechtsverletzungen durch die Exekutive?
- 1. Die richterliche Entscheidung als Ausgleich fehlender Rechtskenntnisse bei den Beamten des Polizeidienstes
- 2. Das Erfordernis einer distanzierten Betrachtung des in Frage stehenden Sachverhalts im Angesicht des Prinzips der Gewaltenteilung
- 2.1. Problemstellung
- a) Beeinflussung der Entscheidungsträger durch subjektive Empfindungen
- b) Beeinflussung der Entscheidungsträger durch politische Vorgaben oder gesellschaftliche Einflüsse
- 2.2. Lösungsansätze
- a) Der Behördenleitervorbehalt
- b) Der Ministerialvorbehalt
- c) Generelle Kompetenzverlagerung zur Staatsanwaltschaft
- d) Der Richtervorbehalt
- 2.1. Problemstellung
- VI. Die Entbehrlichkeit einer richterlichen Anordnung im Ermittlungsverfahren
- 1. Bei Einwilligung des Beschuldigten in den Grundrechtseingriff
- 2. Bei Vorliegen von Gefahr in Verzug
- VII. Quo vadis, Richtervorbehalt?
- 1. Die Entwicklung des Richtervorbehalts am Beispiel der Neufassung des § 81 a II S. 2 StPO
- 1.1. Zweck des § 81 a StPO
- 1.2. Anordnungskompetenz
- 1.3. Bewertung der Kompetenzverschiebung, § 81 a II S. 2 StPO
- a) Führte die Neuregelung zu einem Kontrollverlust der Staatsanwaltschaft?
- b) Läuft diese Kompetenzverschiebung der Schutzbedürftigkeit des Beschuldigten zuwider?
- 2. § 81 a II S. 2 StPO als Vorbild für weitere Kompetenzverschiebungen hin zur Polizei?
- a) bei heimlichen und überraschenden Maßnahmen
- b) bei offen durchgeführten Maßnahmen
- 3. Mögliche Kompetenzverschiebungen zur Staatsanwaltschaft
- 1. Die Entwicklung des Richtervorbehalts am Beispiel der Neufassung des § 81 a II S. 2 StPO
- I. Wesen des Richtervorbehalts
- D. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die aktuelle Problematik des Richtervorbehalts im Ermittlungsverfahren unter besonderer Berücksichtigung des § 81a II S. 2 StPO zu analysieren und kritisch zu beleuchten.
- Entwicklung des Richtervorbehalts im deutschen Strafprozess
- Rechtsschutz des Beschuldigten im Ermittlungsverfahren
- Verfassungsrechtliche Grundlagen des Richtervorbehalts
- Die Bedeutung des Prinzips der Gewaltenteilung im Ermittlungsverfahren
- Aktuelle Debatten um die Kompetenzverteilung zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit untersucht die historische Entwicklung des Richtervorbehalts im deutschen Strafprozess und stellt dessen Bedeutung für den Schutz der Grundrechte des Beschuldigten heraus. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Analyse der rechtlichen und faktischen Probleme, die mit dem Richtervorbehalt verbunden sind, insbesondere im Kontext der aktuellen Strafprozessordnung.
- Kapitel B beleuchtet die Stellung des Beschuldigten im Ermittlungsverfahren im Verhältnis zu den Organen der Exekutive und beschreibt den Zweck des Ermittlungsverfahrens.
- Kapitel C definiert den Begriff des Richtervorbehalts und untersucht die unterschiedlichen Regelungsebenen und Entscheidungsformen.
- Kapitel IV analysiert die Notwendigkeit des Richtervorbehalts im Ermittlungsverfahren unter Berücksichtigung historischer und verfassungsrechtlicher Aspekte.
- Kapitel V setzt sich kritisch mit dem Institut des Richtervorbehalts auseinander und diskutiert dessen Überholtheit oder Wirksamkeit im Hinblick auf den Schutz vor Rechtsverletzungen durch die Exekutive.
- Kapitel VI thematisiert die Entbehrlichkeit einer richterlichen Anordnung im Ermittlungsverfahren unter bestimmten Voraussetzungen, wie z.B. bei Einwilligung des Beschuldigten oder im Falle von Gefahr in Verzug.
- Kapitel VII widmet sich der Entwicklung des Richtervorbehalts am Beispiel der Neufassung des § 81a II S. 2 StPO und beleuchtet die damit verbundenen Auswirkungen auf die Kompetenzverteilung zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei.
Schlüsselwörter
Richtervorbehalt, Ermittlungsverfahren, Strafprozessordnung, Beschuldigter, Grundrechte, Gewaltenteilung, Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht, § 81a StPO, Kompetenzverteilung, Rechtsverletzung, Schutzbedürftigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Richtervorbehalt" im Strafverfahren?
Es ist das Erfordernis, dass schwerwiegende Grundrechtseingriffe (wie Durchsuchungen oder Blutentnahmen) grundsätzlich von einem unabhängigen Richter angeordnet werden müssen.
Wann ist eine richterliche Anordnung entbehrlich?
Bei "Gefahr in Verzug", wenn also durch die Verzögerung bis zur richterlichen Entscheidung der Ermittlungserfolg gefährdet wäre, oder bei Einwilligung des Beschuldigten.
Was wurde durch § 81a Abs. 2 S. 2 StPO neu geregelt?
Die Neuregelung verlagerte die Kompetenz für Blutentnahmen bei bestimmten Verkehrsdelikten von den Richtern hin zur Polizei und Staatsanwaltschaft, um das Verfahren zu beschleunigen.
Warum ist der Richtervorbehalt verfassungsrechtlich wichtig?
Er dient der Gewaltenteilung und schützt den Bürger vor willkürlichen Eingriffen der Exekutive (Polizei/Staatsanwaltschaft) durch eine neutrale Kontrollinstanz.
Führt der Richtervorbehalt zu einer Verzögerung der Strafverfolgung?
Kritiker sehen darin ein Verfahrenshindernis, während Befürworter betonen, dass rechtsstaatliche Prinzipien wichtiger sind als maximale Effizienz.
Welche Rolle spielt die Staatsanwaltschaft im Vergleich zum Richter?
Die Staatsanwaltschaft leitet das Ermittlungsverfahren, ist aber Teil der Exekutive. Der Richter soll als distanzierter Dritter die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen prüfen.
- Citation du texte
- Sebastian Jeschke (Auteur), 2018, Richtervorbehalt im Ermittlungsverfahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/436434