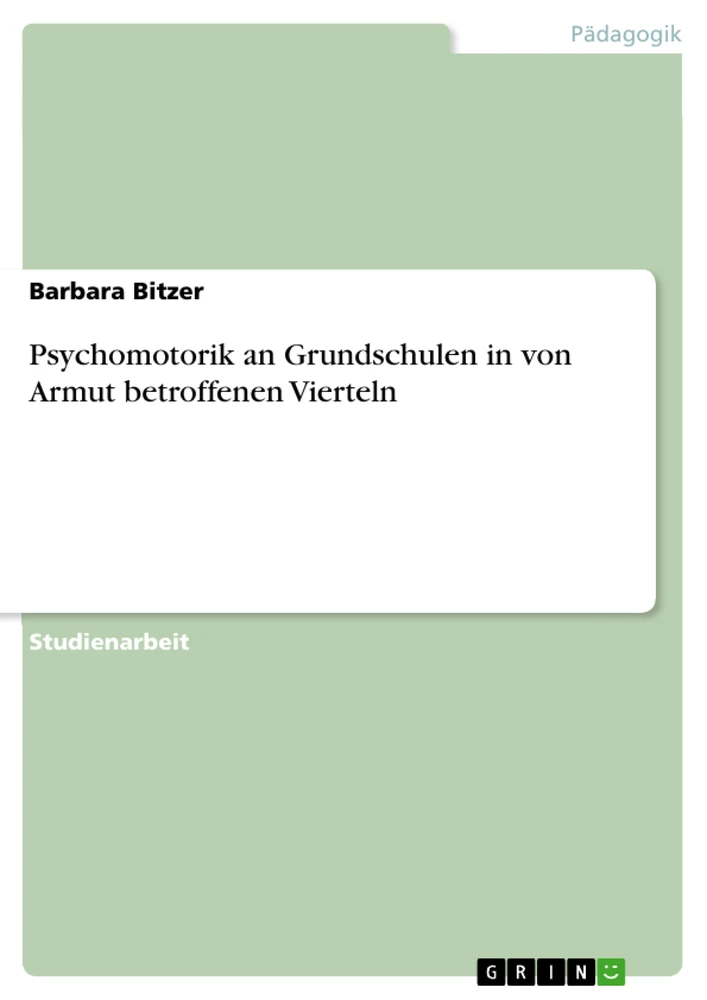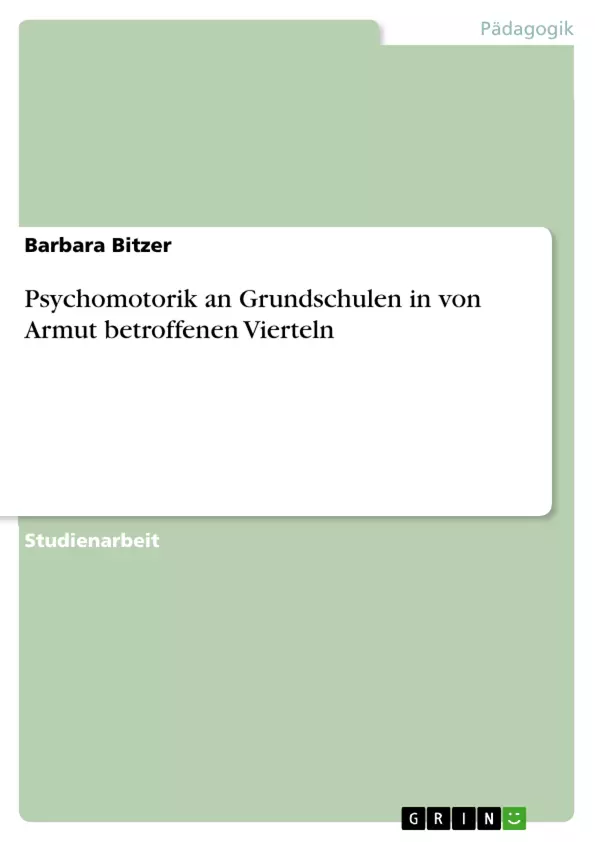Kinder, die aus von Armut betroffenen Familien stammen, werden innerhalb der Familie weniger gefördert, als Kinder aus finanziell gesicherten Familien. Häufig arbeiten beide Elternteile bzw. die Kinder wachsen nur mit einem Elternteil auf, der alleinverdienend ist und daher über wenig Zeitkapazität verfügt. Zudem sind die Eltern(teile) häufig mit eigenen Problemen, wie Existenzängsten beschäftigt, so dass sie weniger aufnahmefähig für die Belange ihrer Kinder sind. Nicht selten machen Eltern(teile) moderne Anschaffungen (z.B. Tablets oder Smartphones), um ihr schlechtes Gewissen zu mildern und zu vermeiden, dass ihre Kinder in eine Außenseiterposition in der Schule geraten, denn oftmals schämen sich diese ob ihrer Armut und wollen diese verheimlichen. Sie vergleichen sich mit den anderen Kindern und kommen sich nicht selten minderwertig vor.
Die technischen Kleingeräte, die uns das Leben leichter machen sollen, sind bereits in den Kinderzimmern angekommen. Auf Tablet und Smartphone können diese spielerisch lernen oder sich anderweitig unterhalten lassen. Es gibt vielfältige und ganz individuelle Möglichkeiten. Dass ein oder andere Kind vergisst darüber schon einmal die Zeit, vor allem wenn die Eltern(teile) arbeiten und kein Auge auf die Nutzung der Kleingeräte haben. Anstatt draußen auf dem Spielplatz zu toben, sitzen die Kinder vor den Bildschirmen. Daraus resultieren nicht selten Haltungsschäden oder physische Probleme wie Übergewicht oder Koordinationsschwierigkeiten. Was vor 20 Jahren noch selbstverständlich war, wie Balancieren oder Schwimmen können, ist es heutzutage nicht mehr.
Die Armutszahlen in Deutschland sind alarmierend. Vor allem Kinder sind die Leidtragenden – sie verfügen noch nicht über die notwendige Resilienz und Reife um damit umgehen zu können, was zu nachhaltigen psychischen Beeinträchtigungen führen kann. Kann man durch niederschwellige Pflichtangebote in der Schule prophylaktisch gegen physische und psychische Probleme vorgehen? Wie sähe so ein Konzept aus? Dies werde ich anhand meiner Arbeit erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Theoretischer Teil
- 1. Grundlagen und Ziele der Psychomotorik
- 2. Bedeutung von Körper- und Bewegungserfahrung für die kindliche Entwicklung
- 3. Psychosoziale Folgen von Kinderarmut
- III. Konzeptioneller Teil
- 1. Institutionelle Rahmenbedingungen
- 2. Situationsanalyse
- 3. Ziele
- 3.1. Selbstbewusstsein stärken
- 3.2. Körperwahrnehmung fördern
- 3.3. Gemeinschaftsgefühl entwickeln
- 4. Methodenauswahl
- 5. Aufbau der Einheit
- 6. Evaluation und Reflexion
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Psychomotorik an Grundschulen in von Armut betroffenen Vierteln. Sie untersucht, wie Psychomotorik dazu beitragen kann, die psychosozialen Folgen von Kinderarmut zu lindern und die kindliche Entwicklung zu fördern. Im Fokus stehen die Stärkung des Selbstbewusstseins, die Förderung der Körperwahrnehmung und die Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls.
- Die Bedeutung von Körper- und Bewegungserfahrung für die kindliche Entwicklung
- Psychosoziale Folgen von Kinderarmut
- Die Rolle der Psychomotorik in der Bildungsarbeit
- Methoden und Konzepte der Psychomotorik
- Evaluation und Reflexion des pädagogischen Ansatzes
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die besonderen Herausforderungen, denen Kinder aus armutsbetroffenen Familien gegenüber stehen. Sie beschreibt die mangelnde Förderung innerhalb der Familie, die Belastung der Eltern mit eigenen Problemen und die damit verbundenen Folgen für die kindliche Entwicklung. Darüber hinaus werden die Auswirkungen des zunehmenden Medienkonsums auf die körperliche Aktivität und Entwicklung von Kindern diskutiert.
II. Theoretischer Teil
1. Grundlagen und Ziele der Psychomotorik
Dieses Kapitel erläutert die Entstehung und die grundlegenden Ziele der Psychomotorik. Es werden die zentralen Konzepte von Ernst J. Kiphard und Helmut Hünnekens vorgestellt, die die Verbindung zwischen Bewegung, Emotionen und Entwicklung herausstellen. Der Fokus liegt auf der spielerischen Förderung von Sinnesschulung, Körper- und Raumwahrnehmung, sowie Selbstbeherrschung.
2. Bedeutung von Körper- und Bewegungserfahrung für die kindliche Entwicklung
Der zweite Teil des theoretischen Kapitels beleuchtet die wichtige Rolle von Körper- und Bewegungserfahrungen für die Entwicklung des Selbstkonzepts, der Selbsterfahrung und der Beziehung zur Umwelt. Es wird die Verbindung zwischen körperlichen Erfahrungen und der Entwicklung der Ich-Kompetenz, der Sach-Kompetenz und der Sozial-Kompetenz herausgestellt. Das Spiel als bedeutender Bestandteil der Psychomotorik wird in diesem Zusammenhang als Mittel der Selbstentwicklung, emotionalen Ausdrucks und der Interaktion mit Gleichaltrigen betrachtet.
3. Psychosoziale Folgen von Kinderarmut
Dieses Kapitel analysiert die psychosozialen Auswirkungen von Kinderarmut auf die Entwicklung von Kindern. Es beleuchtet die Herausforderungen, die mit Armut einhergehen und sich negativ auf die kindliche Entwicklung auswirken können.
Schlüsselwörter
Psychomotorik, Kinderarmut, Entwicklung, Selbstbewusstsein, Körperwahrnehmung, Gemeinschaftsgefühl, Bildungsarbeit, Spiel, Bewegung, Sozial-Kompetenz, Sach-Kompetenz, Ich-Kompetenz, Resilienz, Familienförderung, Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von Psychomotorik in der Grundschule?
Ziel ist die ganzheitliche Förderung der kindlichen Entwicklung durch Bewegung, um das Selbstbewusstsein zu stärken und die Körperwahrnehmung zu verbessern.
Wie wirkt sich Kinderarmut auf die psychosoziale Entwicklung aus?
Armut kann zu Minderwertigkeitsgefühlen, sozialem Rückzug und mangelnder Resilienz führen, oft verstärkt durch fehlende Förderung im Elternhaus.
Warum ist Bewegungserfahrung wichtig für die Ich-Kompetenz?
Durch körperliche Erfolgserlebnisse im Spiel entwickeln Kinder ein positives Selbstkonzept und lernen, ihre eigenen Fähigkeiten besser einzuschätzen.
Welche Rolle spielen Smartphones und Tablets bei Haltungsschäden?
Übermäßiger Medienkonsum führt dazu, dass Kinder weniger draußen toben, was Haltungsschäden, Übergewicht und Koordinationsschwierigkeiten begünstigt.
Was sind die zentralen Konzepte von Ernst J. Kiphard?
Kiphard betonte die untrennbare Verbindung von Bewegung und Emotionen und legte damit das Fundament für die moderne Psychomotorik.
- Quote paper
- Barbara Bitzer (Author), 2017, Psychomotorik an Grundschulen in von Armut betroffenen Vierteln, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/436633