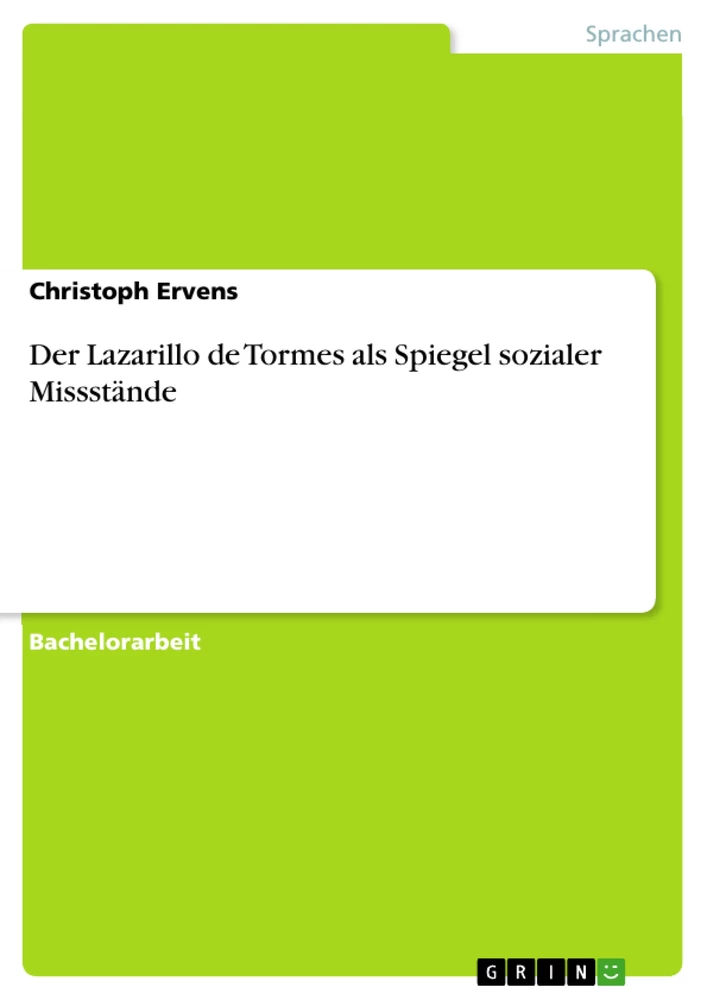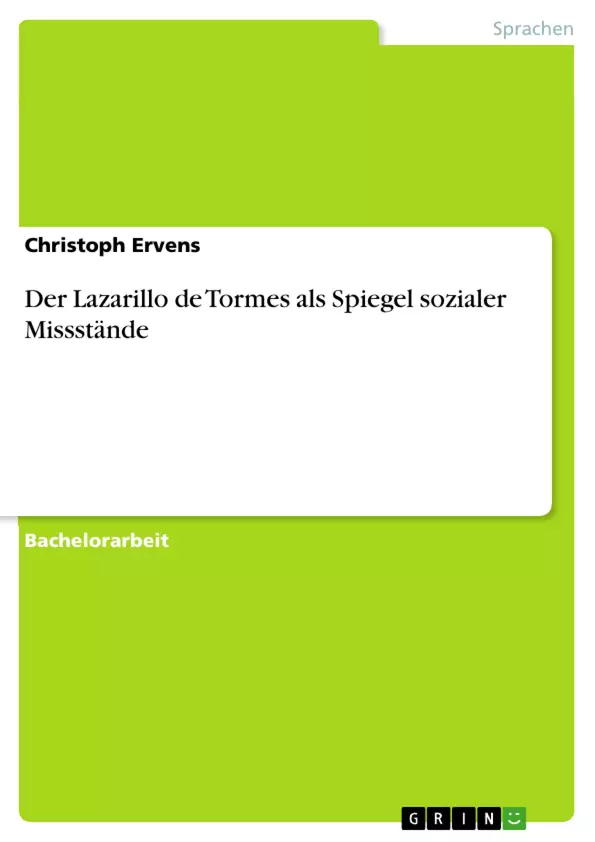Diese Bachelorarbeit behandelt die Lesart des "Lazarillo de Tormes" und analysiert hierzu einerseits den Begriff des ,,Asozialen“, als menschliches Versagen der Romanfiguren, andererseits das sozialverantwortliche Scheitern gesellschaftstragender und moralisch wegweisender Personen(gruppen) und Institutionen wie Kirche und Staat.
Der Vater des Schelmenromans bezieht sich nicht nur auf die Satire der Sitten und Bräuche verschiedener sozialer Klassen oder Stände, beispielsweise der Plebs, als ungebildetes, niedrig und gemein denkendes Volk, der Bourgeoisie, als wohlhabendem Bürgertum, der Aristokratie, als vermeintlicher Herrschaft der Besten oder des Klerus, im Sinne einer bloßen pikaresken Romantradition, die spezifische literarische Parameter für diese Gattung bereits hinreichend definiert hat, beispielsweise den Pícaro als Antiheld, der, aus der Unterschicht stammend, in Form einer fiktiven Autobiographie, seine Lebensbeichte, als Ausgegrenzter, darlegt und sich, unter Rückgriff auf halbkriminelle Bildungsinhalte, im Sinne der Arte del furtar, an die Schlechtigkeit seiner Welt (reaktionär) anpasst.
Vielmehr erfordert der ,,Lazarillo“ eine stärker sozial geprägte Lesart, die soziale und moralische Reflexionen und Wertungen des Protagonisten einschliesst, ab dem Moment, wo Lazaro in der ersten Person einem vermeintlichen Honoratior (Vuestra Merced) detailliert über seinen sozialen Werdegang, d.h seine Dienstverhätnisse bei diversen weltlichen und kirchlichen Herren und seine persönlichen Erfahrungen über die Schlechtigkeit der Welt, berichtet und nebenbei ausführlich Auskunft über eine gewisse moralische Verwerfung, den ,,caso“, geben soll.
Die vom Autor explizit oder implizit dargestellten und mittels der Stimme des nichtigen Pícaros transportierten und angeprangerten sozialen, moralischen und ideologischen Missstände Spaniens, die durch den vorliegenden Schelmenroman, als ein herausragendes Zeitzeugnis für das Siglo Oro, das Licht der Welt erblicken, machen vor nichts und niemandem halt und hinterfragen die Legitimation selbsternannter oder tradierter Eliten dieser Zeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das „Siglo de Oro“ und seine (sozialen) Schattenseiten
- Armut und Hunger im Lazarillo de Tormes als sozialer Missstand
- Sozialstrukturen im „Lazarillo de Tormes“
- Die Begriffe „Asozialität“, „Missstand“ und „Spiegel“
- Der asoziale Escudero
- Der asoziale Kleriker
- Der asoziale „Barmherzige Bruder“
- Der asoziale Ablassverkäufer
- Der asoziale Erzpriester von Sankt Salvador
- Die Asozialität Lázaros, seiner Familie und weiterer Figuren
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem „Lazarillo de Tormes“ und seiner Darstellung sozialer Missstände im Spanien des 16. Jahrhunderts. Ziel ist es, zu analysieren, inwiefern der Roman über eine bloße Satire hinausgeht und die sozialen und moralischen Strukturen der damaligen Zeit kritisch hinterfragt.
- Analyse des Begriffs „Asozialität“ im Kontext der Romanfiguren
- Kritik an der Scheinheiligkeit des Klerus und der Pervertierung christlicher Werte
- Thematisierung der sozialen Missstände wie Hunger, Armut und Ungleichheit
- Untersuchung der Rolle althergebrachter Hierarchien und Standesstrukturen
- Bedeutung des „Siglo de Oro“ und seiner Schattenseiten für die Darstellung sozialer Missstände
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den „Lazarillo de Tormes“ als einen Roman vor, der die sozialen Missstände seiner Zeit aufzeigt und die Moral und das Verhalten verschiedener sozialer Klassen kritisch beleuchtet. Dabei wird die besondere Bedeutung des „caso“ hervorgehoben, der durch den Protagonisten Lázaro geschildert wird.
- Das „Siglo de Oro“ und seine (sozialen) Schattenseiten: Dieses Kapitel beschreibt das Spanien des 16. Jahrhunderts als eine Weltmacht, die ihre Blütezeit erlebte, aber gleichzeitig unter sozialen Problemen wie Hunger, Armut und einem moralischen Vakuum litt. Die Expansion des Kolonialreiches und die damit verbundenen Herausforderungen werden beleuchtet.
- Armut und Hunger im Lazarillo de Tormes als sozialer Missstand: Dieses Kapitel fokussiert auf die konkreten sozialen Missstände, die im „Lazarillo de Tormes“ dargestellt werden, insbesondere Armut und Hunger. Es wird analysiert, wie diese Missstände durch die Handlungen und das Verhalten der verschiedenen Figuren verstärkt werden.
- Sozialstrukturen im „Lazarillo de Tormes“: Dieses Kapitel befasst sich mit den sozialen Strukturen des Spanien des 16. Jahrhunderts und deren Einfluss auf die Handlung des Romans. Die Beziehungen zwischen Diener und Herr, die gescheiterten Bildungs- und Fürsorgeaufgaben der Erziehungsberechtigten und die Scheinheiligkeit des Klerus werden untersucht.
- Die Begriffe „Asozialität“, „Missstand“ und „Spiegel“: In diesem Kapitel werden die genannten Begriffe in Bezug auf die Romanfiguren und die Darstellung der sozialen Missstände im „Lazarillo de Tormes“ definiert. Anhand der Charakterisierung verschiedener Figuren wie des Escuderos, des Klerikers und des „Barmherzigen Bruders“ wird das „asozi-ale“ Verhalten und die moralische Verworfenheit in der Gesellschaft des 16. Jahrhunderts aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Lazarillo de Tormes, Siglo de Oro, soziale Missstände, Asozialität, Scheinheiligkeit, Armut, Hunger, Ungleichheit, Standesstrukturen, Kirche, Staat, Moral, Spanien, 16. Jahrhundert.
- Quote paper
- Christoph Ervens (Author), 2018, Der Lazarillo de Tormes als Spiegel sozialer Missstände, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/436878