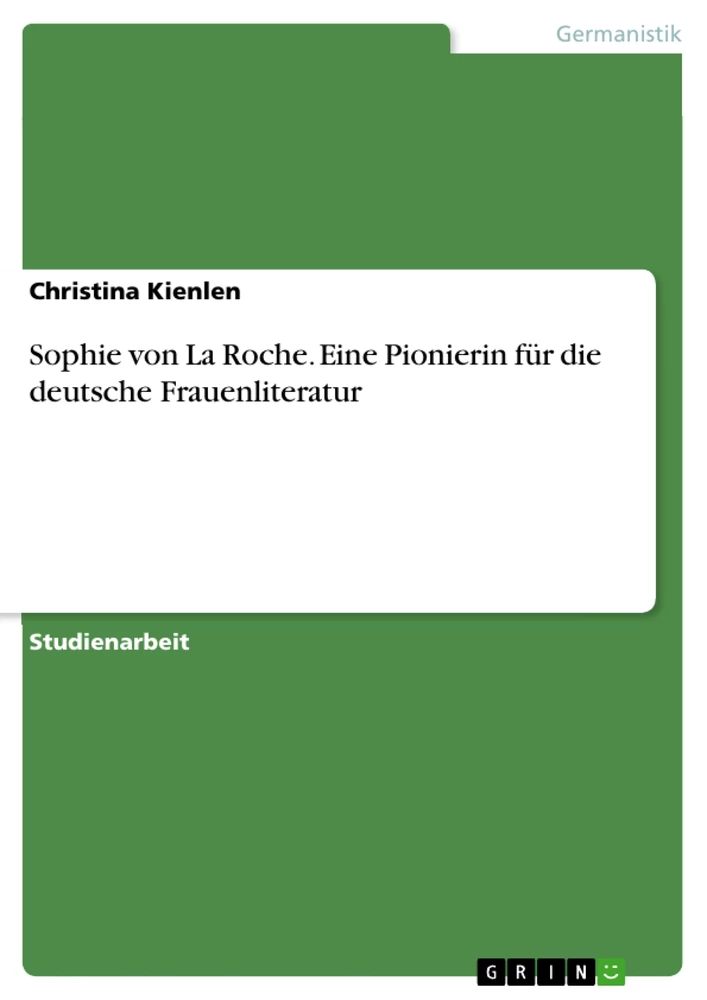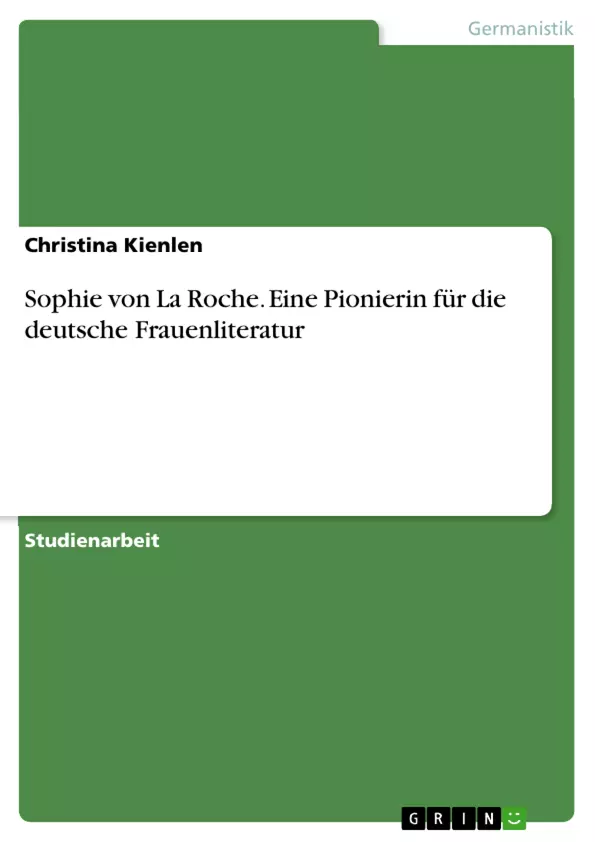Sophie von La Roche war „die erste Deutsche, die einen bürgerlichen Roman schrieb, sie war die erste Frau in Deutschland, die eine Zeitschrift gründete und schrieb. Sie produzierte 35 Jahre lang Romane, Reisebeschreibungen und literarische Schriften für ein überwiegend weibliches Publikum.“ Dieses Zitat macht deutlich, dass Sophie von La Roche eine wichtige Rolle in der literaturwissenschaftlichen Geschichte einnimmt. Sie ist eine der wenigen deutschen Autorinnen, die sich ihren Lebensunterhalt durch das Schreiben verdient hat, was zu diesem Zeitpunkt nicht nur außergewöhnlich war, sondern ihr auch noch Ruhm und Ansehen einbringt.
Doch wie hat es La Roche geschafft, in einer Zeit, die von Männern dominiert wird, hervorzustechen und bekannt zu werden? Hätte jeder Frau dieser Schritt gelingen können oder bringt die La Roche gewisse Voraussetzungen und Grundlagen mit? Spielt ihre Erziehung eine Rolle? Ihre sozialen Kontakte? Der Übertritt vom Bürgertum zum Hof? Was ist das Besondere an ihr, dass gerade sie das erreicht hat? Ist sie wirklich zur Wegbereiterin für viele nachfolgende Generationen geworden?
Diese Fragen sollen in der folgenden Arbeit ausführlich behandelt und beantwortet werden. Zu Beginn werden die Erwartungshaltungen und Grundeinstellungen formuliert, mit denen Frauen im 18. Jahrhundert konfrontiert wurden. Anschließend folgt die ausführliche Auseinandersetzung mit Sophie von La Roche: ihre Kindheit, ihr Leben mit Georg de La Roche, ihre Verbundenheit mit Wieland und ihre weitreichenden sozialen Kontakte. Danach werden einige ihre literarischen Werke als exemplarische Beispiele Beachtung finden, um abschließend die eingangs gestellte Frage umfassend klären zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Frauenbild des 18. Jahrhunderts
- Das bürgerliche Frauenbild
- Das höfische Frauenbild
- Sophie von La Roche- ihr Weg in die Autorschaft
- Biografie
- Kindheit und Jugend
- Christoph Martin Wieland
- Georg Michael Franck de La Roche
- Werke
- Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim
- Rosaliens Briefe an ihre Freundin Mariane von St**
- Pomona für Teutschlands Töchter
- Biografie
- Sophie von La Roche- eine Pionierin für deutsche Frauenliteratur?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Bedeutung Sophie von La Roches für die deutsche Frauenliteratur des 18. Jahrhunderts. Sie beleuchtet ihre Biografie, ihre literarischen Werke und ihre Rolle als Wegbereiterin für nachfolgende Generationen von Autorinnen. Die Arbeit zielt darauf ab, La Roches einzigartige Position im literarischen Kontext ihrer Zeit zu verstehen und die Faktoren zu analysieren, die ihren Erfolg ermöglichten.
- Das Frauenbild des 18. Jahrhunderts im bürgerlichen und höfischen Kontext
- Sophie von La Roches Biografie und ihre sozialen Kontakte
- Analyse ausgewählter Werke von Sophie von La Roche
- Die Rolle Sophie von La Roches als Pionierin für die deutsche Frauenliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Sophie von La Roche als eine bedeutende deutsche Autorin des 18. Jahrhunderts vor und hebt ihre Leistungen im Bereich des Schreibens hervor. Es werden Fragen aufgeworfen, die im Laufe der Arbeit untersucht werden, wie beispielsweise die Rolle der Erziehung, der sozialen Kontakte und des Übergangs vom Bürgertum zum Hof in La Roches Erfolgsgeschichte.
Das Frauenbild des 18. Jahrhunderts
Dieser Abschnitt beleuchtet die gesellschaftlichen Erwartungen, Rechte und Pflichten von Frauen im 18. Jahrhundert. Es werden sowohl das bürgerliche als auch das höfische Frauenbild detailliert betrachtet.
Sophie von La Roche- ihr Weg in die Autorschaft
Dieser Abschnitt befasst sich mit La Roches Biografie, beginnend mit ihrer Kindheit und Jugend, ihren Beziehungen zu Christoph Martin Wieland und Georg Michael Franck de La Roche, sowie ihrem Werdegang als Autorin.
Sophie von La Roche- eine Pionierin für deutsche Frauenliteratur?
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der vorangegangenen Analysen zusammengefasst und die Frage nach La Roches Rolle als Wegbereiterin für die deutsche Frauenliteratur kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Sophie von La Roche, einer bedeutenden deutschen Autorin des 18. Jahrhunderts. Die Schlüsselthemen sind das Frauenbild der Zeit, La Roches Biografie und ihre literarischen Werke, sowie ihre Rolle als Pionierin für die deutsche Frauenliteratur. Weitere wichtige Begriffe sind Bürgertum, Hofkultur, Bildung, Autorschaft, Frauenrechte, Emanzipation, und die Analyse ausgewählter Werke wie "Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim".
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt Sophie von La Roche als Pionierin der Frauenliteratur?
Sie schrieb den ersten deutschen bürgerlichen Roman einer Frau und gründete als erste Frau in Deutschland eine eigene Zeitschrift.
Was ist ihr bekanntestes Werk?
Ihr bekanntestes Werk ist der Roman „Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim“, der ein überwiegend weibliches Publikum ansprach.
Welche Rolle spielten Wieland und ihr Ehemann in ihrem Leben?
Christoph Martin Wieland war ihr eng verbunden, und ihr Ehemann Georg Michael Franck de La Roche unterstützte ihren Weg in die Autorschaft und den höfischen Kontext.
Wie war das Frauenbild im 18. Jahrhundert geprägt?
Es gab eine starke Trennung zwischen dem bürgerlichen und dem höfischen Frauenbild, wobei Frauen generell wenig Rechte auf Bildung oder eigenständige Erwerbsarbeit hatten.
Was war die Zeitschrift „Pomona für Teutschlands Töchter“?
Es war die von Sophie von La Roche gegründete und geschriebene Zeitschrift, die speziell auf die Bildung und Unterhaltung von Frauen ausgerichtet war.
- Citation du texte
- Christina Kienlen (Auteur), 2015, Sophie von La Roche. Eine Pionierin für die deutsche Frauenliteratur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437046