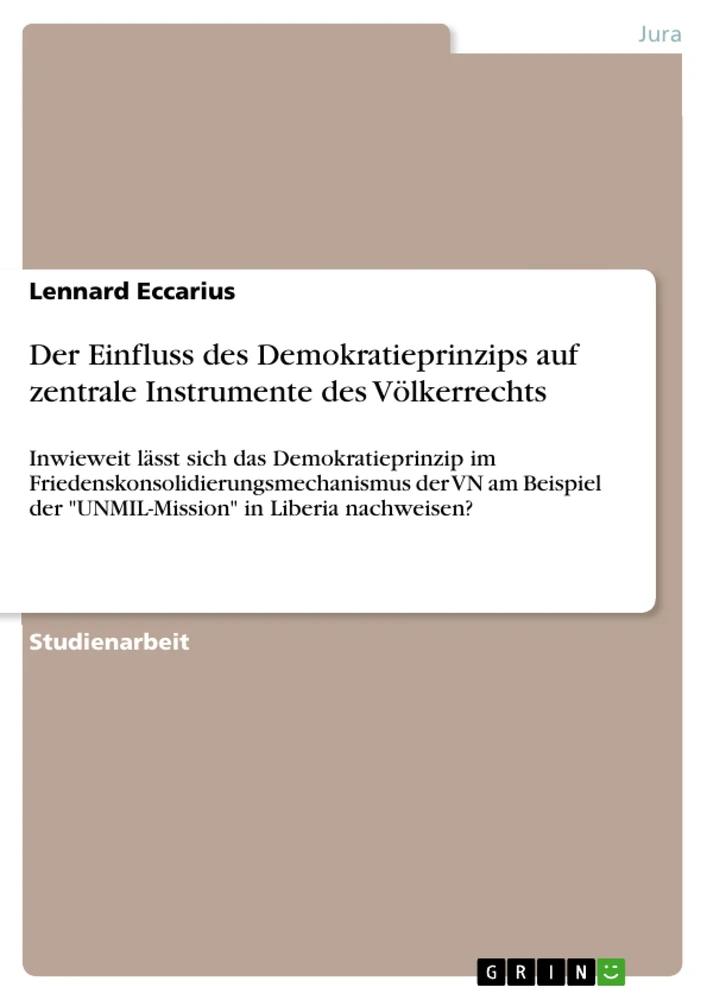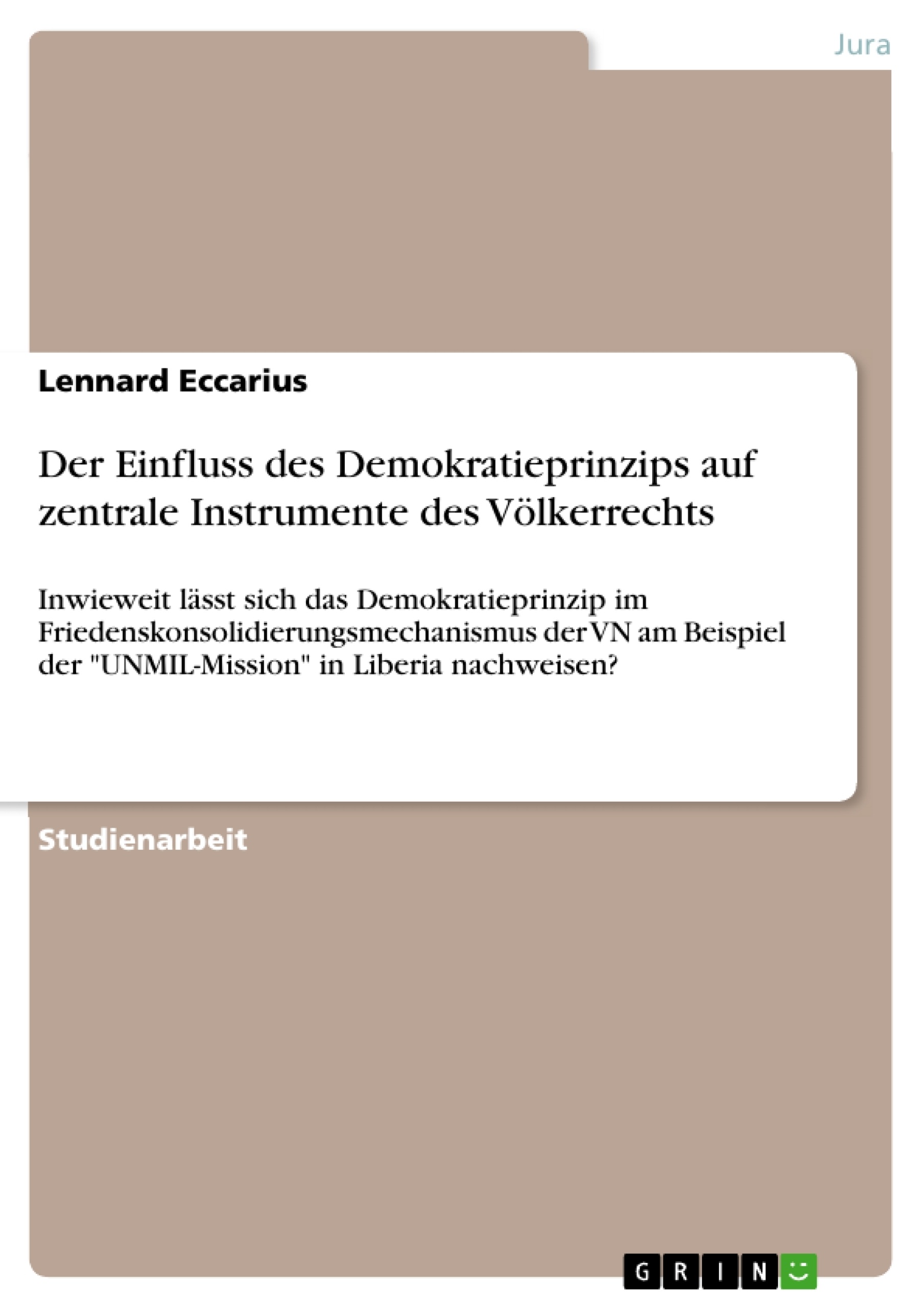Das Auftauchen und die Entstehung von konzeptualisierten Ideen, die den Begriff der Demokratie in die Keimzelle des völkerrechtlichen Normenkörpers zu tragen versuchen und damit ein Kontradiktionsverhältnis zum etablierten und reziprok anerkannten Prinzip der staatlichen Souveränität begründen, muss vor dem Hintergrund der sich nach dem Ende des Ost-West-Konflikts veränderten Weltlage betrachtet werden, um diese für das Völkerrecht mittlerweile typische Diskussion nachzuvollziehen.
Für den Politikwissenschaftler Francis Fukuyama endet die prägende historische Geschichte der 20. Jahrhunderts mit dem Sieg der marktwirtschaftlichen, liberalen Demokratie über den kommunistischen Totalitarismus. Der vermeintliche Systemsieg demokratischer Prinzipien und die zunehmende Abhaltung von allgemeinen Wahlen in immer mehr Staaten, vermittelten das Bild „{...} of an almost irresistible globla tide moving on from one triumph to the next.“ Unter der Veränderung dieser skizzierten Ausgangssituation lässt sich auch der von Boutros-Ghali postulierte Zusammenhang im Eingangszitat dieser Arbeit lesen, der in Abwendung von formalen Strukturelementen des Völkerrechts interpretationsoffene Begriffe wie „democracy“ oder „rule of law“ akzentuiert. Die Konstruktion eines völkerrechtlich begründbaren Rechts auf Demokratie stößt dabei gerade wegen der fehlenden Rechtspraxis und der Beliebigkeit in der praktischen Anwendung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf begründete Kritik.
Neben diesen Implikationen für die Reichweite und zukünftige Weiterentwicklung des VR (Völkerrechts) addierte sich auch die einfache und zugleich euphorische Gleichung, nach der die VN durch Beendigung der durch den Kalten Krieg bedingten Blockade nun ihre volle Leistungsfähigkeit ausschöpfen könne, um im Sinne der Wahrung und Sicherung des Friedens tätig zu werden. Gerade für den Afrikanischen Kontinent bedeutete und begünstigte das Aufbrechen der Blockkonfrontation und das damit einhergehende rückläufige sicherheitspolitische Engagement der Großmächte, das Entstehen eines Sicherheitsvakuums, welches sich zunehmend entlud und die Rolle der UN als „peacebuilder“ auf die Probe stellte. Neben der Veränderung auf der systemischen Ebene avancieren in besonderer Weise die veränderte Struktur von Konflikten und die damit einhergehenden Instrumente und Strategien die es bedarf, um diesen gerecht zu werden, zum zentralen Aspekt der Friedenssicherungsbemühungen der VN.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Demokratie und Völkerrecht- Eine Annäherung durch das Ende der Geschichte ?
- 2. Erosion des klassischen Souveränitätsprinzips und Entwicklung eines völkerrechtlichen Demokratieverständnisses
- 2.1. Genese eines völkerrechtlichen Demokratiebegriffs
- 3. Der Friedenskonsolidierungsmechanismus der Vereinten Nationen
- 3.1. Allgemeine Zielsetzungen
- 3.2. Instrumente und Akteure der VN-Friedenskonsolidierung
- 4. Liberia und die UNMIL- Demokratische Friedenskonsolidierung in der Praxis?
- 4.1. Ausgangslage des Konflikts
- 4.2. völkerrechtliches Demokratieprinzip als Handlungsgrundlage für die UNMIL?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht den Einfluss des Demokratieprinzips auf zentrale Instrumente des Völkerrechts. Anhand des Beispiels der UNMIL-Mission in Liberia wird analysiert, inwieweit sich das Demokratieprinzip im Friedenskonsolidierungsmechanismus der Vereinten Nationen nachweisen lässt.
- Erosion des klassischen Souveränitätsprinzips und Entwicklung eines völkerrechtlichen Demokratieverständnisses
- Der Friedenskonsolidierungsmechanismus der Vereinten Nationen
- Die Rolle des Demokratieprinzips in der UNMIL-Mission in Liberia
- Rechtliche Begründungen und Herausforderungen bei der Anwendung des Demokratieprinzips im Völkerrecht
- Kritik und Würdigung der Rolle des Demokratieprinzips in der Friedenskonsolidierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des völkerrechtlichen Demokratieverständnisses im Kontext des Wandels der Weltlage nach dem Ende des Kalten Krieges. Kapitel zwei untersucht die Erosion des klassischen Souveränitätsprinzips und die Genese eines völkerrechtlichen Demokratiebegriffs. Kapitel drei fokussiert auf den Friedenskonsolidierungsmechanismus der Vereinten Nationen, einschließlich seiner allgemeinen Zielsetzungen und Instrumente. Kapitel vier analysiert die UNMIL-Mission in Liberia und die praktische Umsetzung des Demokratieprinzips im Kontext des dortigen Konflikts.
Schlüsselwörter
Demokratieprinzip, Völkerrecht, Friedenskonsolidierung, Vereinte Nationen, UNMIL-Mission, Liberia, Souveränitätsprinzip, Selbstbestimmungsrecht, Rechtsstaatlichkeit, Friedensförderung.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst das Demokratieprinzip das moderne Völkerrecht?
Das Demokratieprinzip fordert das klassische Souveränitätsprinzip heraus, indem es versucht, demokratische Standards als Teil des völkerrechtlichen Normenkörpers zu etablieren.
Was ist der Friedenskonsolidierungsmechanismus der UN?
Es handelt sich um Instrumente und Strategien der Vereinten Nationen, um nach Konflikten dauerhaften Frieden zu sichern, oft durch den Aufbau demokratischer Strukturen.
Was wurde in der UNMIL-Mission in Liberia untersucht?
Die Arbeit analysiert am Beispiel Liberias, inwieweit das völkerrechtliche Demokratieprinzip als praktische Handlungsgrundlage für Friedensmissionen dient.
Warum wird ein "völkerrechtliches Recht auf Demokratie" kritisiert?
Kritiker bemängeln die fehlende einheitliche Rechtspraxis sowie die Beliebigkeit und politische Instrumentalisierung der Begriffe Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
Welchen Einfluss hatte das Ende des Kalten Krieges auf diese Debatte?
Das Ende der Blockkonfrontation ermöglichte es den UN, aktiver als "Peacebuilder" aufzutreten und Konzepte wie "Rule of Law" stärker zu gewichten.
- Citar trabajo
- Lennard Eccarius (Autor), 2018, Der Einfluss des Demokratieprinzips auf zentrale Instrumente des Völkerrechts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437097