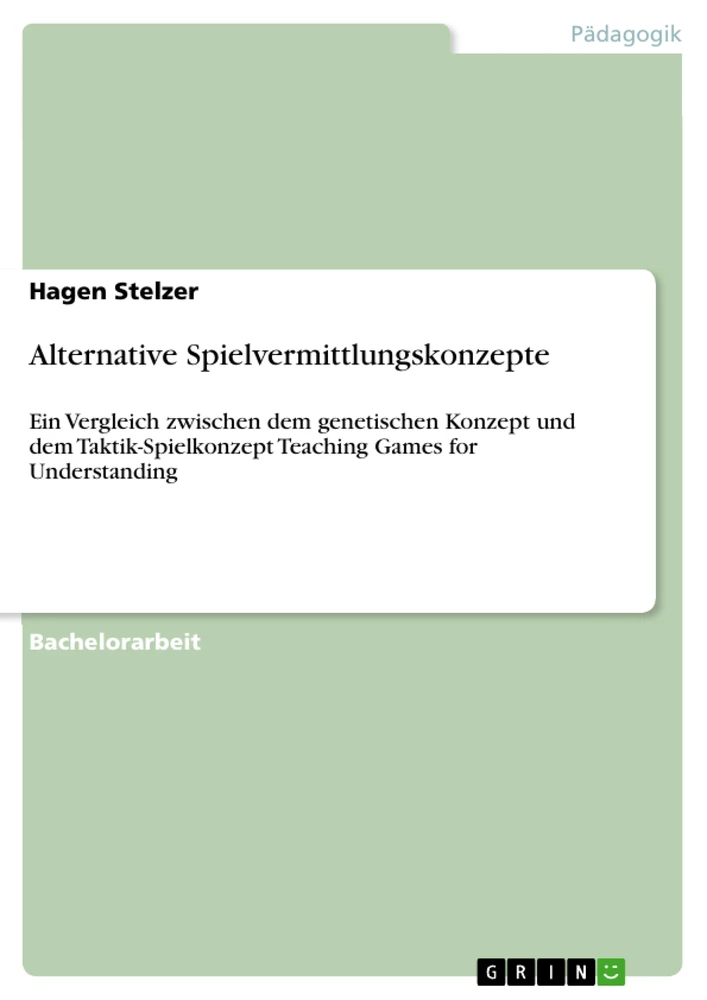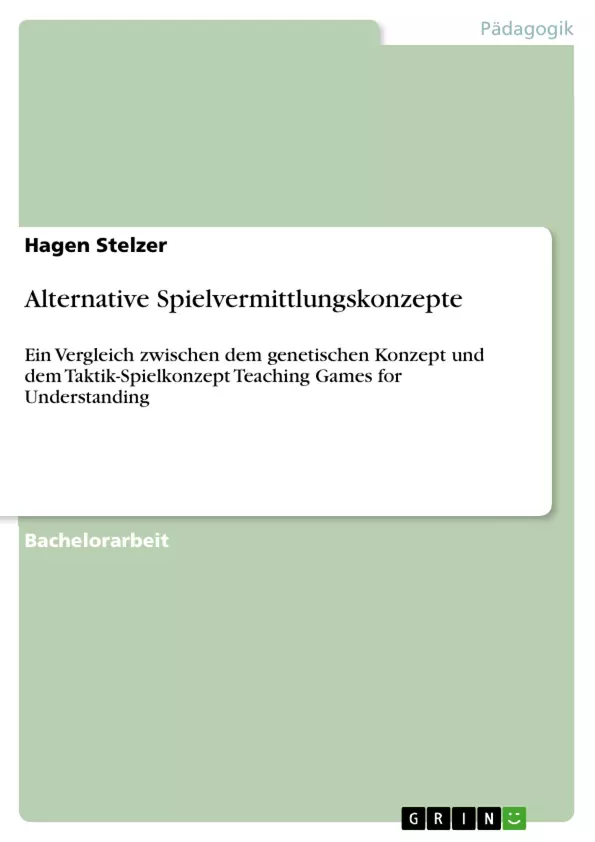Bei der Vermittlung von Sportspielen beabsichtigen alle Vermittlungskonzepte, Spielfähigkeiten seitens der Lernenden zu entwickeln. Dabei liegt den Konzepten die Auffassung zugrunde, dass die Lernenden mit komplexen Anforderungen des Spiels konfrontiert werden sollen. Um einer möglichen Überforderung entgegenzuwirken, vereinfachen die Lehrenden die Spielanforderungen, damit die Lernenden ihrem individuellen Entwicklungsniveau entsprechend einbezogen werden können. Laut Bietz „entwickeln sie spezifische methodische Reduktionsformen, die das Erlernen der komplexen Handlungsmuster erleichtern sollen“ (vgl. Bietz, 1994). Als Reduktionsformen können vereinfachte Spielformen erstellt werden. Die methodische Struktur des Lehrwegs hängt davon ab, welche Spielfähigkeiten die Vermittlungskonzepte verfolgen.
Während manche Konzepte die zu erlernenden Techniken des Spiels in isolierten Übungen anbieten, wendet sich das Genetische Konzept und das Taktik-Spielkonzept Teaching Games for Understanding, davon ab.
Im Nachfolgenden richtet sich diese Arbeit an die folgende Fragestellung: Worin unterscheidet sich das genetische Konzept vom Taktik-Spielkonzept Teaching Games for Understanding?
Zu Beginn des Hauptteils wird der Begriff Sportspielvermittlung dargestellt und definiert. Darauf aufbauend werden die ausgewählten Konzepte in den Gesamtzusammenhang der herkömmlichen Vermittlungskonzepte eingeordnet. Das zweite Kapitel schließt damit ab, den Grundgedanken beider Konzepte zu erläutern und Kriterien der Sportspielvermittlung aufzustellen. Die aufgestellten Kriterien dienen als Grundlage für den Vergleich der beiden Konzepte.
Anschließend werden im dritten und vierten Kapitel das genetische Konzept und das TGfU-Konzept ausführlich vorgestellt. Dabei beziehen sich beide Kapitel auf die Struktur, die Intention und den Vermittlungsweg. Im fünften Kapitel werden beide Konzepte unter Berücksichtigung der aufgestellten Kriterien verglichen. Hierbei wird zunächst das jeweilige Kriterium innerhalb der Konzepte verdeutlicht. Danach werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgestellt. Im Fazit werden die bedeutendsten Unterschiede aufgegriffen, um die ausgehende Fragestellung zu beantworten. Ein kurzer Ausblick, der auf die mögliche Anwendbarkeit im schulischen Kontext hinweist, wird diese Arbeit abschließen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einordnung der ausgewählten Spielvermittlungskonzepte
- Begriffsbestimmung der Spielvermittlung
- Grundgedanke des genetischen Konzepts und Taktik-Spielkonzepts
- Kriterien der Spielvermittlung
- Das genetische Vermittlungskonzept
- Genetisches Lehren
- Allgemeine Spielfähigkeit
- Spezielle Spielfähigkeit
- Vermittlungsweg des genetischen Konzepts
- Strukturmodell des genetischen Lehrens
- Genetisches Lernen
- Problemorientiertes Lernen
- Aus historischen Spielformen lernen
- Kritik am genetischen Vermittlungskonzept
- Vom genetischen Vermittlungskonzept zum Taktik-Spielkonzept
- Das Taktik-Spielkonzept Teaching Games for Understanding
- Das Kreis-Spiral-Modell des TGfU-Konzeptes
- Ziele und Beiträge zur Spielfähigkeit
- Sportspielübergreifende Spielfähigkeit
- Sportspielgerichtete Spielfähigkeit
- Sportspielspezifische Spielfähigkeit
- Taktik-Analyse
- Genetisches Konzept vs. Teaching Games for Understanding
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die Unterschiede zwischen dem genetischen Konzept und dem Taktik-Spielkonzept Teaching Games for Understanding (TGfU) in der Vermittlung von Sportspielen zu beleuchten. Beide Konzepte verfolgen das Ziel, Spielfähigkeiten bei Lernenden zu entwickeln, jedoch setzen sie dabei unterschiedliche Schwerpunkte und Methoden ein.
- Begriffsbestimmung und Einordnung der Spielvermittlungskonzepte
- Vermittlungswege und Strukturmodelle des genetischen Konzepts und TGfU
- Kriterien der Spielvermittlung und deren Anwendung in den beiden Konzepten
- Vergleich der beiden Konzepte hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen
- Bedeutung der Konzepte für die Praxis der Sportspielvermittlung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition des Begriffs Spielvermittlung und einer Einordnung der beiden ausgewählten Konzepte in den Gesamtzusammenhang der Sportspielvermittlung. Im Anschluss werden das genetische Konzept und das TGfU-Konzept in ihren Grundzügen erläutert und anhand verschiedener Kriterien verglichen. Die Kapitel fokussieren auf die Struktur, Intention und den Vermittlungsweg der beiden Konzepte, um einen umfassenden Vergleich zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Sportspielvermittlung, genetisches Konzept, Teaching Games for Understanding (TGfU), Spielfähigkeit, Vermittlungswege, Strukturmodelle, Kriterien, Vergleich, Praxisrelevanz.
- Citation du texte
- Hagen Stelzer (Auteur), 2018, Alternative Spielvermittlungskonzepte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437119