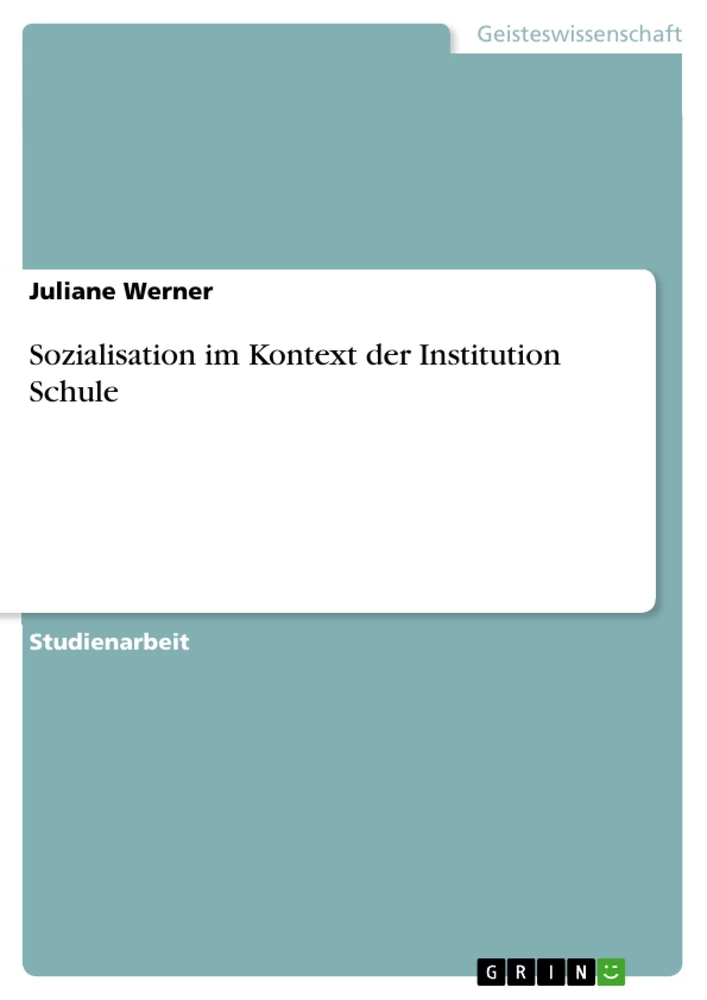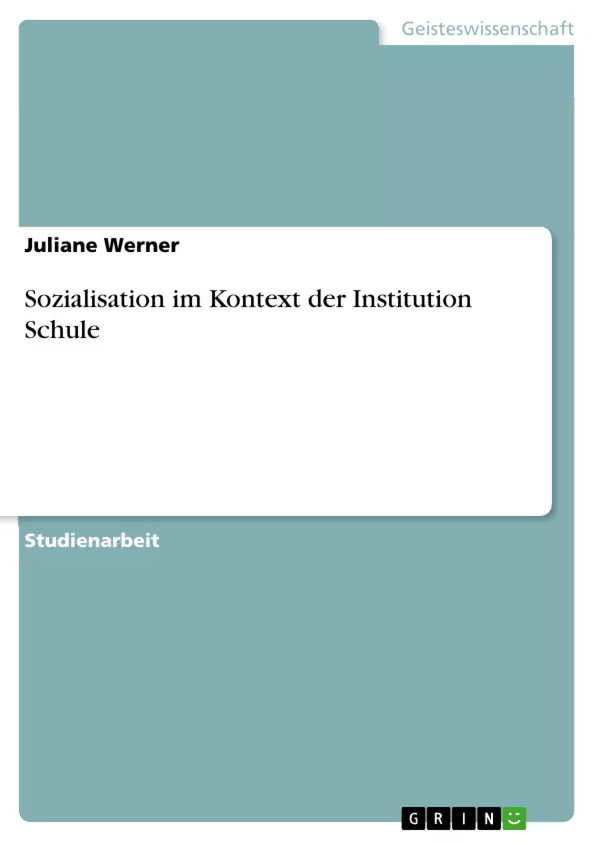„Leben nach eigenen Gesetzen. Das ist das Recht des Kleinkindes auf freie Entfaltung, ohne äußere Autorität in seelischen und körperliche Dingen.“
Neill bezieht sich in diesem Zitat auf das Recht nach Autonomie und Freiheit des Kindes in dem, wie es sich entwickelt, was es tun und denken möchte. Der Begründer der Schule Summerhill und deren „Pädagogik vom Kinde aus“ erkannte zunächst jedoch, dass wahrscheinlich noch niemand ein völlig autonomes Kind gesehen hat, da jedes Kind der Erziehung seiner Eltern, seiner Lehrer und der Gesellschaft unterstehen würde. Ein völlig freie Entfaltung scheint dementsprechend fast nicht möglich zu sein, da das Individuum in seiner Entwicklung durch Erziehungs- und Sozialisationsprozesse beeinflusst wird. Man kann Sozialisation, als einen Prozess der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit verstehen, der in wechselseitiger Abhängigkeit mit der gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen Umwelt steht. Dabei befasst sich die Sozialisation vor allem damit, wie der Mensch sich zu einem gesellschaftsfähigen Subjekt entwickelt mit Hinblick auf die Gesamtheit aller Umweltbedingungen, die auf die Persönlichkeitsentwicklung Einfluss haben.
In dieser Arbeit konzentriere ich mich jedoch primär auf die Auswirkungen der Sozialisation in der Schule in Bezug auf deren Bedeutung für die gesellschaftliche Ebene und auf deren Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung des Individuums. Im Anschluss gehe ich auf Problematiken ein, die sich im Kontext der schulischen Sozialisationsprozesse ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Schulische Sozialisation und ihre Bedeutung für die Gesellschaft
- Schulische Sozialisation und ihre Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung
- Problematiken im schulischen Sozialisationsprozess
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Sozialisation in der Schule, wobei der Fokus auf der Bedeutung der Schule für die Gesellschaft und die Persönlichkeitsentwicklung des Individuums liegt. Die Arbeit beleuchtet die Problematiken, die im Kontext der schulischen Sozialisationsprozesse auftreten.
- Die Rolle der Schule als stabilisierendes Element im gesellschaftlichen System
- Die Funktion der Schule in der Selektion und Integration von Individuen in die Gesellschaft
- Die Bedeutung der schulischen Sozialisation für die Identitätsbildung und Persönlichkeitsentwicklung
- Die Bedeutung der Interaktion zwischen Schülern und Lehrpersonal für die Identitätsentwicklung
- Problematiken im schulischen Sozialisationsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort
Das Vorwort setzt den Fokus auf das Recht des Kindes auf freie Entfaltung und stellt die Begrenztheit dieses Rechtes durch Erziehung und Sozialisationsprozesse heraus. Es definiert den Begriff der Sozialisation als einen Prozess, der die Entwicklung der Persönlichkeit in Abhängigkeit von der gesellschaftlichen Umwelt beeinflusst.
Schulische Sozialisation und ihre Bedeutung für die Gesellschaft
Dieser Abschnitt untersucht die Bedeutung der schulischen Sozialisation aus der Perspektive des strukturfunktionalen Ansatzes. Er beleuchtet die Rolle der Schule als stabilisierendes Element im gesellschaftlichen System, ihre Funktion in der Selektion und Integration von Individuen sowie ihre Bedeutung für die Ausbildung von Arbeitskräften.
Schulische Sozialisation und ihre Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung
Dieses Kapitel befasst sich mit dem interaktionistischen Ansatz und der Bedeutung der schulischen Kommunikationsprozesse für die Identitätsbildung und Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Es beleuchtet die Interaktion zwischen Schülern und Lehrpersonal als wichtigen Faktor in der Identitätsentwicklung.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit umfassen: schulische Sozialisation, Gesellschaft, Persönlichkeitsentwicklung, Identitätsbildung, Interaktion, strukturfunktionaler Ansatz, interaktionistischer Ansatz, Selektion, Integration, Rollenhandeln, Arbeitskräfte, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Sozialisation im schulischen Kontext definiert?
Sozialisation in der Schule ist der Prozess der Persönlichkeitsentwicklung des Individuums in wechselseitiger Abhängigkeit mit der sozialen Umwelt der Bildungsinstitution.
Welche gesellschaftliche Bedeutung hat die schulische Sozialisation?
Aus strukturfunktionaler Sicht stabilisiert die Schule das gesellschaftliche System, indem sie Individuen selektiert, integriert und für den Arbeitsmarkt qualifiziert.
Wie beeinflusst die Schule die Identitätsbildung?
Durch Interaktion mit Lehrkräften und Mitschülern lernen Kinder, soziale Rollen zu übernehmen und ein Selbstbild im Vergleich zu anderen zu entwickeln (interaktionistischer Ansatz).
Was ist die "Pädagogik vom Kinde aus"?
Dieser Ansatz, bekannt durch Schulen wie Summerhill, betont das Recht des Kindes auf Autonomie und freie Entfaltung ohne ständige äußere Autorität.
Welche Problematiken treten bei der schulischen Sozialisation auf?
Problematisch sind oft der Selektionsdruck, die Einschränkung der individuellen Freiheit durch starre Normen und die Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungssystem.
- Quote paper
- Juliane Werner (Author), 2009, Sozialisation im Kontext der Institution Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437214