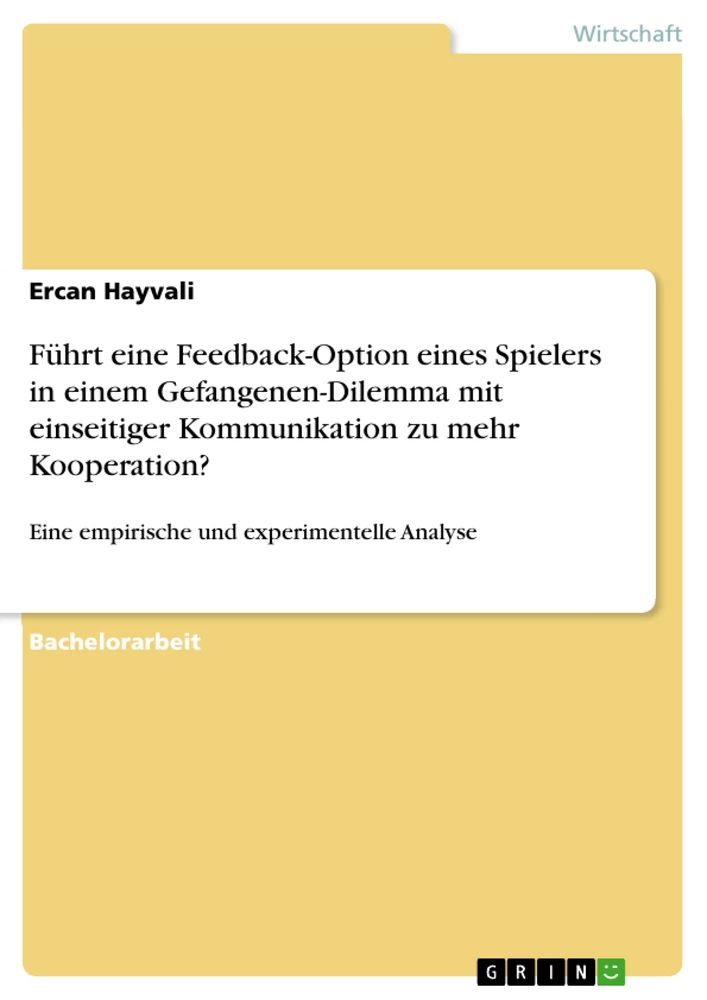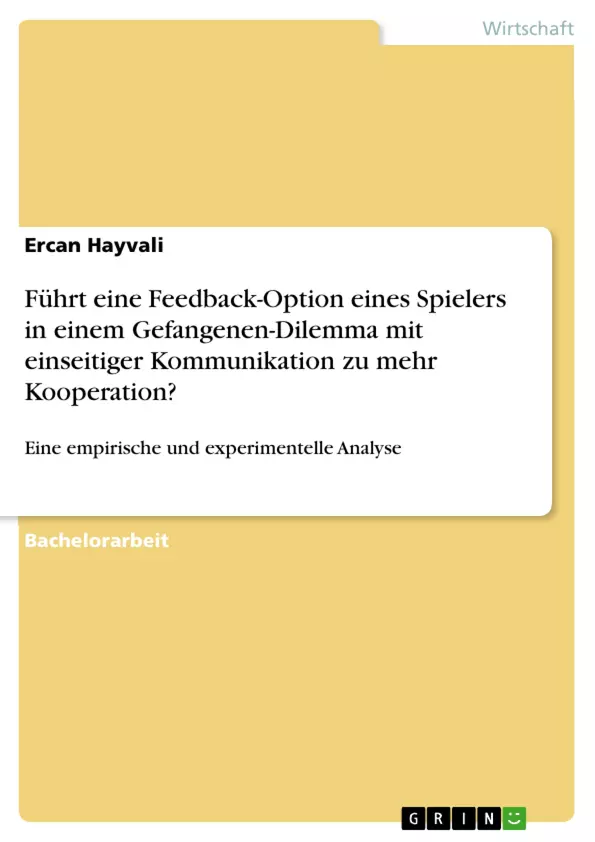„Perfect rationality, like perfect anything, is a fiction“. Das Konstrukt des Gefangenen-Dilemmas übt seit über einem halben Jahrhundert eine Faszination auf Wissenschaftler und Spieltheoretiker aus. Dabei geht es um ein Zwei-Personen-Nicht-Nullsummenspiel, bei dem das Nash-Gleichgewicht in dominanten Strategien zu einem ineffektiven Ergebnis führt. Die individuelle Rationalität gemäß des Rational-Choice-Ansatzes führt zum kollektiv schlechtesten Ergebnis. Empirische Befunde zeigen jedoch, dass sich Probanden sowohl für die prophezeite Strategie „Defektion“ als auch für die Strategie „Kooperation“ entscheiden.
Die bereits bestehende Kooperationsrate kann auch durch Einführung von Kommunikation deutlich erhöht werden. Dabei ist der Einfluss je nach Kommunikationsform unterschiedlich hoch; Untersuchungen belegen, dass verbale Kommunikation die Kooperation stärker erhöht als Kommunikation durch Schriftverkehr. Diese Art des Nachrichtenaustauschs ist für die Spieler nicht bindend und hat keinen direkten Einfluss auf die Auszahlung. Die ökonomische Theorie bezeichnet derartige Kommunikation als „Cheap talk“ und unterstellt, dass solche Nachrichten keinen Informationsgehalt und somit auch keinerlei Einfluss auf das Verhalten von Personen haben.
Jedoch konnte die Empirie auch hier aufzeigen, dass einseitige Kommunikation dennoch einen positiven Einfluss auf die Kooperationsrate ausübt.
Letztere Ausführungen stoßen in Forschungskreisen auf besonderes Interesse, da dort Einflüsse untersucht werden, die eine Steigerung der Kooperation in einem Gefangenen-Dilemma zur Folge haben können. Bei einer groben Betrachtung bisheriger Forschungsansätze stellt man jedoch fest, dass diese Untersuchungen überwiegend die Einflussfaktoren betrachteten, die entweder unmittelbar vor (Pre-Play Communication) oder während des Gefangenen-Dilemma-Spiels (Kommunikation) einen Einfluss auf die Kooperationsrate ausüben können. Doch welchen Einfluss können ex post Einflussfaktoren auf das Verhalten von Probanden haben? Inwieweit wird also das Verhalten eines Spielers in der konkreten Spielsituation beeinflusst, wenn nach der Strategieentscheidung der Gegenspieler konkret darauf reagieren und dieses Verhalten kommentieren kann? Führt eine Feedback-Option eines Spielers in einem Gefangenen-Dilemma mit einseitiger Kommunikation zu mehr Kooperation?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Gefangenen-Dilemma
- Systematik des Gefangenen-Dilemmas
- Die Dilemma-Problematik
- Kommunikation
- Cheap talk
- Systematik und Empirie
- Problematik des Cheap talk
- Einfluss auf Kommunikation und Vertrauen
- Feedback-Option
- Studie von Xiao und Houser
- Studie von Ellingsen und Johannesson
- Einfluss auf die Kooperation
- Design
- Auswertung
- Hypothesen hinsichtlich soziodemographischer Merkmale
- Hypothesen hinsichtlich der gemessenen Gemütszustände
- Hypothesen hinsichtlich des Einflusses persönlicher Merkmale
- Hypothesen hinsichtlich des Einflusses der Feedback-Option
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht, ob eine Feedback-Option in einem einseitigen Kommunikationsspiel mit Gefangenen-Dilemma zu einer Steigerung der Kooperationsrate führt. Im Zentrum der Analyse steht die Forschungslücke, dass bisherige Studien zur Wirkung von Feedback vorwiegend andere Spielformen wie Ultimatum- und Diktatorspiele zum Gegenstand hatten. Das Experiment baut auf den „Cheap talk“-Ansätzen von Cooper et al. (1989) und den empirischen Studien von Ellingsen und Johannesson (2008) sowie Xiao und Houser (2005) zu Feedback-Optionen auf.
- Einfluss von Feedback-Optionen auf die Kooperation im Gefangenen-Dilemma
- Untersuchung des „Cheap talk“-Konzepts und seiner empirischen Validität
- Analyse der Auswirkungen von einseitiger Kommunikation auf das Spielverhalten
- Bewertung der Relevanz von soziodemographischen Merkmalen und Gemütszuständen für die Strategiewahl
- Empirische Überprüfung der Wirkung von Feedback-Optionen auf das Verhalten von Probanden
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Gefangenen-Dilemma als ein Zwei-Personen-Nicht-Nullsummenspiel vor, in dem das Nash-Gleichgewicht zu einem ineffektiven Ergebnis führt. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Einflüsse von Kommunikation auf die Kooperationsrate und stellt die Forschungsfrage nach der Wirkung einer Feedback-Option auf das Spielverhalten.
- Das Gefangenen-Dilemma: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Einführung in das Gefangenen-Dilemma, beschreibt seine Systematik, die Dilemma-Problematik und den Einfluss von Kommunikation auf die Spielergebnisse. Es werden empirische Befunde zur Kooperationsrate und die verschiedenen Kommunikationsformen beleuchtet.
- Cheap talk: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der „Cheap talk“-Kommunikation, die für die Spieler nicht bindend ist und keinen direkten Einfluss auf die Auszahlung hat. Es werden die Diskrepanz zwischen ökonomischer Theorie und empirischen Befunden sowie die Abgrenzung von Vertrauen zu Cheap talk dargestellt.
- Feedback-Option: Dieses Kapitel führt in die Idee der Feedback-Option ein und zeigt durch Theorien auf, warum Menschen eine Aversion gegen egoistische Entscheidungen entwickeln können. Es werden die Experimente von Xiao und Houser (2005) und Ellingsen und Johannesson (2008) vorgestellt, die die Auswirkungen einer Feedback-Option in Ultimatum- und Diktatorspielen untersuchten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf das Gefangenen-Dilemma, einseitige Kommunikation, „Cheap talk“, Feedback-Option, Kooperation, empirische Analyse, experimentelles Design, Strategiewahl, soziodemographische Merkmale, Gemütszustände, Vertrauen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Gefangenen-Dilemma?
Es ist ein spieltheoretisches Modell, bei dem individuelles rationales Handeln (Defektion) zu einem kollektiv schlechteren Ergebnis führt als gegenseitige Kooperation.
Was versteht man unter „Cheap talk“ in der Spieltheorie?
Cheap talk bezeichnet eine nicht bindende Kommunikation vor dem Spiel, die keinen direkten Einfluss auf die Auszahlung hat, aber dennoch die Kooperationsbereitschaft erhöhen kann.
Führt eine Feedback-Option zu mehr Kooperation?
Die Arbeit untersucht, ob die Möglichkeit des Gegenspielers, eine Entscheidung ex post zu kommentieren, die Strategiewahl beeinflusst und die Kooperationsrate steigert.
Welchen Einfluss haben Emotionen auf die Entscheidung im Dilemma?
Gemütszustände und persönliche Merkmale spielen eine Rolle; die Angst vor negativer Rückmeldung oder das Bedürfnis nach fairer Behandlung können Kooperation fördern.
Warum entscheiden sich Menschen trotz rationaler Theorie oft für Kooperation?
Empirische Befunde zeigen, dass soziale Normen, Vertrauen und Kommunikationsmöglichkeiten die rein ökonomische „Defektions-Logik“ in der Praxis oft außer Kraft setzen.
- Citation du texte
- M.Sc. Ercan Hayvali (Auteur), 2013, Führt eine Feedback-Option eines Spielers in einem Gefangenen-Dilemma mit einseitiger Kommunikation zu mehr Kooperation?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437270