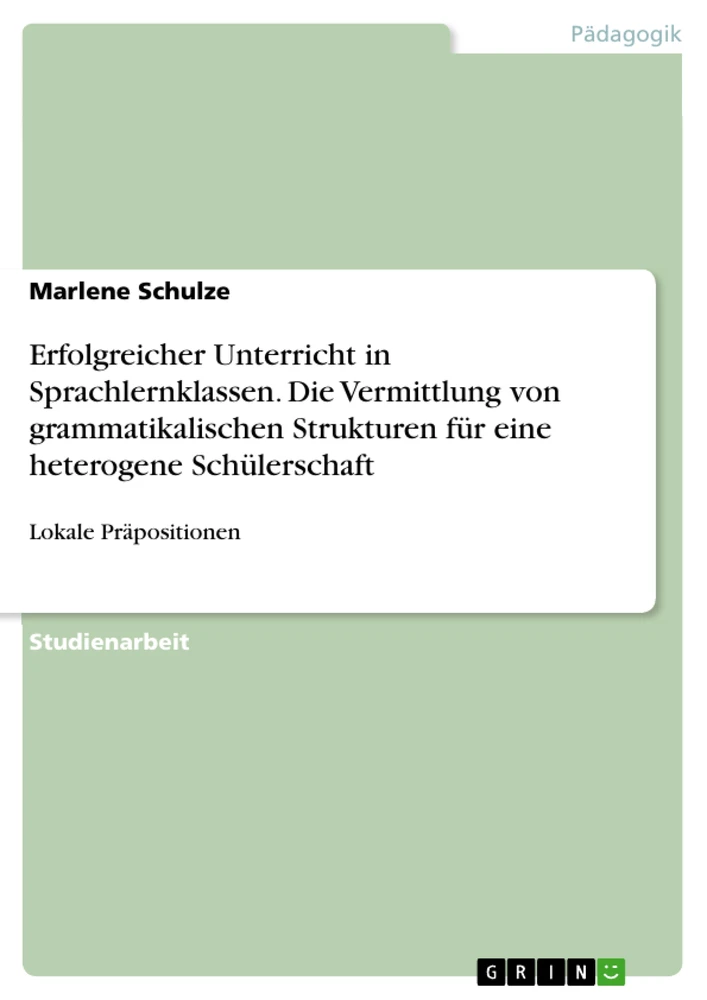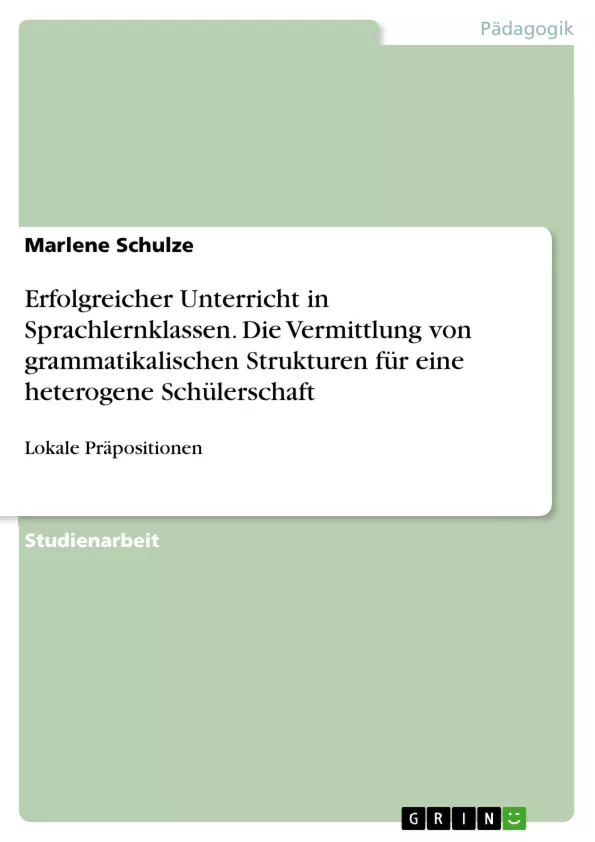Momentan kann man kaum Nachrichten verfolgen, ohne mit Informationen über Flucht und Migration in Berührung zu kommen. Viele Menschen machen sich auf den Weg in die Bundesrepublik Deutschland und flüchten bzw. emigrieren aus ihrem Herkunftsland. Unter ihnen sind sehr viele Kinder und Jugendliche. Hier angekommen, haben sie (je nach Bundesland) das Recht oder sogar die Pflicht, zur Schule zu gehen, auch, solange sie keinen Aufenthaltstitel haben. Haben sie den, sind sie auf jeden Fall schulpflichtig.
Angesichts des verstärkten Zuzugs in den vergangenen Jahren hat sich das Anfang der 70er Jahre entwickelte Konzept der „internationalen Vorbereitungsklassen“ (IVK) extrem verbreitet: In vielen Bundesländern werden Kinder, die ohne Deutschkenntnisse in das Schulsystem eintreten, vorerst in diesen Klassen unterrichtet, mit dem primären Ziel, zunächst die Unterrichts- und Landessprache des Landes zu erwerben: Deutsch.
Da ein Großteil dieser Klassen nicht im Vorhinein bestand, sind in den letzten drei Jahren in den Bundesländern, die dieses Konzept nutzen, viele solcher Sprachlernlassen entstanden. Im Seminar „Deutsch für Seiteneinsteiger“ wurden der Alltag, die Konzeption, aber auch Herausforderungen in einer solchen Sprachlernklasse im Bundesland Niedersachsen diskutiert.
Diese Hausarbeit konzentriert sich, ausgehend vom Seminar, auf die Konzeption von Sprachlernklassen: Die Fragestellung bezieht sich auf Vermittlung von grammatikalischen Strukturen in Sprachlernklassen. Dazu wird zuerst die spezielle Situation in diesen Klassen dargestellt, um darauf aufbauend die Vermittlung von Grammatik in diesen Klassen zu erörtern. Es werden verschiedene Methoden, Grammatik in den Unterricht einzubetten, dargestellt und diese mit der Situation in solchen Klassen in Bezug gesetzt und auf ihre Realisierbarkeit hin überprüft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Forschungsstand
- Termini: Deutsch als Zweitsprache (DaZ) versus Deutsch als Fremdsprache (DaF)
- Die spezielle Situation in Sprachlernklassen
- Historie und Konzept
- Die Ausgangslage in Sprachlernklassen
- Entstehende Herausforderungen im Lernstand und Lernfortschritt
- Die Vermittlung grammatikalischer Strukturen
- Was ist Grammatik?
- Grammatikalische Zugänge in der DaZ-Didaktik
- Der gesteuerte Spracherwerb: notwendig oder überflüssig?
- Realisierbarkeit der Konzepte in der Unterrichtspraxis
- Spezielle Wichtigkeit für Sprachlernklassen
- Anwendungsbeispiel: Lokale Präpositionen
- Definition des Lernfelds der Präpositionen
- Schwierigkeiten beim Erwerb der lokalen Präpositionen
- Spezielle Schwierigkeit der SuS mit Türkisch als Muttersprache beim Erwerb der lokalen Präpositionen
- Erfolgreiche Vermittlung und Erwerbsstrategien lokaler Präpositionen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Vermittlung von grammatikalischen Strukturen in Sprachlernklassen für Seiteneinsteiger in Deutschland. Im Fokus steht die Darstellung der besonderen Herausforderungen und Lernbedingungen in diesen Klassen sowie die Erörterung verschiedener Methoden zur Integration von Grammatik in den Unterricht. Die Arbeit zielt darauf ab, die Realisierbarkeit und Wirksamkeit dieser Methoden in der Praxis zu analysieren und Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte aufzuzeigen.
- Die spezielle Situation in Sprachlernklassen: Historischer Kontext, Ausgangslage und Herausforderungen
- Vermittlung grammatikalischer Strukturen in der DaZ-Didaktik: Verschiedene Ansätze und Methoden
- Realisierbarkeit von Grammatikvermittlungskonzepten in der Unterrichtspraxis
- Spezielle Bedeutung der Grammatikvermittlung für Sprachlernklassen
- Anwendung des Themas am Beispiel von lokalen Präpositionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den aktuellen Forschungsstand zum Thema Sprachlernklassen dar und erläutert die Relevanz der Arbeit. Anschließend werden die Termini „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ) und „Deutsch als Fremdsprache“ (DaF) im Hinblick auf ihre Bedeutung für den Grammatikerwerb definiert und unterschieden. Im dritten Kapitel werden die spezifischen Herausforderungen und Lernbedingungen in Sprachlernklassen beleuchtet, die aus der heterogenen Zusammensetzung der Schüler*innenschaft resultieren.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Vermittlung grammatikalischer Strukturen in der DaZ-Didaktik. Es werden verschiedene Ansätze und Methoden zur Einbindung von Grammatik in den Unterricht vorgestellt und auf ihre Realisierbarkeit in der Praxis hin untersucht. Im fünften Kapitel wird das Anwendungsbeispiel der lokalen Präpositionen betrachtet, die für viele Seiteneinsteiger*innen eine große Herausforderung darstellen. Die Arbeit beleuchtet die Schwierigkeiten beim Erwerb dieser grammatischen Strukturen, insbesondere für Schüler*innen mit Türkisch als Muttersprache, und diskutiert erfolgreiche Vermittlungsstrategien.
Schlüsselwörter
Sprachlernklassen, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Grammatikvermittlung, Heterogenität, Spracherwerb, Lernstand, Lernfortschritt, Präpositionen, Unterrichtsmethoden, DaZ-Didaktik, Seiteneinsteiger, Sprachförderung, Integration, Deutschunterricht, Interkulturelle Kompetenz.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Sprachlernklassen (IVK)?
Sprachlernklassen sind Vorbereitungsklassen für Kinder und Jugendliche ohne Deutschkenntnisse, mit dem Ziel, die Unterrichts- und Landessprache schnellstmöglich zu erwerben.
Was ist der Unterschied zwischen DaZ und DaF?
DaZ (Deutsch als Zweitsprache) bezieht sich auf den Spracherwerb im Zielland zur Bewältigung des Alltags, während DaF (Deutsch als Fremdsprache) meist im Ausland ohne unmittelbaren Alltagsbezug gelernt wird.
Warum ist die Vermittlung von Grammatik in diesen Klassen schwierig?
Die extreme Heterogenität der Schüler hinsichtlich Herkunft, Alter und Vorbildung erschwert einen einheitlichen Grammatikunterricht.
Welches Beispiel für Grammatikvermittlung wird in der Arbeit genutzt?
Die Arbeit analysiert die Vermittlung lokaler Präpositionen, die aufgrund ihrer Komplexität oft eine große Hürde für Seiteneinsteiger darstellen.
Welche speziellen Schwierigkeiten haben türkischsprachige Schüler?
Aufgrund struktureller Unterschiede zwischen dem Türkischen und dem Deutschen treten spezifische Probleme beim Erwerb deutscher Präpositionen auf, die im Unterricht berücksichtigt werden müssen.
- Citar trabajo
- Marlene Schulze (Autor), 2015, Erfolgreicher Unterricht in Sprachlernklassen. Die Vermittlung von grammatikalischen Strukturen für eine heterogene Schülerschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437359