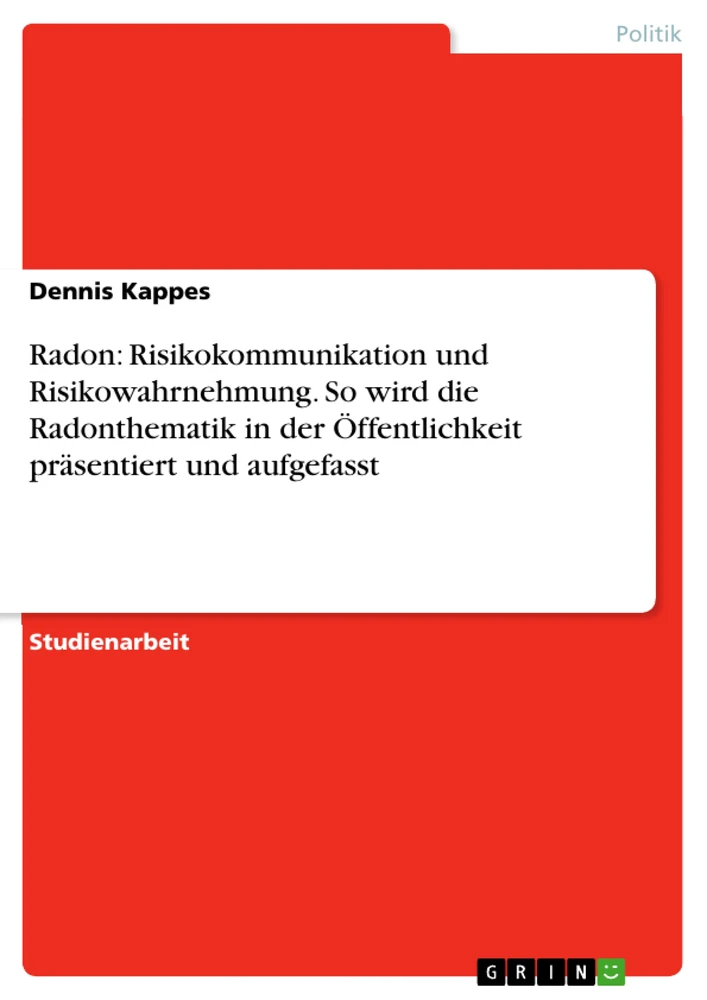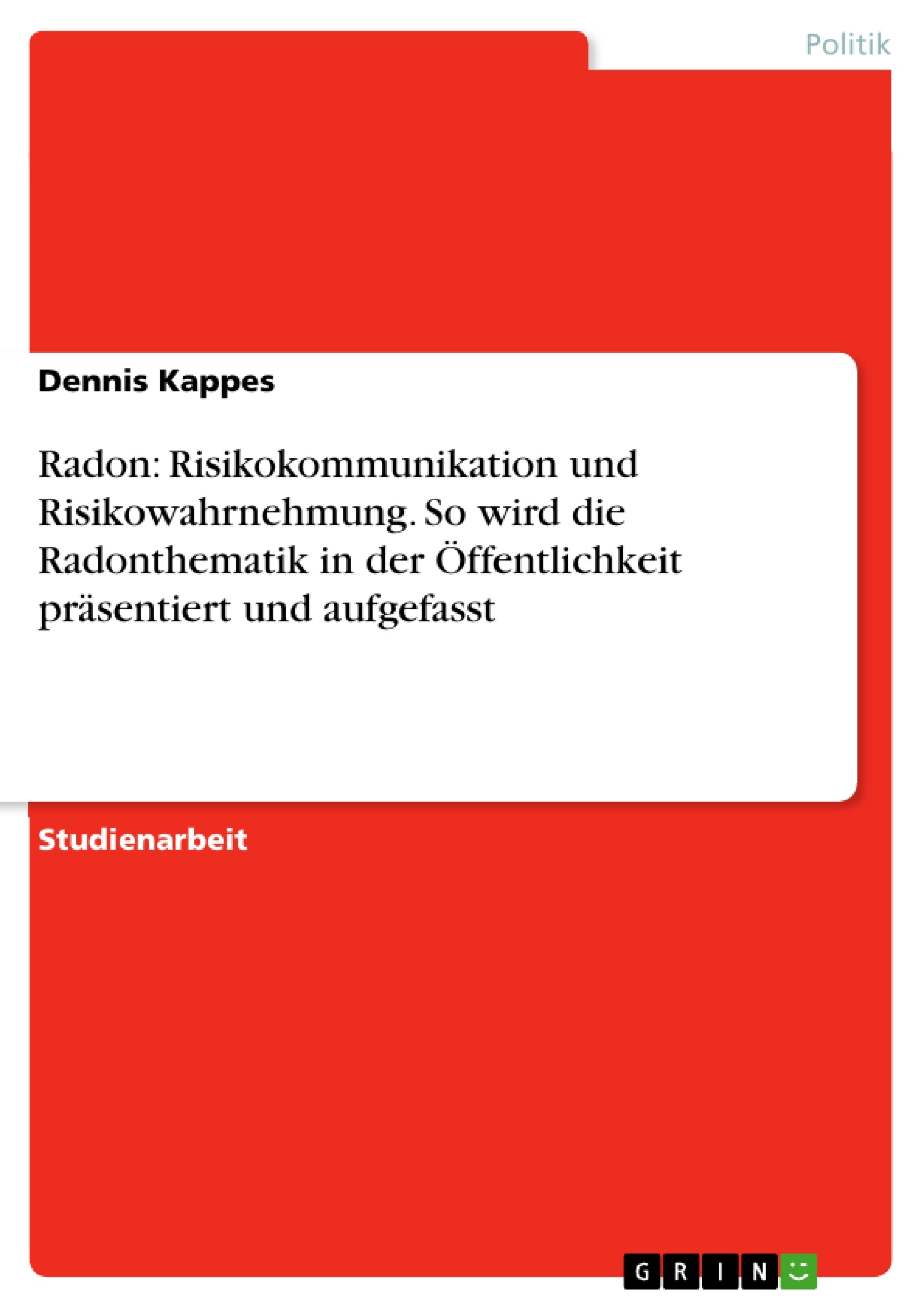Am 12. Mai 2017 wurde in Deutschland das neue StrlSchG vom Bundesrat verabschiedet. Die Neuregelung, die ab dem 01. Oktober 2017 in Kraft tritt, geht auf die EU-Richtlinie 2013/59/Euratom zurück und fasst Vorgaben aus StrlSchV, RöV und StrVG zusammen. Das neue StrlSchG umfasst neben Maßnahmen zur besseren Vorsorge für den Notfall und dem umfassenden Schutz vor schädlicher Strahlung in der Medizin, auch Neuerungen zum Schutz vor Radon. Diverse Aspekte zum Schutz vor Radon sind dafür in einem eigenständigen Kapitel zusammengefasst worden. Dieses Kapitel beinhaltet unter anderem einen auferlegten Radonreferenzwert sowie Festlegungen zur Erstellung eines Radonmaßnahmenplans.
Ein Teil dieses Radonmaßnahmenplans sieht vor, Kommunikationsstrategien zu entwickeln, mit deren Hilfe das öffentliche Bewusstsein über die bestehenden Risiken im Zusammenhang mit dem Edelgas Radon geschärft werden soll. Ausgehend vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit erfolgt die Bekanntmachung des Radonmaßnahmenplans. In Zusammenarbeit mit den Ländern, also mithilfe von Strahlenschutzbehörden und Gesundheitsorganisationen soll dieser Plan regelmäßig aktualisiert werden.
Da die Kommunikationsstrategien einzelner nationaler und internationaler Strahlenschutzbehörden und Gesundheitsorganisationen zum Thema Radon sich je nach Lokalität und Zuständigkeitsbereich unterscheiden, sollen einige dieser Kommunikationsstrategien im Rahmen dieser Studienarbeit recherchiert und dokumentiert werden. Eine anschließende Gegenüberstellung der erzielten Erkenntnisse im nationalen bzw. internationalen Vergleich soll diese überschaubar und transparent darstellen. Abschließend soll auch die daraus resultierende Radon-Risikowahrnehmung in der Öffentlichkeit bestimmt sowie mögliche Gründe für etwaige Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen bezüglich der Radon-Risikowahrnehmung diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Radon
- Allgemeiner Überblick
- Gefahren durch Radon
- Rechtliche Grundlagen
- Richtlinien zur Radonthematik in Deutschland
- Radonmaßnahmenplan
- Referenzwert für Radon
- Richtlinien und Standards zum Thema Radon in anderen Ländern
- Europäische Länder
- USA
- Australien
- Richtlinien zur Radonthematik in Deutschland
- Risikokommunikation
- Ziele und Schwierigkeiten bei der Risikokommunikation
- Risikokommunikation zur Radonthematik
- Betrachtete Institutionen und deren Kommunikationsstrategien
- Weltgesundheitsorganisation (WHO)
- Internationale Strahlenschutzkommission (ICRP)
- Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)
- Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL)
- United States Environmental Protection Agency (US EPA)
- Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA)
- Vergleich der Kommunikationsstrategien
- Resultierende Radon-Risikowahrnehmung und Gründe für Unterschiede
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studienarbeit analysiert die Kommunikation von Risiken im Zusammenhang mit Radon und deren Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Sie beleuchtet die rechtlichen Grundlagen für Radonprävention in Deutschland und anderen Ländern und untersucht verschiedene Kommunikationsstrategien von nationalen und internationalen Institutionen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Unterschiede in der Risikowahrnehmung in verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu erklären und die Effektivität verschiedener Kommunikationsansätze zu beurteilen.
- Rechtliche Grundlagen für Radonprävention in Deutschland und anderen Ländern
- Kommunikationsstrategien nationaler und internationaler Institutionen zur Radonthematik
- Einflussfaktoren auf die Radon-Risikowahrnehmung in der Bevölkerung
- Bewertung der Effektivität unterschiedlicher Kommunikationsansätze
- Diskussion möglicher Maßnahmen zur Verbesserung der Risikokommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Aktualität des Themas Radon im Kontext der neuen Strahlenschutzgesetzgebung in Deutschland dar. Kapitel 2 bietet einen allgemeinen Überblick über Radon und erläutert dessen Gefahrenpotenzial für die menschliche Gesundheit. Kapitel 3 beleuchtet die rechtlichen Grundlagen für Radonprävention in Deutschland und anderen Ländern, wobei die Radonmaßnahmenpläne und Referenzwerte für Radon im Fokus stehen. Kapitel 4 befasst sich mit den Zielen und Herausforderungen der Risikokommunikation und beleuchtet die spezifischen Besonderheiten der Risikokommunikation zur Radonthematik.
Kapitel 5 präsentiert die Kommunikationsstrategien verschiedener internationaler und nationaler Institutionen, darunter die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Internationale Strahlenschutzkommission (ICRP), das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), die United States Environmental Protection Agency (US EPA) und die Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA). Kapitel 6 vergleicht die unterschiedlichen Kommunikationsstrategien und beleuchtet die jeweiligen Vor- und Nachteile. Kapitel 7 diskutiert die resultierende Radon-Risikowahrnehmung in der Öffentlichkeit und analysiert die Gründe für mögliche Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen.
Schlüsselwörter
Radon, Risikokommunikation, Risikowahrnehmung, Strahlenschutz, rechtliche Grundlagen, Radonmaßnahmenplan, Referenzwert, Kommunikationsstrategien, Weltgesundheitsorganisation (WHO), Internationale Strahlenschutzkommission (ICRP), Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), United States Environmental Protection Agency (US EPA), Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA), Öffentliches Bewusstsein, Gesundheitsrisiko, Lungenkrebs.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des deutschen Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) bezüglich Radon?
Das Gesetz zielt auf eine bessere Vorsorge und den Schutz vor Radon ab, unter anderem durch die Festlegung eines Referenzwerts und die Erstellung eines Radonmaßnahmenplans.
Was ist ein Radonreferenzwert?
Ein Referenzwert dient als Maßstab zur Beurteilung der Radonkonzentration in Gebäuden, um gesundheitliche Risiken wie Lungenkrebs zu minimieren.
Welche Institutionen informieren über die Gefahren von Radon?
Wichtige Institutionen sind die Weltgesundheitsorganisation (WHO), das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) und die US Environmental Protection Agency (EPA).
Warum unterscheidet sich die Radon-Risikowahrnehmung in der Bevölkerung?
Die Wahrnehmung hängt von der lokalen Kommunikation, dem Bildungsstand und den individuellen Kommunikationsstrategien der Behörden ab.
Welche gesundheitlichen Gefahren gehen von Radon aus?
Das radioaktive Edelgas Radon gilt als eine der Hauptursachen für Lungenkrebs bei Nichtrauchern und stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.
Was beinhaltet ein Radonmaßnahmenplan?
Er umfasst Kommunikationsstrategien zur Schärfung des öffentlichen Bewusstseins und konkrete Schritte zur Reduzierung der Radonbelastung in betroffenen Gebieten.
- Citation du texte
- Dennis Kappes (Auteur), 2018, Radon: Risikokommunikation und Risikowahrnehmung. So wird die Radonthematik in der Öffentlichkeit präsentiert und aufgefasst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437471