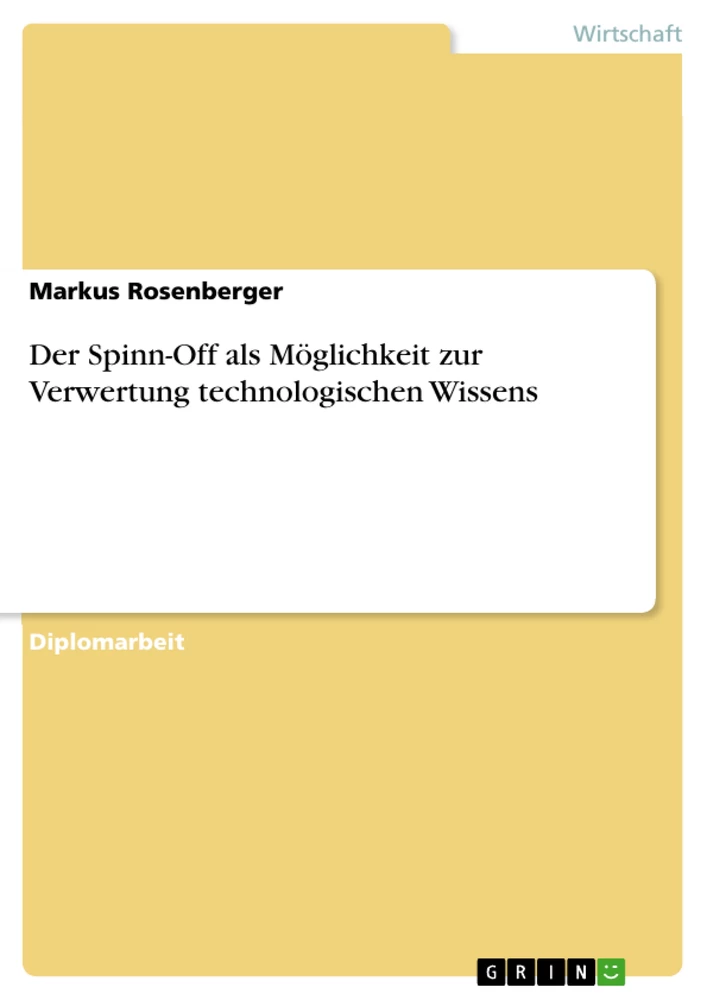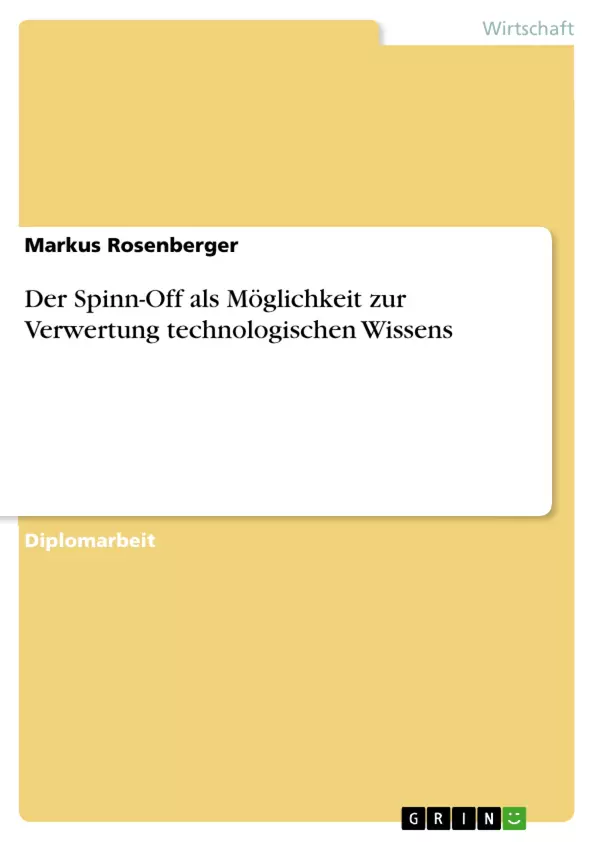Die Entwicklung des Menschen und der Gesellschaft reicht viele Millionen Jahre zurück. Zu jeder Zeit war und ist der Mensch bestrebt, neue Hilfsmittel zu erfinden, die ihm sein Leben erleichtern. Sehr oft entstanden diese auch per Zufall. Beispielhaft sei hier die Entdeckung des Teflons genannt, welches seinen Ursprung im Jahre 1851 hatte, als John Gorre ein Patent für ein „Gerät zur künstlichen Produktion von Eis bei tropischen Temperaturen“ anerkannt bekam. Es war die Geburtsstunde des Kühlschranks. Problematisch war jedoch bei den ersten Geräten, dass die verwendeten Kühlmittel sich durch vorhandene Leckagen in den Leitungen verflüchtigten, sich in den Küchen ausbreiteten und zu einem hochexplosiven Gas-Luft- Gemisch reagierten. Da dieser Umstand beseitigt werden musste, sollten neue Kühlmittel erfunden werden. Hierzu gründeten unter anderem General Motors (GM) und DuPont ein Joint Venture und stellten eine solche Flüssigkeit namens Freon her. Aus patentrechtlichen Gründen durfte jedoch nur die Frigidaire-Sparte von GM deren Kunde sein. Vor diesem Hintergrund beauftragte DuPont seinen Forscher Roy Plunkett mit der Erforschung eines alternativen Kältemittels. Hierzu benötigte er das Gas Tetrafluorethylen, welches er in Stahlflaschen bei etwa minus 80 Grad lagerte, da es dann in flüssigem Zustand war. Bei einer Versuchsanordnung wurde daraufhin festgestellt, dass sich das Tetrafluorethylen in den Stahlflaschen polymerisiert hatte und es die Stahlflasche regelrecht auskleidete. Das Teflon war entdeckt und wurde von nun an vielfältig eingesetzt, wie beispielsweise in den Beschichtungen von Pfannen.
Dieses Beispiel zeigt, wie durch eine zufällige Entdeckung neues technologisches Wissen generiert und dadurch innovative Produkte erfolgreich am Markt verwertet werden können. Das Thema Innovation hat gerade im Jahr 2004 eine aktuelle Bedeutung erlangt, da es Bundeskanzler Gerhard Schröder zum Jahr der Innovation ausgerufen hat. Jedoch muss sich Deutschland nicht verstecken. Es steht an der Spitze der relevanten Patentanmeldungen im Weltmarkt und ist auf Platz zwei der Technologieexporteure. Dies darf allerdings nicht zu dem Schluss führen, dass ein Unternehmen den vorhandenen Wettbewerbsdruck nur überlebt, wenn es entweder günstigere oder bessere Produkte als die Konkurrenz anbietet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Gang der Untersuchung
- Grundlegende Begriffe
- Der Spin-Off als Ausgliederungsform
- Bewertungsrelevante Eigenschaften eines Spin-Offs
- Die Verwertung technologischen Wissens
- Der Unternehmenswert als Strategiebewertungsverfahren
- Verfahren zur Bewertung von Unternehmen
- Ertragswertverfahren nach IDW S1
- Discounted Cashflow-Verfahren
- Multiplikatorverfahren
- Realoptionsansatz
- Zwischenfazit zu den Bewertungsverfahren
- Phasenkonzepte zur Erklärung des Verwertungsprozesses
- Verschiedene Modelle des Innovationsprozesses
- Der Innovationsprozess nach Brockhoff
- Das Chain-Link-Modell
- Gründungsprozess technologischer Existenzgründungen
- Risiken im Innovationsprozess
- Unsystematisches Risiko
- Systematisches Risiko
- Irreversibilität von getroffenen Entscheidungen
- Der Faktor Zeit im Verwertungsprozess
- Bewertungskonzept bei unterschiedlichen Verwertungsalternativen
- Modell von Kellogg/Charnes
- Ableitung für Verwertungsalternativen
- Fallstudie zur Realoptionsbewertung
- Identifikation relevanter Werttreiber
- Werttreiber der DCF-Bewertung
- Werttreiber des Cashflows (CF)
- Die Erfolgs- bzw. Misserfolgswahrscheinlichkeit
- Der verwendete Zinssatz (r) und die Wachstumsrate (g)
- Die Dauer der Phasen und der Zeitwert des Geldes
- Werttreiber der Realoptionsbewertung
- Der Basiswert
- Der Ausübungspreis
- Die Volatilität des Cashflows
- Die Laufzeit
- Der risikolose Zinssatz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Verwertung technologischen Wissens und insbesondere mit der Frage, inwiefern der Spin-Off als Möglichkeit zur Wertschöpfung genutzt werden kann.
- Die Analyse verschiedener Bewertungsansätze für Unternehmen im Kontext von Spin-Offs
- Die Untersuchung der spezifischen Eigenschaften von Spin-Offs im Vergleich zu anderen Unternehmensformen
- Die Bedeutung von Innovationsprozessen und deren Risiken bei der Verwertung von technologischen Wissens
- Die Herausforderungen der Entscheidungsfindung bei der Wahl zwischen verschiedenen Verwertungsalternativen
- Die Identifizierung und Bewertung relevanter Werttreiber für den Erfolg von Spin-Offs
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Problemstellung ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit sowie den methodischen Ansatz. Kapitel zwei beleuchtet die grundlegenden Begriffe, die für das Verständnis des Spin-Offs und der Verwertung technologischen Wissens relevant sind. Im dritten Kapitel werden verschiedene Verfahren zur Bewertung von Unternehmen vorgestellt und deren Eignung für die Analyse von Spin-Offs diskutiert.
Kapitel vier beschäftigt sich mit Phasenkonzepten und Modellen des Innovationsprozesses und analysiert die Risiken, die mit dem Verwertungsprozess technologischen Wissens verbunden sind. In Kapitel fünf wird ein Bewertungskonzept für unterschiedliche Verwertungsalternativen präsentiert, das auf dem Realoptionsansatz basiert. Das sechste Kapitel identifiziert und analysiert die wichtigsten Werttreiber, die den Erfolg von Spin-Offs beeinflussen.
Schlüsselwörter
Spin-Off, Verwertung technologischen Wissens, Unternehmensbewertung, Discounted Cashflow-Verfahren, Realoptionsansatz, Innovationsprozess, Risiko, Entscheidungsfindung, Werttreiber, Strategiebewertung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Spin-Off im unternehmerischen Kontext?
Ein Spin-Off ist eine Ausgliederung eines Unternehmensteils oder einer Technologie, um dieses Wissen eigenständig am Markt zu verwerten.
Wie wird technologisches Wissen erfolgreich verwertet?
Die Arbeit zeigt am Beispiel von Teflon, wie zufällige Entdeckungen durch gezielte Innovationsprozesse in marktfähige Produkte umgewandelt werden können.
Welche Verfahren zur Unternehmensbewertung gibt es für Spin-Offs?
Vorgestellt werden das Ertragswertverfahren (IDW S1), das Discounted Cashflow-Verfahren (DCF), Multiplikatorverfahren und der Realoptionsansatz.
Welche Risiken bestehen im Innovationsprozess?
Es wird zwischen unsystematischen und systematischen Risiken unterschieden, wobei auch die Irreversibilität von Entscheidungen eine große Rolle spielt.
Was sind die wichtigsten Werttreiber eines Spin-Offs?
Zentrale Werttreiber sind die Volatilität des Cashflows, die Erfolgswahrscheinlichkeit, die Laufzeit der Patente und der risikolose Zinssatz.
- Arbeit zitieren
- Markus Rosenberger (Autor:in), 2004, Der Spinn-Off als Möglichkeit zur Verwertung technologischen Wissens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437478