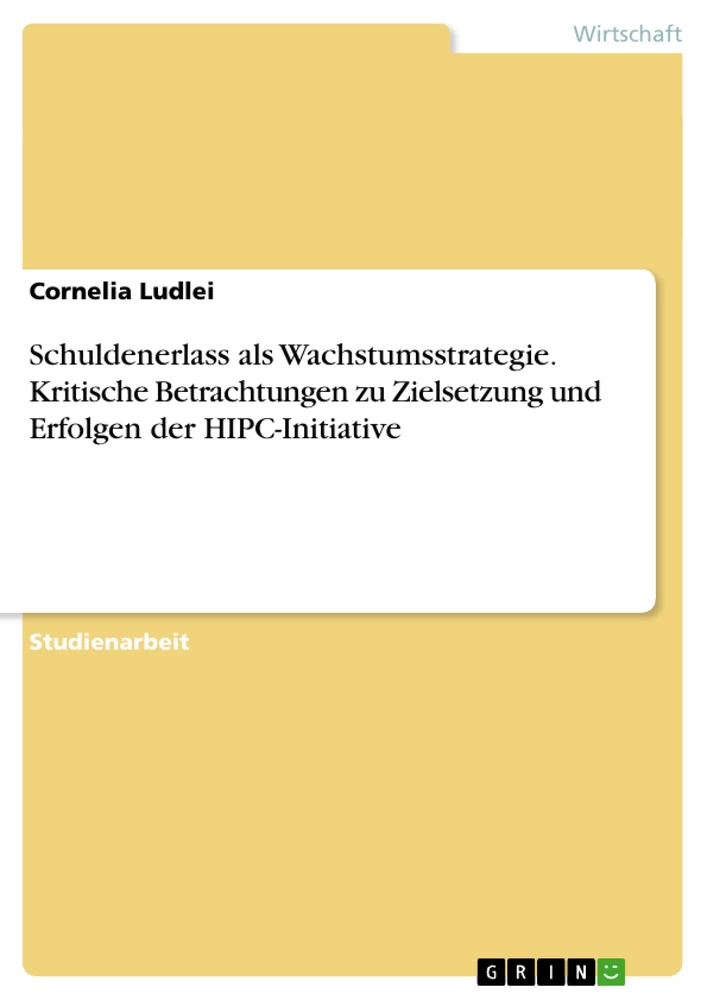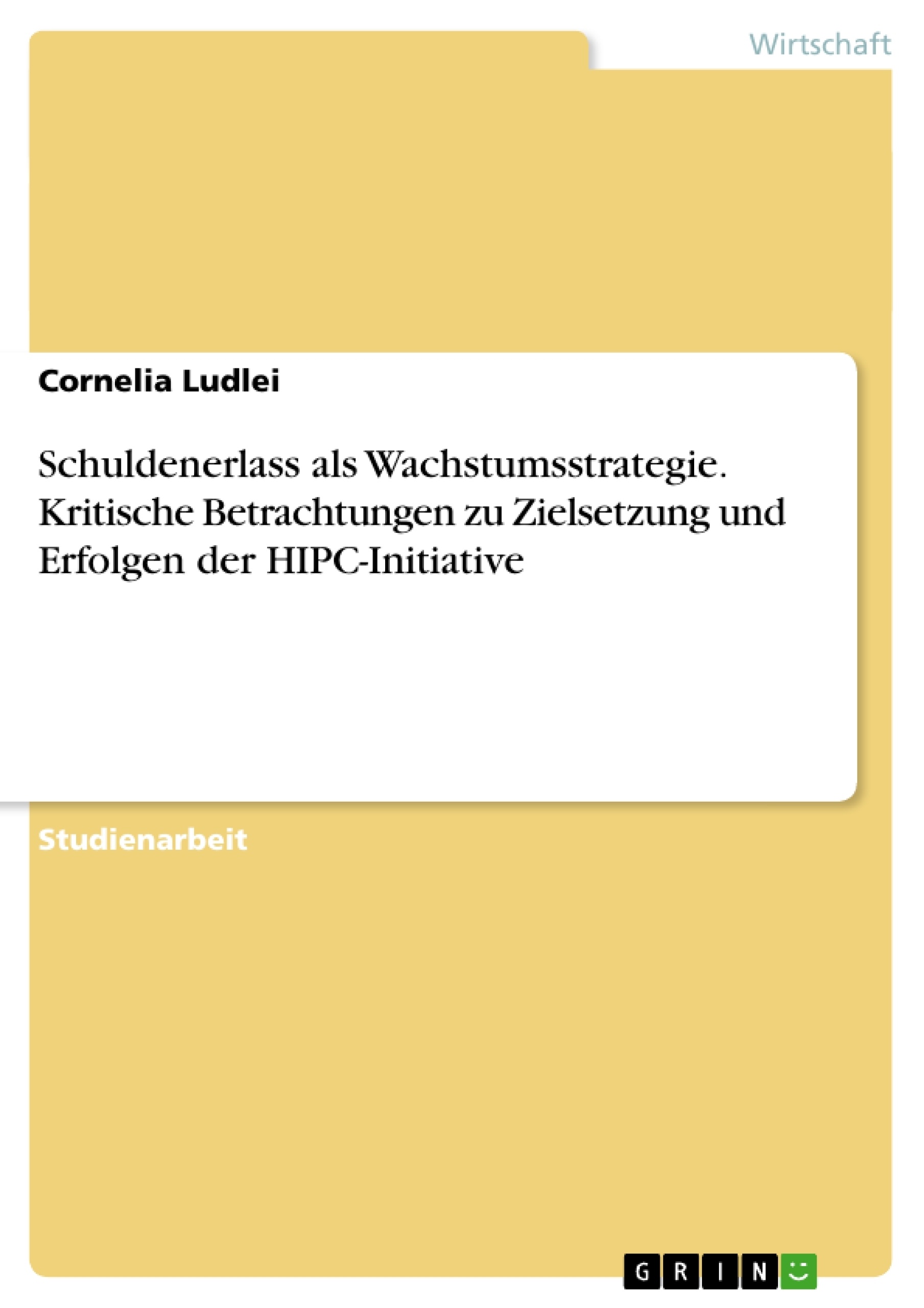Eine der größten Herausforderungen der internationalen Gemeinschaft ist die Beseitigung der weit verbreiteten Armut auf der Welt. Die effektive Armutsbekämpfung und die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung werden durch die enorme Verschuldung der betroffenen Länder gehemmt. Aufgrund dieser hohen Verschuldung müssen teilweise die gesamten Einnahmen für den Schuldendienst verwendet werden, wodurch keine ausreichenden Mittel für dringend erforderliche Investitionen bspw. in das Gesundheits- und Bildungswesen vorhanden sind. Zur Finanzierung dieser Investitionen, die eine wichtige Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaftswachstum darstellen, müssen diese Länder neue Kredite aufnehmen. Diese erhöhen den ohnehin schon sehr hohen Schuldendienst, zu dessen Bezahlung wiederum Kredite aufgenommen werden müssen. Die aus diesem Verschuldungskreislauf resultierende erhebliche Überschuldung besteht derzeit bei den ärmsten Ländern der Welt.
Anhand Tabelle 1 im Anhang kann man anhand einiger Beispielländer erkennen, wie hoch die Verschuldung in den einzelnen Ländern ist und wie dringend erforderlich eine Lösung des Problems ist. Sie sind so sehr überschuldet, dass sie ihre Schuldendienstverpflichtungen nicht, wie vertraglich vereinbart, erfüllen können und daher dringend Hilfe benötigen.
In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, ob durch die HIPC-Initiative den Ländern tatsächlich aus der Überschuldung herausgeholfen werden konnte und damit die Armutsbekämpfung und das wirtschaftliche Wachstum gefördert wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Hintergrund
- HIPC Initiative
- Entstehung
- Neuerungen
- Ziele
- Schuldentragfähigkeit
- Was bedeuten tragfähige Schulden?
- Kriterien der Schuldentragfähigkeit
- HIPC-Prozess
- Die 1. Phase und der Entscheidungszeitpunkt
- Schuldentragfähigkeitsanalyse
- Die 2. Phase und der Abschlusszeitpunkt
- Kölner Entschuldungsinitiative
- Die Erweiterung der HIPC-Initiative
- Kritikpunkte der ursprünglichen HIPC-Initiative
- Änderungen in der Erweiterten HIPC-Initiative
- Tragfähigkeitskriterien
- Neue Strategieinhalte
- PRSP
- PRGF
- Prozess
- Kritik an der erweiterten Initiative
- IDA-Status
- Manipulationsspielraum
- Moral Hazard
- Kritik an PRSP
- Optimismus der Exporteinnahmen
- Schuldentragfähigkeitskriterien
- Bilaterale Schulden
- Umsetzungen in den Ländern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die HIPC-Initiative, die 1996 ins Leben gerufen wurde, um hochverschuldeten armen Ländern (HIPCs) aus der Überschuldung zu helfen. Sie analysiert, ob die Initiative tatsächlich die Armutsbekämpfung und das wirtschaftliche Wachstum in diesen Ländern gefördert hat.
- Analyse der Entstehung und Entwicklung der HIPC-Initiative
- Bewertung der Ziele und Strategien der Initiative
- Kritik an der ursprünglichen und erweiterten HIPC-Initiative
- Bewertung der Auswirkungen der Initiative auf die Armutsbekämpfung und das Wirtschaftswachstum
- Analyse der Umsetzung der Initiative in den Ländern
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit beleuchtet den Hintergrund der HIPC-Initiative, indem er auf die Problematik der Überschuldung in den ärmsten Ländern der Welt eingeht. Er zeigt die Notwendigkeit einer Lösung für diese Problematik auf, da die hohe Verschuldung die Armutsbekämpfung und das wirtschaftliche Wachstum behindert.
Der zweite Teil der Arbeit stellt die HIPC-Initiative vor, die 1996 von der Weltbank und dem IWF ins Leben gerufen wurde. Er beleuchtet die Entstehung der Initiative, die Neuerungen und Ziele, sowie den Prozess der Schuldentragfähigkeitsanalyse. Dieser Prozess umfasst die erste Phase mit dem Entscheidungszeitpunkt und die zweite Phase mit dem Abschlusszeitpunkt.
Der dritte Teil der Arbeit widmet sich der Erweiterung der HIPC-Initiative. Er beleuchtet die Kritikpunkte der ursprünglichen Initiative und beschreibt die Änderungen, die in der erweiterten Initiative vorgenommen wurden. Im Zentrum steht die Diskussion über die neuen Strategieinhalte wie die Armutsbekämpfungsstrategie (PRSP) und die Armutsbekämpfungs- und Wachstumsfazilität (PRGF).
Der vierte Teil der Arbeit analysiert die Kritik an der erweiterten HIPC-Initiative. Die Kritikpunkte umfassen Themen wie den IDA-Status, den Manipulationsspielraum und das Moral Hazard.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themengebiete der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, der Armutsbekämpfung, der Schuldentragfähigkeit, der HIPC-Initiative und der Entwicklungszusammenarbeit. Die Arbeit verwendet verschiedene Fachbegriffe aus diesen Bereichen, wie z.B. HIPCs, PRSP, PRGF, IDA, IWF, Weltbank und Schuldendienst.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die HIPC-Initiative?
Eine 1996 von Weltbank und IWF gestartete Initiative zum Schuldenerlass für die am höchsten verschuldeten armen Länder (Heavily Indebted Poor Countries).
Warum ist Überschuldung ein Hindernis für Entwicklung?
Extrem hohe Schulden binden alle Einnahmen für den Schuldendienst, sodass kein Geld für Investitionen in Gesundheit und Bildung bleibt.
Was bedeutet PRSP?
PRSP steht für Poverty Reduction Strategy Paper – ein Strategiepapier zur Armutsbekämpfung, das Länder für einen Schuldenerlass vorlegen müssen.
Was wird an der HIPC-Initiative kritisiert?
Kritikpunkte sind unter anderem zu optimistische Exportprognosen, Manipulationsspielräume und das Risiko von "Moral Hazard".
Hat die Initiative das Wirtschaftswachstum gefördert?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob der Schuldenerlass tatsächlich zu nachhaltigem Wachstum und effektiver Armutsbekämpfung geführt hat.
- Quote paper
- Cornelia Ludlei (Author), 2005, Schuldenerlass als Wachstumsstrategie. Kritische Betrachtungen zu Zielsetzung und Erfolgen der HIPC-Initiative, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43749