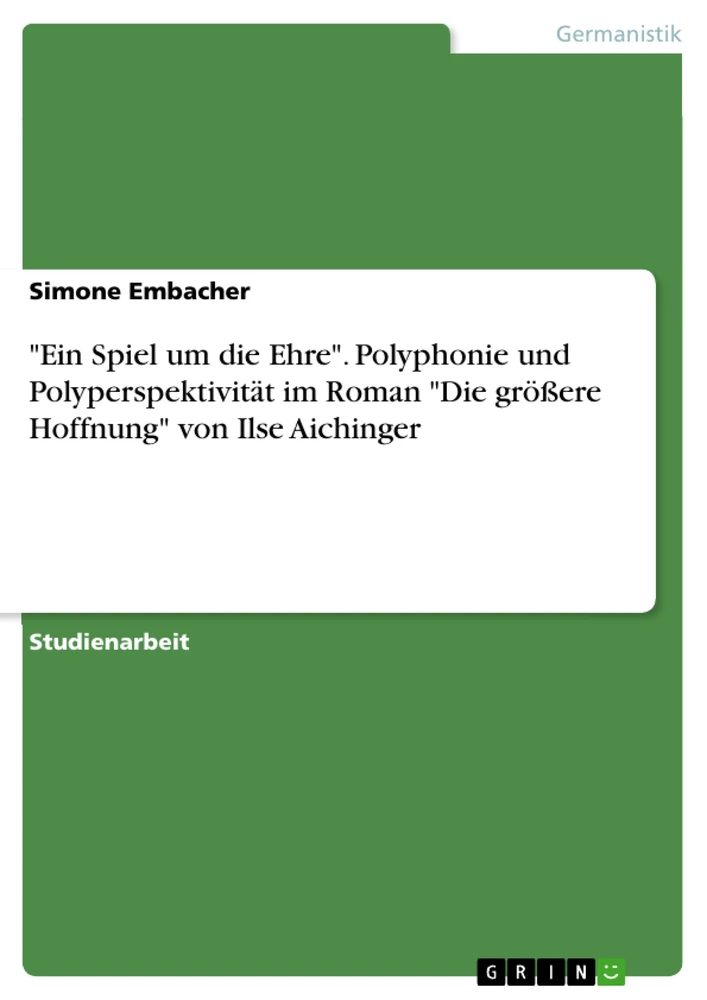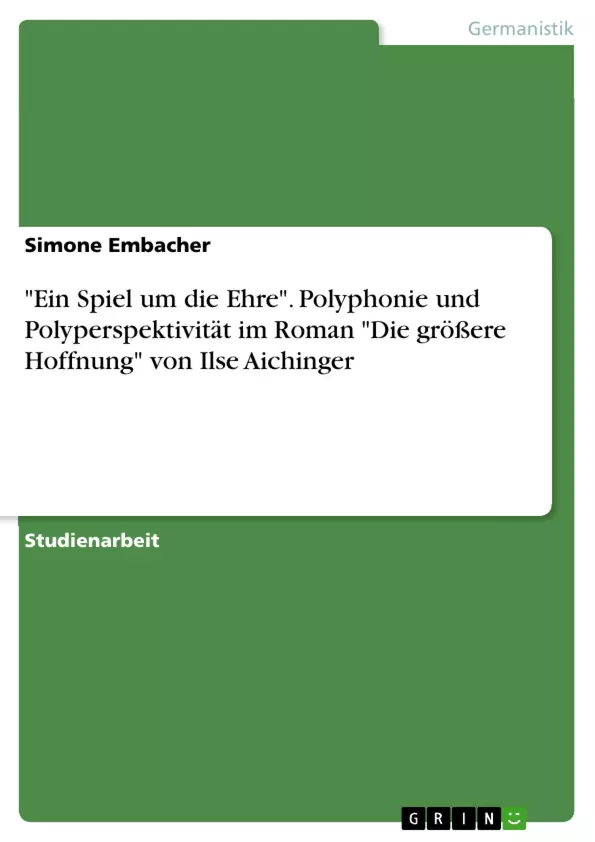Diese Seminararbeit wurde im Rahmen der Lehrveranstaltung ‚Romantische Kurzprosa - Eine Einführung in die Erzähltheorie in Form von Modellanalysen’ im Sommersemester 2017 verfasst. Die Romantik als Erzählepoche war dabei nicht zwingendes Kriterium für die Auswahl des zu analysierenden Textes. Vielmehr galt es, ein geeignetes Werk zu wählen, dem man sich mit Mitteln der Textanalyse und der Erzähltheorie nähert. Der Text, der mich zu dem Thema dieser Arbeit führte, ist der Roman "Die größere Hoffnung" von Ilse Aichinger, der erstmals 1948 erschien. Thematische Grundlage sind die unterschiedlichen Erzählperspektiven (Polyperspektivität) und Erzählstimmen (Polyphonie) mit dem besonderen Augenmerk auf die Perspektive des Kindes und deren spezielle Wirkung auf den Leser.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung und Überblick
- 2. Literatur und theoretische Grundlage
- 3. Ilse Aichinger
- 4. Die größere Hoffnung
- 4.1. Zum Aufbau
- 4.2. Zum Inhalt
- 5. Erzählsituation - Analyse anhand von ausgewählten Textstellen
- 6. Die Kindliche Perspektive
- 7. Die Sprache
- 8. Das Ausgesparte
- 9. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Roman "Die größere Hoffnung" von Ilse Aichinger und untersucht die Bedeutung von Polyphonie und Polyperspektivität im Werk. Insbesondere wird die Perspektive des Kindes im Roman beleuchtet und deren Wirkung auf den Leser untersucht.
- Die Rolle von Polyphonie und Polyperspektivität im Roman
- Die Bedeutung der kindlichen Perspektive
- Die Sprache und der Stil von Ilse Aichinger
- Das Ausgesparte und das Schweigen in Aichingers Werk
- Die Wirkung des Romans auf den Leser
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einführung und Überblick: Diese Einleitung stellt den Roman "Die größere Hoffnung" vor und erläutert die Themen und Ziele der Arbeit.
- Kapitel 2: Literatur und theoretische Grundlage: Hier werden die wichtigsten literarischen Werke und theoretischen Ansätze vorgestellt, die für die Analyse des Romans relevant sind.
- Kapitel 3: Ilse Aichinger: Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über das Leben und Werk von Ilse Aichinger und beleuchtet den historischen und biographischen Kontext des Romans.
- Kapitel 4.1: Zum Aufbau: Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Aufbau des Romans "Die größere Hoffnung" und analysiert die Struktur der einzelnen Kapitel.
- Kapitel 5: Erzählsituation - Analyse anhand von ausgewählten Textstellen: Dieser Abschnitt analysiert die Erzählsituation des Romans anhand von ausgewählten Textstellen.
- Kapitel 6: Die Kindliche Perspektive: Dieser Abschnitt untersucht die Rolle der kindlichen Perspektive im Roman und deren Wirkung auf den Leser.
- Kapitel 7: Die Sprache: Dieser Abschnitt analysiert die Sprache des Romans und die besonderen sprachlichen Merkmale von Ilse Aichingers Stil.
Schlüsselwörter
Polyphonie, Polyperspektivität, kindliche Perspektive, Schweigen, Ausgesparte, Sprache, Stil, Erzähltheorie, Ilse Aichinger, Die größere Hoffnung
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Ilse Aichingers Roman „Die größere Hoffnung“?
Der Roman thematisiert das Schicksal von Kindern während der Zeit des Nationalsozialismus, wobei die Grenze zwischen Realität und Traum oft verschwimmt.
Was bedeutet „Polyperspektivität“ in diesem Werk?
Es bedeutet, dass das Geschehen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wird, was die Komplexität und Zerrissenheit der dargestellten Welt unterstreicht.
Warum ist die kindliche Perspektive so zentral?
Durch den Blick des Kindes wird das Grauen der Verfolgung oft indirekt, poetisch oder verfremdet dargestellt, was eine besondere emotionale Wirkung auf den Leser erzielt.
Was versteht man unter „Polyphonie“ bei Aichinger?
Polyphonie bezeichnet die Vielstimmigkeit im Text, bei der verschiedene Erzählstimmen und Diskurse nebeneinander stehen, ohne sich gegenseitig zu dominieren.
Welche Rolle spielt das „Schweigen“ oder „Ausgesparte“?
Aichinger nutzt das Aussparen von Informationen als stilistisches Mittel, um die Unaussprechlichkeit des Holocausts und die existenzielle Not der Figuren zu verdeutlichen.
- Quote paper
- Simone Embacher (Author), 2017, "Ein Spiel um die Ehre". Polyphonie und Polyperspektivität im Roman "Die größere Hoffnung" von Ilse Aichinger, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437501