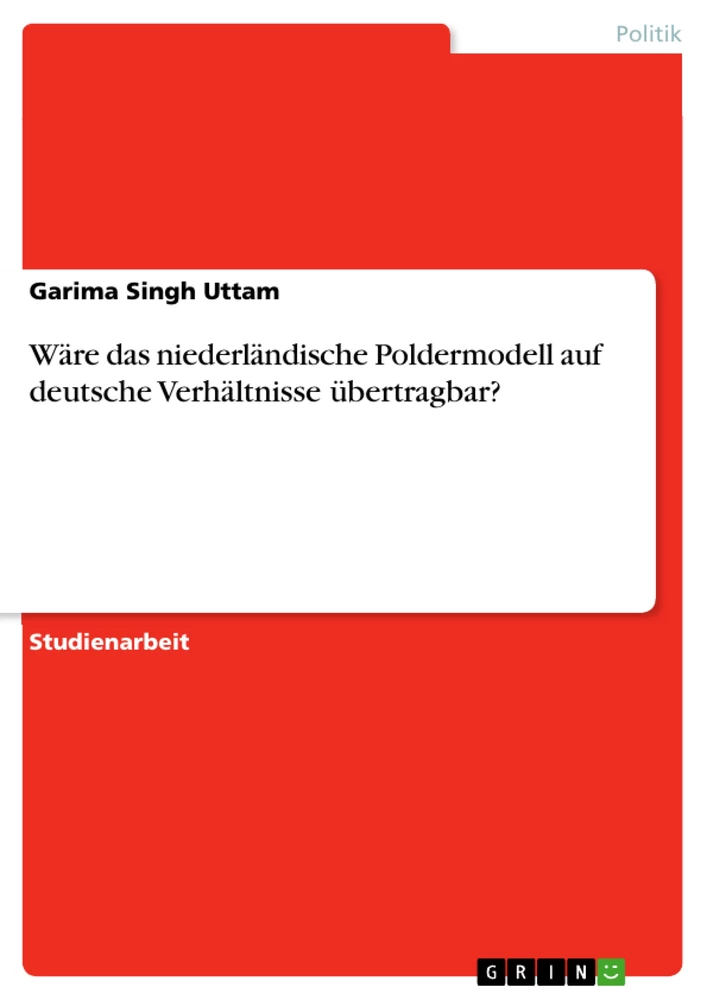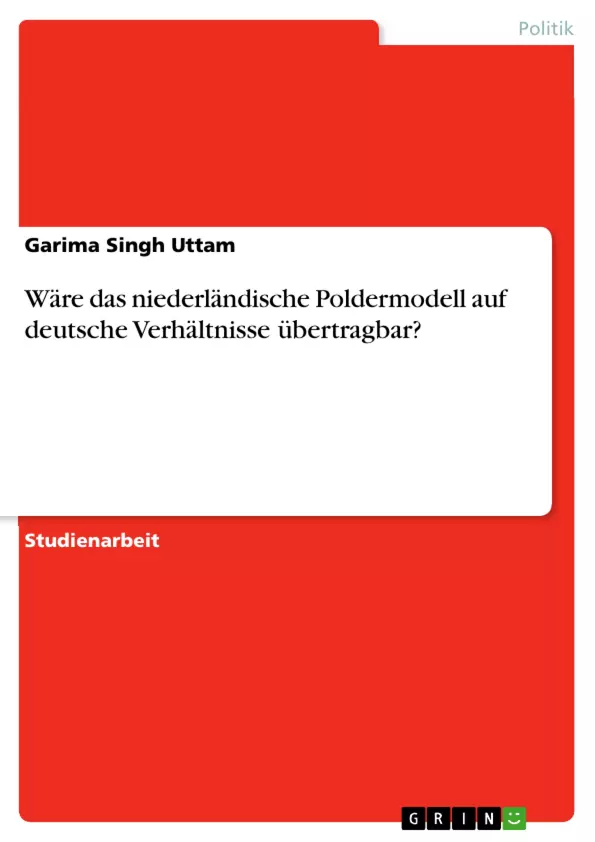Wegen ihrer damaligen wirtschaftlichen Situation fielen die Niederlande, zu Beginn der 1980er Jahre, international dramatisch in den Medien auf. Von Monat zu Monat stieg die Arbeitslosenzahl um etwa 10.000 Personen an, da liegt es nicht fern, dass sie bereits 1984 die Rekordzahl von 800.000 Arbeitslosen erreichte, was zu dieser Zeit ganze 14% der Erwerbsbevölkerung ausmachte. Logischerweise nahm durch die hohe Arbeitslosigkeit auch die Zahl der Leistungsempfänger des sozialen Sicherungssystems fatal zu, was wiederum die Staatsschulden beträchtlich in die Höhe trieb.
Deshalb ist es umso faszinierender wie sehr sich die Niederlande ab Mitte der 1990er Jahre zum Positiven weiterentwickelte, denn von heute auf morgen verwandelte sich die Niederlande zum beschäftigungspolitischen Vorbild der Allgemeinheit. Von nun an war das niederländische Poldermodell in alle Munde und der „kranke Mann Europas“ schon bald in Vergessenheit geraten. (vgl. Lubbers, 1990)
„[Ziel ist es] für alle potentiell Erwerbsfähigen die Fähigkeit zu eigener Existenzsicherung durch Arbeit […] zu stärken und Beschäftigung unter den bestmöglichen Bedingungen zu gewährleisten, und zwar zum Wohle des Einzelnen wie des Gemeinwesens.“ (Kleinhenz, 1998)
In dieser Hausarbeit soll untersucht werden, ob sich das niederländische Poldermodell auch auf deutsche Verhältnisse übertragen ließe. Damit dies möglich ist, soll zunächst der Begriff des Poldermodells, mit seinen wesentlichen Inhalten, definiert werden. Des Weiteren werden kurz die korporatistischen Interessensvertretungen und die wesentlichen Inhalte des Abkommens von Wassenaar betrachtet, bevor letztlich die Ergebnisse des Poldermodells zusammengefasst und kritisch betrachtet werden um die Fragestellung dieser Hausarbeit so gut wie möglich beantworten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das niederländische Poldermodell
- 2.1 Definition
- 2.2 Korporatistische Interessensvertretungen
- 2.3 Abkommen von Wassenaar
- 3. Aspekte des Poldermodells im Einzelnen
- 3.1 Sozialreform
- 3.2 Arbeitsmarktpolitik
- 4. Entwicklung und Folgen des Poldermodells.....
- 5. Vor- und Nachteile des niederländischen Poldermodells.....
- 5.1 Vorteile
- 5.2 Nachteile
- 6. Fazit..........\n
- 6.1 Kritische Betrachtung
- 6.2 Zusammenfassung.....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Übertragbarkeit des niederländischen Poldermodells auf deutsche Verhältnisse. Dazu wird zunächst der Begriff des Poldermodells definiert und seine zentralen Inhalte beleuchtet. Anschließend werden die korporatistischen Interessenvertretungen sowie das Abkommen von Wassenaar näher betrachtet. Abschließend werden die Ergebnisse des Poldermodells zusammengefasst und kritisch bewertet, um die Fragestellung der Hausarbeit so umfassend wie möglich zu beantworten.
- Das niederländische Poldermodell als ein Modell der Zusammenarbeit zwischen Regierung, Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften
- Die Rolle korporatistischer Interessenvertretungen im Poldermodell
- Die wesentlichen Inhalte des Abkommens von Wassenaar
- Die Entwicklung und Folgen des Poldermodells
- Die Übertragbarkeit des Poldermodells auf deutsche Verhältnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Hausarbeit dar und erläutert die Bedeutung des niederländischen Poldermodells im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung der Niederlande. Kapitel 2 definiert den Begriff des Poldermodells und erläutert seine zentralen Inhalte. Kapitel 3 befasst sich mit den wichtigsten Aspekten des Poldermodells, insbesondere mit der Sozialreform und der Arbeitsmarktpolitik.
Schlüsselwörter
Niederländisches Poldermodell, Korporatismus, Interessensvertretungen, Abkommen von Wassenaar, Sozialreform, Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaftsentwicklung, Übertragbarkeit, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das niederländische Poldermodell?
Es ist ein Modell der Konsensdemokratie und Zusammenarbeit zwischen Regierung, Arbeitgebern und Gewerkschaften zur Lösung wirtschaftlicher Probleme durch Lohnzurückhaltung und Reformen.
Was war das Abkommen von Wassenaar (1982)?
Dieses Abkommen gilt als Geburtsstunde des Poldermodells. Die Gewerkschaften stimmten Lohnminderungen zu, während die Arbeitgeber im Gegenzug Arbeitszeitverkürzungen und mehr Teilzeitstellen zusicherten.
Ist das Poldermodell auf Deutschland übertragbar?
Die Arbeit untersucht dies kritisch. Hürden sind die unterschiedliche Größe der Länder, die stärker dezentralisierte Tarifstruktur in Deutschland und kulturelle Unterschiede in der Konsensfindung.
Welche Vorteile bietet das Poldermodell?
Zu den Vorteilen zählen eine niedrige Arbeitslosenquote, soziale Stabilität durch Einbindung aller Akteure und eine hohe Flexibilität am Arbeitsmarkt (insbesondere durch Teilzeit).
Was sind die Nachteile des Modells?
Kritiker bemängeln die Entstehung eines großen Niedriglohnsektors, die Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse und die langsame Entscheidungsfindung durch den Zwang zum Konsens.
- Citar trabajo
- Master of Education Garima Singh Uttam (Autor), 2015, Wäre das niederländische Poldermodell auf deutsche Verhältnisse übertragbar?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437510