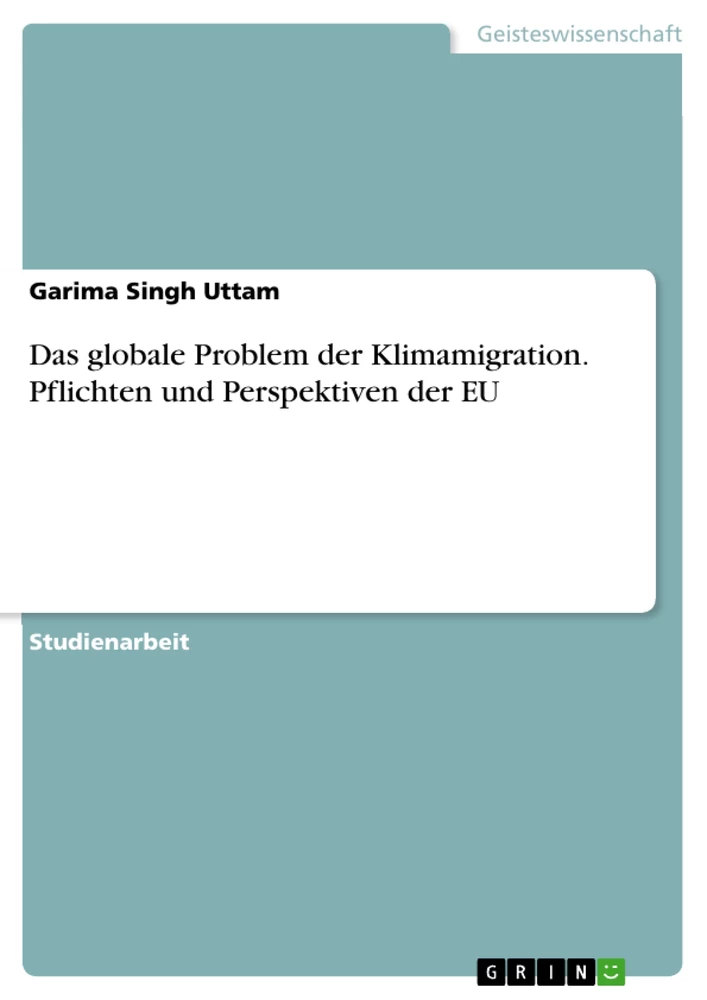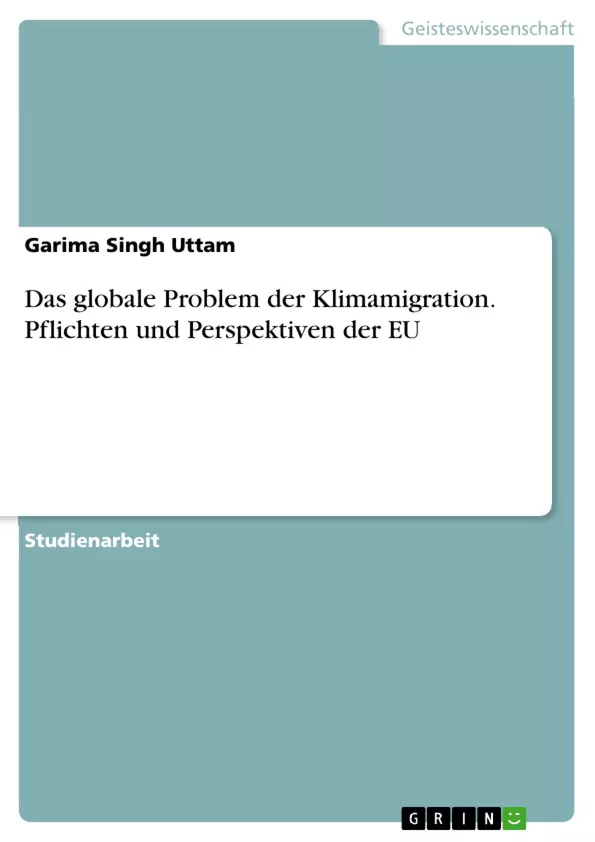Wer wird als „Klimaflüchtling“ anerkannt und wer übernimmt in diesem Zusammenhang welche rechtliche Verantwortung? Hierbei handelt es sich um ein umschweifendes Thema dem bislang noch nicht viel Aufmerksamkeit zukam. Weiterhin ist unklar, wie Klimamigranten und ihr rechtlicher Status einzuteilen sind. Demnach wird in der vorliegenden Hausarbeit folgende Fragestellung betrachtet: Mit welchen rechtlichen Maßnahmen reagiert die europäische Staatengemeinschaft auf das Phänomen der Klimamigration?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Veränderungen des Klimas
- Ursachen und Ablauf
- Gefährdete Gebiete
- Klimaflucht - Problemidentifikation und Begriffsdefinition
- Reaktion auf die Klimaflüchtlinge (Politische Perspektive)
- Europäische Union
- NGO's (Non-governmental organization)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die rechtlichen Maßnahmen, die die Europäische Staatengemeinschaft auf das Phänomen der Klimamigration ergreift. Sie befasst sich mit den Ursachen und Folgen des Klimawandels, beleuchtet die Herausforderungen der Klimaflucht und analysiert die Reaktionen der EU und anderer Akteure.
- Der Klimawandel und seine Folgen für die Umwelt und die menschliche Existenz
- Die Definition und Herausforderungen der Klimaflucht
- Die rechtliche und politische Reaktion der Europäischen Union auf die Klimamigration
- Die Rolle von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) im Umgang mit Klimaflüchtlingen
- Die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit zur Bewältigung der Klimamigration
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Problem der Klimamigration in den Kontext der globalen Flüchtlingssituation dar und erläutert die Bedeutung des Themas. Kapitel 2 beleuchtet die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere auf die betroffenen Regionen. Es analysiert die Faktoren, die die Menschen zur Flucht zwingen und identifiziert die Gebiete, die besonders gefährdet sind. Kapitel 3 geht näher auf die Problematik der Klimaflucht ein und definiert den Begriff. Kapitel 4 analysiert die politischen Reaktionen auf die Klimaflüchtlinge, wobei der Schwerpunkt auf den Maßnahmen der Europäischen Union und dem Engagement von NGOs liegt.
Schlüsselwörter
Klimawandel, Klimamigration, Flüchtlinge, Europäische Union, Rechtliche Maßnahmen, NGOs, Umweltkatastrophen, Gefährdete Gebiete, Internationale Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Wer gilt rechtlich als „Klimaflüchtling“?
Die Arbeit untersucht genau diese Definitionsschwierigkeit, da der rechtliche Status von Klimamigranten international bisher unklar und oft nicht mit dem klassischer Flüchtlinge gleichgesetzt ist.
Wie reagiert die EU auf das Phänomen der Klimamigration?
Die Hausarbeit analysiert die politischen und rechtlichen Maßnahmen, die die europäische Staatengemeinschaft zur Bewältigung der Klimaflucht ergreift.
Welche Rolle spielen NGOs beim Thema Klimamigration?
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sind zentrale Akteure bei der Unterstützung von Betroffenen und der politischen Lobbyarbeit für deren Rechte.
Welche Gebiete sind besonders von Klimaflucht gefährdet?
Die Arbeit identifiziert Regionen, die durch Umweltkatastrophen und den Klimawandel so stark verändert werden, dass die menschliche Existenz dort bedroht ist.
Warum ist internationale Zusammenarbeit bei diesem Thema notwendig?
Da Klimamigration ein globales Problem ist, können nationale Alleingänge die komplexen rechtlichen und humanitären Herausforderungen nicht lösen.
- Quote paper
- Master of Education Garima Singh Uttam (Author), 2017, Das globale Problem der Klimamigration. Pflichten und Perspektiven der EU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437522