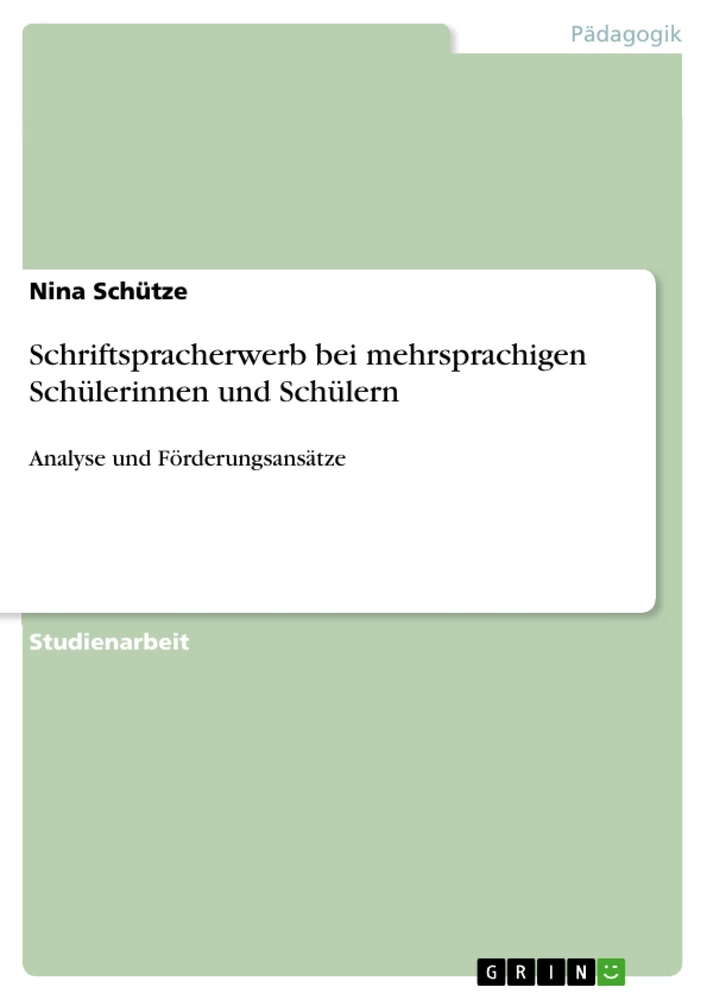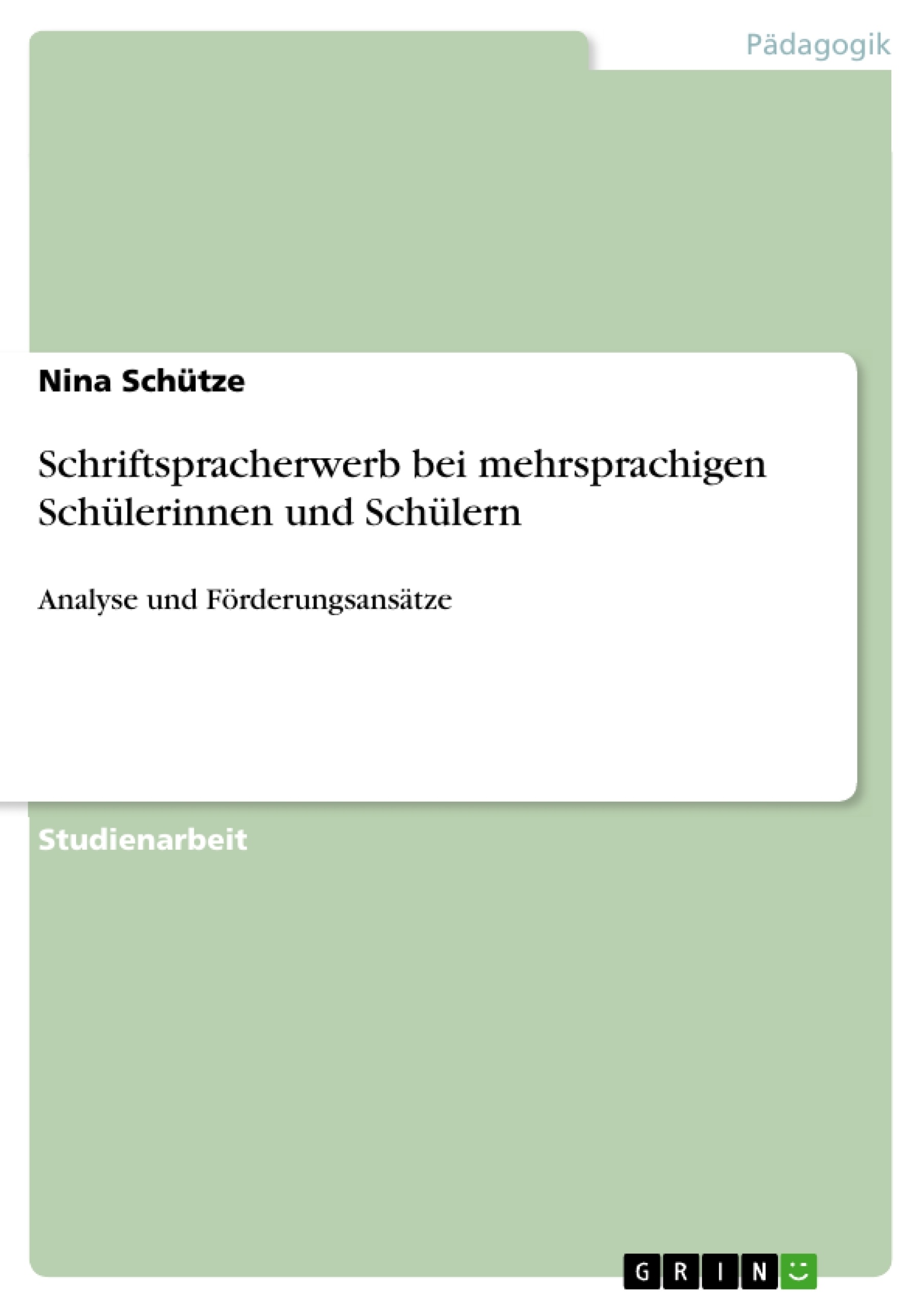Diese Hausarbeit setzt sich mit dem Schriftspracherwerb mehrsprachiger Kinder auseinander. Dabei wird untersucht, welche Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb im Allgemeinen gegeben sein müssen, um dann genauer zu analysieren, welche Besonderheiten im Schriftspracherwerb mehrsprachiger Kinder vorliegen. Zudem wird betrachtet, wie mehrsprachige Kinder im Prozess des Lesen- und Schreibenlernens im Unterricht unterstützt werden können und wie sie ihre Stärken im Unterricht nutzen können. Dies wird auch anhand der Methode des generativen Schreibens nach Gerlind Belke beispielhaft aufgegriffen.
Im Fazit wird abschließend betrachtet, welche Gegebenheiten auf systemischer, aber auch auf schulischer und unterrichtlicher Ebene, gegeben sein sollten, um einen erfolgreichen Schriftspracherwerb mehrsprachiger Schülerinnen und Schüler zu begünstigen und wie die Ressource der Mehrsprachigkeit für die Kinder nutzbar gemacht werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen: Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache und Mehrsprachigkeit
- 2.1 Muttersprache und Erstsprache
- 2.2 Zweitsprache
- 2.3 Fremdsprache
- 2.4 Mehrsprachigkeit
- 3. Kennzeichen und Voraussetzungen des Schriftspracherwerbs
- 3.1 Kennzeichen von Schriftspracherwerb
- 3.2 Voraussetzungen des Schriftspracherwerbs
- 4. Schriftspracherwerb unter der Voraussetzung von Mehrsprachigkeit
- 4.1 Merkmale des Schriftspracherwerbs unter der Voraussetzung von Mehrsprachigkeit
- 4.2 Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb mehrsprachiger Kinder
- 4.3 Positive Effekte der Mehrsprachigkeit auf den Schriftspracherwerb
- 5. Umsetzung des mehrsprachigen Schriftspracherwerbs im Unterricht
- 5.1 Didaktische Prinzipien des mehrsprachigen Schriftspracherwerbs
- 5.2 Beispiel: Generatives Schreiben nach Gerlind Belke
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie Mehrsprachigkeit den Schriftspracherwerb beeinflusst und wie mehrsprachige Kinder im Schriftspracherwerb erfolgreich schulisch unterstützt werden können.
- Definition der Begriffe Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache und Mehrsprachigkeit
- Kennzeichen und Voraussetzungen des Schriftspracherwerbs im Allgemeinen
- Merkmale, Schwierigkeiten und positive Effekte des Schriftspracherwerbs mehrsprachiger Kinder
- Umsetzung des mehrsprachigen Schriftspracherwerbs im Unterricht
- Schlussfolgerungen und ein Ausblick auf die Förderung des Schriftspracherwerbs mehrsprachiger Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung zeigt die Relevanz des Themas anhand von Forschungsergebnissen und Statistiken, die die Herausforderungen für mehrsprachige Kinder im Schriftspracherwerb verdeutlichen. Das zweite Kapitel definiert die wichtigen Begriffe Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache und Mehrsprachigkeit, um eine gemeinsame Grundlage für die weitere Analyse zu schaffen. Das dritte Kapitel beleuchtet die Kennzeichen und Voraussetzungen des Schriftspracherwerbs im Allgemeinen, um den Hintergrund für die Untersuchung des Schriftspracherwerbs mehrsprachiger Kinder zu schaffen. Das vierte Kapitel geht dann auf die Besonderheiten des Schriftspracherwerbs mehrsprachiger Kinder ein, indem es Merkmale, Schwierigkeiten und positive Effekte der Mehrsprachigkeit auf den Schriftspracherwerb beschreibt. Im fünften Kapitel werden didaktische Prinzipien für den mehrsprachigen Schriftspracherwerb im Unterricht vorgestellt und mit einem konkreten Beispiel des generativen Schreibens nach Gerlind Belke veranschaulicht. Das Fazit fasst die wichtigsten Punkte der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf die Förderung des Schriftspracherwerbs mehrsprachiger Kinder in der Schule und im Bildungssystem.
Schlüsselwörter
Schriftspracherwerb, Mehrsprachigkeit, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache, Didaktik, generatives Schreiben, Förderung, Integration, Schule, Bildungssystem
- Quote paper
- Nina Schütze (Author), 2017, Schriftspracherwerb bei mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437524