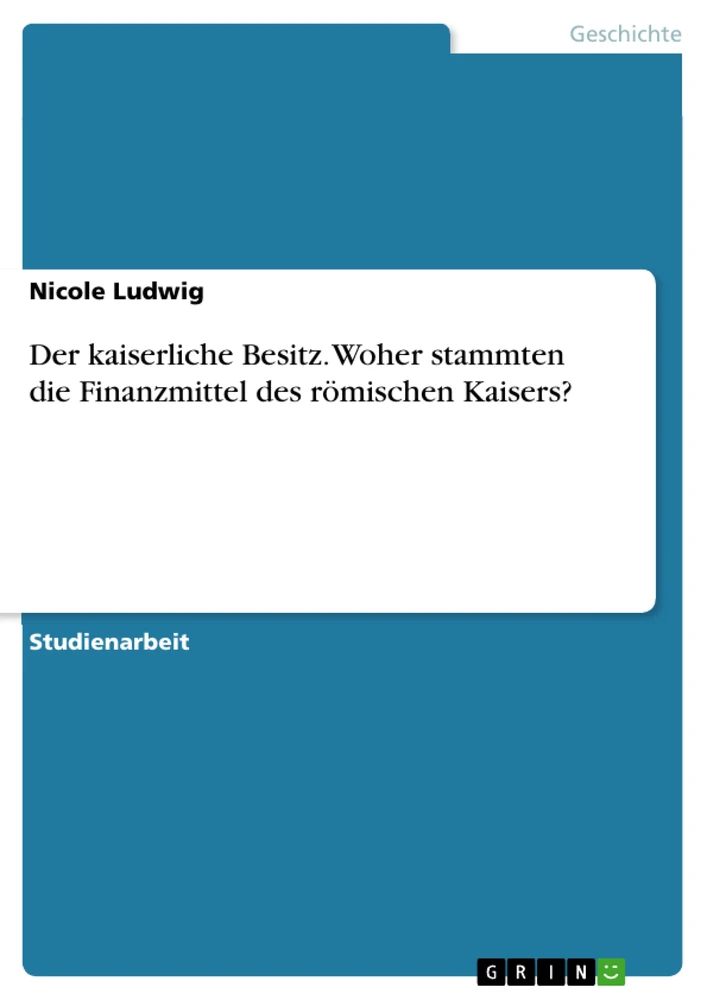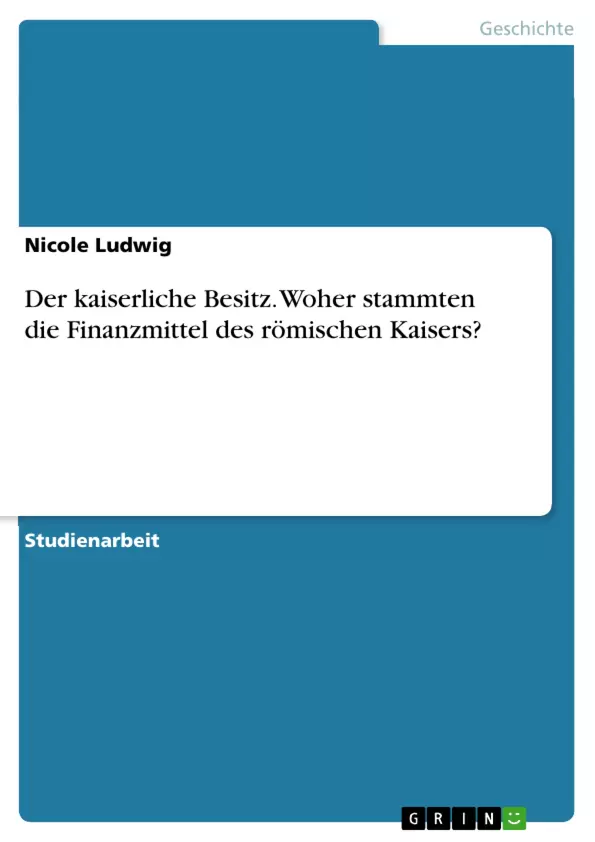Schenkt man Seneca Glauben, so war der gesamte Besitz und somit auch alle Staatsfinanzen im Besitz des jeweils herrschenden Princeps. Doch wenn dies der Fall gewesen wäre, so hätte die Finanznot seines Lehrlings Nero nur schwer zu Stande kommen können. Diese Arbeit beschäftigt sich damit, woher die Finanzmittel römischen Kaiser seit Augustus für die Aufrechterhaltung des Heeres, die kaiserlichen Baumaßnahmen et al. kamen.
Neben der Frage nach den Einkünften sollen die kaiserlichen Ausgaben in Kürze behandelt werden. Insbesondere soll der Fokus jedoch auf dem fiscus liegen. Ebenso spielt es hierbei eine zentrale Rolle, inwiefern der Besitz des Kaisers Privatbesitz der Person oder Exklusivbesitz des Amtes war. Ohne diese offenen Punkte zu beantworten, lassen sich kaiserliche, staatliche und private Einnahmen und Ausgaben nicht trennen. Die heutige Forschung bezieht sich in vielen Punkten auf das 1977 erschienene Buch von
Fergus Millar.
Die Diskussion, ob Millar mit seiner den fiscus betreffenden Hypothese Recht hatte, beschäftigt Historiker bis heute und soll daher auch Gegenstand dieser Betrachtung sein. Doch auch bei Millar findet sich wenig die Einnahmen der Kaiser betreffend. Im Allgemeinen scheint dies ein bislang kaum beachtetes Forschungsgebiet zu sein. Das Fehlen von quantitativ relevanten Forschungsergebnissen mag auch darin begründet sein, dass sich die Quellenlage als sehr dürftig erweist. Längere Berichte oder Auflistungen finden sich bei den herangezogenen Autoren und Quellensammlungen auch über Sekundärliteratur, nicht. Aufgrund dieser Tatsachen wird sich diese Arbeit auf die Erkenntnisse Millars und anderer Autoren stützen. Wenn mit Quellen gearbeitet wurde, so handelt es sich um entsprechend gekennzeichnete Editionen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fiscus
- Entstehungsgeschichte
- Rechtsstatus
- Ausgaben des Kaisers
- Ständige und unregelmäßige Einnahmen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Finanzierung des römischen Kaiserreichs von Augustus bis zur Spätantike. Sie beleuchtet die Einnahmequellen der Kaiser und analysiert die Verwendung der Mittel. Ein zentraler Fokus liegt dabei auf dem fiscus, der kaiserlichen Kasse, und der Frage nach seinem Rechtsstatus und seiner Beziehung zum aerarium, der traditionellen Staatskasse des Senats.
- Die Entstehungsgeschichte und der Rechtsstatus des fiscus
- Die Ausgaben des römischen Kaisers und ihre Finanzierung
- Die verschiedenen Einnahmequellen der Kaiser (Landbesitz, Steuern, etc.)
- Die Unterscheidung zwischen kaiserlichem Privatbesitz und Staatsfinanzen
- Die Rolle von Fergus Millar's Werk in der aktuellen Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Finanzmitteln der römischen Kaiser dar und verweist auf die widersprüchlichen Angaben in den Quellen. Sie betont die Schwierigkeit, kaiserliche, staatliche und private Einnahmen und Ausgaben zu trennen und die Bedeutung des fiscus in diesem Zusammenhang. Die Arbeit stützt sich auf die Erkenntnisse von Fergus Millar und anderen Autoren, wobei die spärliche Quellenlage hervorgehoben wird.
Fiscus: Dieses Kapitel beschreibt den fiscus als die kaiserliche Kasse, die im Laufe der Zeit zur wichtigsten römischen Staatskasse wurde. Es wird die zentrale Frage nach dem Unterschied zwischen fiscus, patrimonium und aerarium aufgeworfen, deren Klärung essentiell für das Verständnis der kaiserlichen Finanzen ist. Die Diskussion umfasst die unterschiedlichen Interpretationen des fiscus als Privatkasse des Kaisers oder als Staatskasse.
Ausgaben des Kaisers: Dieses Kapitel würde im vollständigen Text die Ausgaben des Kaisers detailliert behandeln, einschließlich laufender Kosten, Bautätigkeiten und Geschenke. Es würde die verschiedenen Ausgabenposten analysieren und ihren Anteil an den Gesamtausgaben erläutern. Die Quelle und der Umfang der Mittel für diese Ausgaben würden ebenfalls im Detail behandelt werden.
Ständige und unregelmäßige Einnahmen: Dieses Kapitel würde die verschiedenen Einnahmequellen der römischen Kaiser auflisten und analysieren, beispielsweise Landbesitz, Bergwerke, Handel, Steuern, Geschenke, Prozesse, Konfiskationen, Erbschaften und Kriegsbeute. Es würde die Bedeutung der einzelnen Einnahmequellen im Kontext der Gesamtfinanzierung des Kaiserreichs bewerten und deren Entwicklung im Zeitverlauf darstellen. Die relative Bedeutung der einzelnen Quellen im Verhältnis zueinander würde ebenfalls diskutiert werden.
Schlüsselwörter
Römischer Kaiser, Fiscus, Aerarium, Patrimonium Caesaris, Staatsfinanzen, Kaiserliche Ausgaben, Einnahmequellen, Augustus, Fergus Millar, Rechtsstatus, antike Geschichte, Römisches Reich.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Finanzierung des Römischen Kaiserreichs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Finanzierung des römischen Kaiserreichs von Augustus bis zur Spätantike. Sie beleuchtet die Einnahmequellen der Kaiser und analysiert die Verwendung der Mittel, wobei ein besonderer Fokus auf dem fiscus, der kaiserlichen Kasse, liegt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehungsgeschichte und den Rechtsstatus des fiscus, die Ausgaben des römischen Kaisers und deren Finanzierung, die verschiedenen Einnahmequellen (Landbesitz, Steuern etc.), die Unterscheidung zwischen kaiserlichem Privatbesitz und Staatsfinanzen und die Rolle von Fergus Millars Werk in der aktuellen Forschung.
Was ist der fiscus und welche Bedeutung hat er?
Der fiscus war die kaiserliche Kasse, die im Laufe der Zeit zur wichtigsten römischen Staatskasse wurde. Ein zentrales Thema ist die Abgrenzung des fiscus zum aerarium (Senatskasse) und zum patrimonium (kaiserlicher Privatbesitz). Die Arbeit diskutiert unterschiedliche Interpretationen des fiscus als Privat- oder Staatskasse.
Welche Einnahmequellen werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert verschiedene Einnahmequellen der römischen Kaiser, darunter Landbesitz, Bergwerke, Handel, Steuern, Geschenke, Prozesse, Konfiskationen, Erbschaften und Kriegsbeute. Die relative Bedeutung der einzelnen Quellen im Verhältnis zueinander und deren Entwicklung im Zeitverlauf werden diskutiert.
Wie werden die Ausgaben des Kaisers behandelt?
Die Ausgaben des Kaisers werden detailliert behandelt, einschließlich laufender Kosten, Bautätigkeiten und Geschenke. Die Analyse umfasst die verschiedenen Ausgabenposten, ihren Anteil an den Gesamtausgaben und die Quellen der dafür verwendeten Mittel.
Welche Rolle spielt Fergus Millar?
Die Arbeit stützt sich auf die Erkenntnisse von Fergus Millar und anderen Autoren, wobei die spärliche Quellenlage hervorgehoben wird. Die Bedeutung von Millars Werk für die aktuelle Forschung wird explizit thematisiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung, zum Fiscus, zu den Ausgaben des Kaisers, zu den ständigen und unregelmäßigen Einnahmen und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Römischer Kaiser, Fiscus, Aerarium, Patrimonium Caesaris, Staatsfinanzen, Kaiserliche Ausgaben, Einnahmequellen, Augustus, Fergus Millar, Rechtsstatus, antike Geschichte, Römisches Reich.
Wo finde ich weitere Informationen?
(Hier könnte ein Link zur vollständigen Arbeit eingefügt werden, falls verfügbar.)
- Citation du texte
- Nicole Ludwig (Auteur), 2015, Der kaiserliche Besitz. Woher stammten die Finanzmittel des römischen Kaisers?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437553