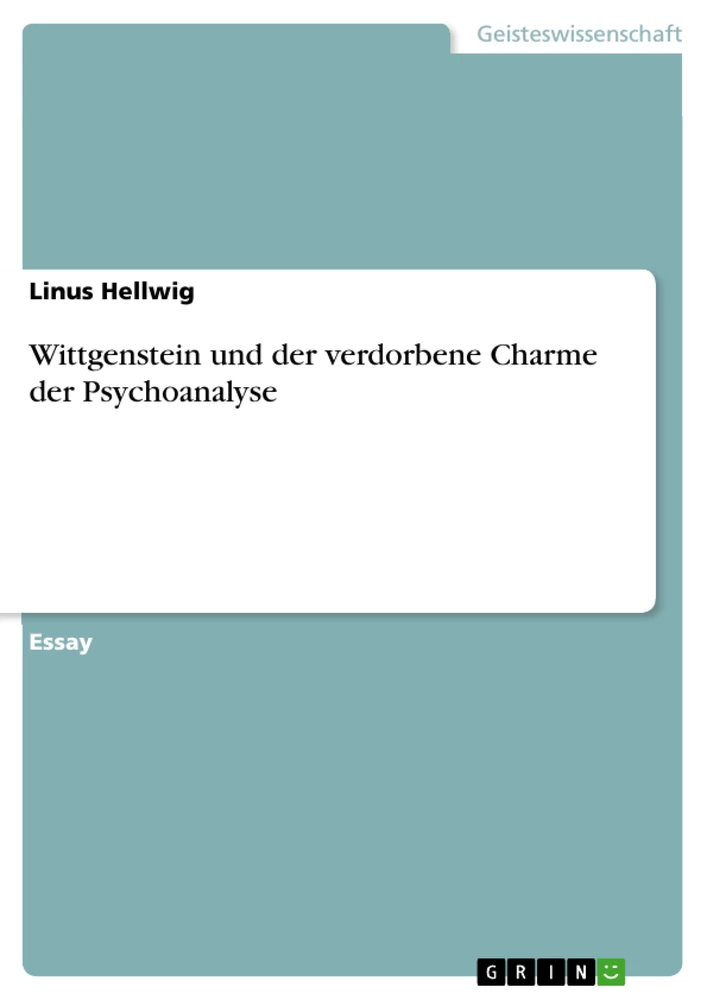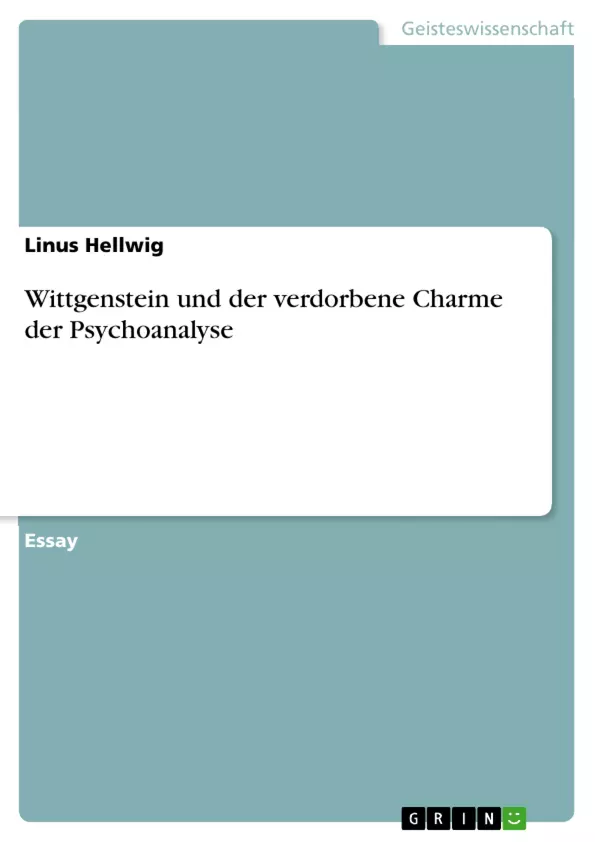Wittgenstein hat spätestens 1919 damit begonnen, sich mit Œuvre Sigmund Freuds vertraut zu machen. So lassen sich auch in den 1938 gehaltenen Vorlesungen über Ästhetik neben einer eher generalisierenden Darstellung psychoanalytischer Ansätze und Methoden ebenfalls explizite Bezüge zu dem Freud’schen Opus magnum der Traumdeutung (vordotiert auf 1900) und der kleineren Abhandlung über den Witz und seine Beziehung zum Unbewussten (1905) ausfindig machen. In jenen Vorlesungen scheint Wittgenstein den Theorien Freuds gegenüber eine vordergründig distanziert-kritische Haltung einzunehmen. Daraus allerdings auf eine allgemeine Aversion gegen die Psychoanalyse zu schließen, würde zu kurz greifen. Dass dieses Verhältnis von einer schwer zu bestimmenden Ambivalenz geprägt ist, deren Grundlinien sich mit den Jahren immer wieder verschoben haben, davon gibt eine Bemerkung Rus Rhees Auskunft, die er seinen Aufzeichnungen der Gespräche mit Wittgenstein über Freud vorangestellt hat:
„Er sprach zum Zeitpunkt dieser Diskussionen [zwischen 1942 und 1946] von sich als einem ‚Schüler Freuds‘ und ‚Anhänger Freuds‘. Er bewunderte Freud wegen der Beobachtungen und Anregungen in seinen Schriften; dafür, ‚etwas zu sagen zu haben‘, selbst da, wo er nach Wittgensteins Ansicht falsch lag. Auf der anderen Seite hielt er den enormen Einfluß der Psychoanalyse in Europa und Amerika für schädlich […].
Das, was Freud Wittgenstein zu sagen hatte, betraf ihn sowohl in seinen philosophischen Bemühungen, als auch in seiner Person. Die psychoanalytische Therapie hatte für Wittgenstein, wenigstens in den dreißiger Jahren, eine Art Vorbildcharakter für seine Therapie der sprachlichen Verwirrungen und in den Vermischten Bemerkungen lassen sich Notizen finden, die auf ein Gefühl der persönlichen Verbundenheit mit Freud hinweisen. Etwa dort wo Wittgenstein sich und Freud „eine Originalität des Bodens und nicht des Samens“ attestiert, durch den die Gedanken eines Anderen (im Falle Freuds die, seines ehemaligen Mentors Josef Breuers) in einer genuinen Form weiterentwickelt werden.
Ich möchte zeigen, was sich aus Sicht eines Psychoanalytikers darauf zu erwidern ließe, um so einen dialogischen Zugang für das Aufeinandertreffen der Gedankensphären Wittgensteins und Freuds zu eröffnen. Nebenbei werde ich damit auch eine kurze Einführung in die Theorien Freuds zur Ästhetik bieten, die immerhin auch im rezenten Diskurs zur Ästhetik von Relevanz sind.
Inhaltsverzeichnis
- Wittgenstein und der verdorbene Charme der Psychoanalyse
- Wittgensteins Kritik an der Psychoanalyse
- Die ästhetische Dimension der Psychoanalyse
- Der Charme des Verdorbenen und des Kontraintuitiven
- Die Psychoanalyse als Kunstwerk: Freud's ästhetische Theorie
- Der Charme der Psychoanalyse und die Identifikation mit dem Patienten
- Die Ambivalenz des Charmes: Verdorbenes und Kontraintuitives
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text beleuchtet die komplexe Beziehung zwischen Wittgenstein und der Psychoanalyse. Er analysiert Wittgensteins Kritik an Freud's Theorien und erörtert, wie die Psychoanalyse aus ästhetischer Perspektive betrachtet werden kann. Insbesondere wird der besondere Reiz der psychoanalytischen Erklärungen untersucht, der sich mit dem Charme des Verdorbenen und des Kontraintuitiven beschreiben lässt.
- Wittgensteins Kritik an der Psychoanalyse
- Die ästhetische Dimension der Psychoanalyse
- Der Charme des Verdorbenen und des Kontraintuitiven
- Freud's ästhetische Theorie und die Wirkung von Kunst
- Die Identifikation des Patienten mit den Deutungsangeboten der Psychoanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel stellt die Beziehung zwischen Wittgenstein und Freud vor und untersucht die Ambivalenz ihrer Beziehung.
- Das zweite Kapitel analysiert Wittgensteins Kritik an der Psychoanalyse und benennt vier Anreize der psychoanalytischen Deutung, die deren Überzeugungskraft begründen.
- Das dritte Kapitel widmet sich der ästhetischen Dimension der Psychoanalyse und zeigt, wie sich der Charme der Psychoanalyse mit der Ästhetik verbinden lässt.
- Das vierte Kapitel beleuchtet den Charme des Verdorbenen und des Kontraintuitiven in der Psychoanalyse und erläutert, wie diese Aspekte die Faszination der psychoanalytischen Theorie ausmachen.
- Das fünfte Kapitel präsentiert Freud's ästhetische Theorie und beleuchtet den Mechanismus der Kunstwirkung, der sich auch auf die Wirkung der Psychoanalyse anwenden lässt.
- Das sechste Kapitel zeigt, wie sich die Akzeptanz des Patienten für die Erklärungen und Deutungsangebote der Psychoanalyse durch den Charme des Verdorbenen und des Kontraintuitiven erklären lässt.
Schlüsselwörter
Wittgenstein, Freud, Psychoanalyse, Ästhetik, Charme, Verdorbenes, Kontraintuitives, Kunst, Triebsphäre, Unbewusstes, Sublimierung, Identifikation, Vorlust, Verdrängung, Katharsis.
- Citar trabajo
- Linus Hellwig (Autor), 2018, Wittgenstein und der verdorbene Charme der Psychoanalyse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437602