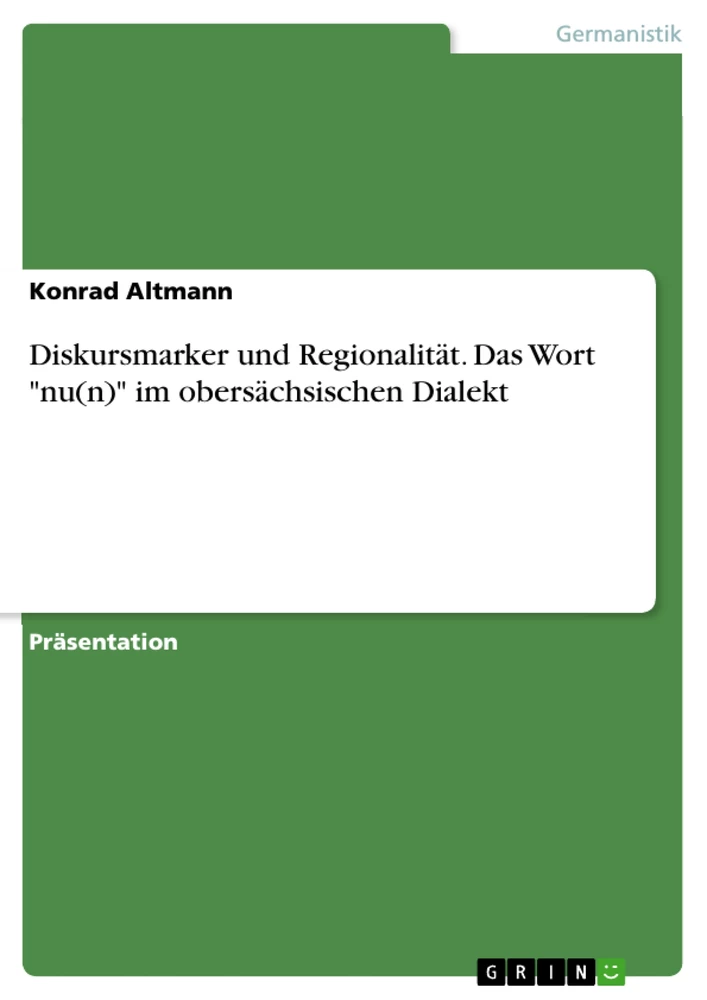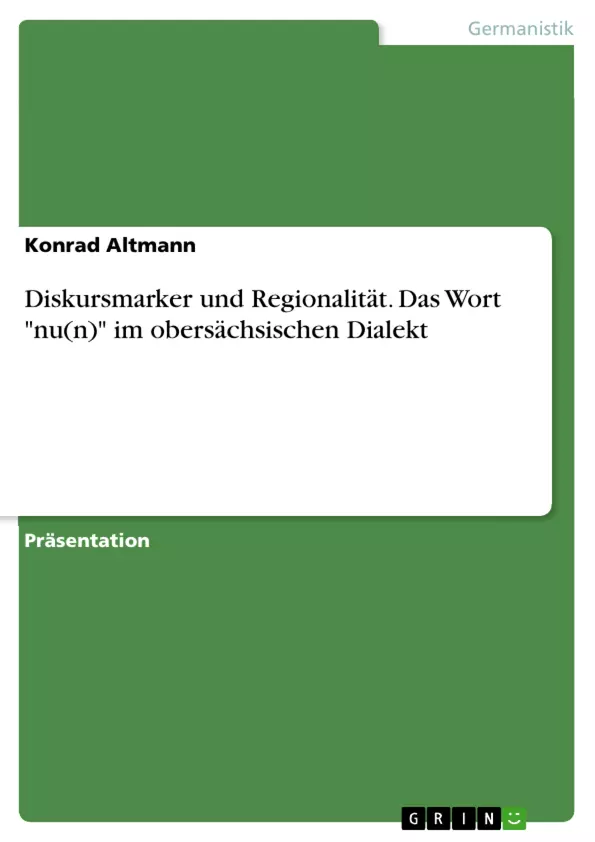Auf Grundlage von Peter Auers Forschungen zu dem Wort "nu(n)" im obersächsischen Dialekt (2016) wurde ein Vortrag im Rahmen eines Diskursmarker-Seminars abgehalten. Dies hier ist die zugehörige Präsentation.
Inhaltsverzeichnis
- Diskursmarker und Regionalität
- Das Wort „Nu(n)“ im Obersächsischen Dialekt
- Zur Verwendung als Diskursmarker im obersächsischen Dialekt
- Fazit, Kritik und mögliche Anschlussfragen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Verwendung des Wortes „Nu(n)“ im obersächsischen Dialekt, insbesondere seine Funktion als Diskursmarker. Ziel ist es, den Gebrauch von „Nu(n)“ im Vergleich zur Standardsprache zu analysieren und seine regionale Besonderheit herauszustellen.
- Die Entwicklung des Wortes „Nu(n)“ von seiner deiktischen Ursprungsform bis zu seiner heutigen Verwendung.
- Der Vergleich des Gebrauchs von „Nu(n)“ als Diskursmarker im Obersächsischen mit dem Gebrauch in der Standardsprache.
- Die spezifischen Funktionen von „Nu(n)“ als Diskursmarker im Obersächsischen Dialekt (z.B. Zustimmung, Einleitung eines Redebeitrags).
- Die Analyse des von Auer (2016) verwendeten Korpus und dessen Limitationen.
- Offene Fragen zu weiteren Funktionen von „Nu(n)“ als Diskursmarker im Obersächsischen.
Zusammenfassung der Kapitel
Diskursmarker und Regionalität: Dieses einleitende Kapitel führt in die Thematik der regionalen Variationen von Diskursmarkern ein und legt den Fokus auf die Untersuchung des Wortes „Nu(n)“ im obersächsischen Dialekt. Es bildet den Rahmen für die anschließende detaillierte Analyse.
Das Wort „Nu(n)“ im Obersächsischen Dialekt: Dieses Kapitel beleuchtet die etymologische Entwicklung des Wortes „Nu(n)“, beginnend mit seiner deiktischen Ursprungsform /nu:/ in den germanischen Sprachen. Es wird die Entwicklung vom adverbialen Gebrauch hin zur Verwendung als Diskursmarker nachgezeichnet und anhand von Beispielen aus dem Mittelhochdeutschen illustriert. Besonderes Augenmerk liegt auf der Veränderung der Form von /nu:/ zu /nu:n/ und der heutigen Klassifizierung als Adverb, Modalpartikel und Diskursmarker. Der Fokus liegt auf der Verbreitung des Wortes, insbesondere seiner starken Präsenz im ostobersächsischen Dialekt, wo die Form /nu:/ häufig verwendet wird, und der damit verbundenen Stereotypisierung der Sprache dieser Region, besonders im Zusammenhang mit Dresden. Das Kapitel führt zudem die Studie von Auer (2016) und den verwendeten Korpus ein, der aus informellen Interviews mit Sprechern des Dresdner Dialekts besteht, unterteilt in zwei Subkorpora mit unterschiedlichen Sprechergruppen und Themenschwerpunkten. Die Kapitelstruktur legt den Grundstein für die tiefergehende Auseinandersetzung mit der Verwendung von „Nu(n)“ als Diskursmarker im folgenden Abschnitt.
Zur Verwendung als Diskursmarker im obersächsischen Dialekt: Dieses Kapitel analysiert den Gebrauch von „Nu(n)“ als Diskursmarker im obersächsischen Dialekt. Es beschreibt verschiedene Positionen im Satz, wobei die alleinstehende Verwendung im Gegensatz zur Standardsprache hervorgehoben wird. Die Funktion als Ausdruck von Zustimmung wird detailliert erläutert und anhand von Beispielen aus dem Korpus von Auer (2016) illustriert. Der Vergleich mit der Verwendung im Vor-Vorfeld in der Standardsprache (wo oft „na“ verwendet wird) wird gezogen und die spezifische Funktion von „Nu(n)“ als Beurteilung vorangegangener Äußerungen wird diskutiert. Ein konkretes Beispiel aus dem Korpus veranschaulicht die Funktion von „Nu(n)“ zur Trennung eines metaphorischen Zustands von dessen moralischer Bewertung.
Fazit, Kritik und mögliche Anschlussfragen: Das abschließende Kapitel fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und konzentriert sich auf die dominierende Funktion von /nu:/ als alleinstehender Diskursmarker zur Bestätigung bereits bekannter Informationen im obersächsischen Dialekt. Es werden weitere, im Vortrag erwähnte, Verwendungsmöglichkeiten kurz angerissen. Kritische Anmerkungen zu Auers Studie beziehen sich hauptsächlich auf die Korpuszusammensetzung, die überwiegend aus langen Erzählungen und weniger aus dialogischen Gesprächen besteht. Diese Einschränkung wird als Ausgangspunkt für weiterführende Forschungsfragen genutzt, die sich mit der Existenz und der genaueren Bestimmung weiterer Funktionen von /nu:/ als Diskursmarker im Obersächsischen befassen.
Schlüsselwörter
Diskursmarker, Regionalität, Obersächsisch, Dialekt, „Nu(n)“, /nu:/, /nu:n/, Auer (2016), Standardsprache, deiktisch, Modalpartikel, Korpusanalyse, sprachliches Stereotyp.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Diskursmarker und Regionalität: Das Wort „Nu(n)“ im Obersächsischen Dialekt"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Verwendung des Wortes „Nu(n)“ (phonetisch /nu:/ und /nu:n/) im obersächsischen Dialekt, insbesondere seine Funktion als Diskursmarker. Der Fokus liegt auf dem Vergleich zum Gebrauch in der Standardsprache und der Herausstellung regionaler Besonderheiten.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung von „Nu(n)“ von seiner deiktischen Ursprungsform bis zur heutigen Verwendung. Sie vergleicht den Gebrauch als Diskursmarker im Obersächsischen mit der Standardsprache, beschreibt spezifische Funktionen (z.B. Zustimmung, Redebeitrags-Einleitung) und untersucht Limitationen des von Auer (2016) verwendeten Korpus. Offene Fragen zu weiteren Funktionen von „Nu(n)“ werden ebenfalls aufgeworfen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel "Diskursmarker und Regionalität" (Einleitung), "Das Wort „Nu(n)“ im Obersächsischen Dialekt" (etymologische Entwicklung und Korpusbeschreibung), "Zur Verwendung als Diskursmarker im obersächsischen Dialekt" (Analyse der Funktionen) und "Fazit, Kritik und mögliche Anschlussfragen" (Zusammenfassung, Kritik an Auer's Studie und Forschungsfragen).
Wie wird die etymologische Entwicklung von „Nu(n)“ behandelt?
Das Kapitel zur etymologischen Entwicklung beschreibt die Entwicklung von der deiktischen Ursprungsform /nu:/ in den germanischen Sprachen über den adverbialen Gebrauch bis hin zur Verwendung als Diskursmarker. Die Formveränderung von /nu:/ zu /nu:n/ und die heutige Klassifizierung als Adverb, Modalpartikel und Diskursmarker werden detailliert dargestellt.
Welche Rolle spielt der Korpus von Auer (2016)?
Der Korpus von Auer (2016), bestehend aus informellen Interviews mit Dresdner Dialektsprechern, bildet die Grundlage der Analyse. Die Arbeit beschreibt den Korpus und seine Limitationen, insbesondere die Überwiegend aus langen Erzählungen und weniger aus dialogischen Gesprächen bestehende Korpuszusammensetzung.
Welche Funktionen von „Nu(n)“ als Diskursmarker werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die Funktion von „Nu(n)“ als Ausdruck der Zustimmung und seine Verwendung zur Trennung eines metaphorischen Zustands von dessen moralischer Bewertung. Die alleinstehende Verwendung im Gegensatz zur Standardsprache wird hervorgehoben, ebenso der Vergleich mit der Verwendung im Vor-Vorfeld in der Standardsprache (oft mit „na“).
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass /nu:/ im Obersächsischen vorwiegend als alleinstehender Diskursmarker zur Bestätigung bekannter Informationen dient. Die Kritik an Auers Studie fokussiert auf die Korpuszusammensetzung, die weitere Forschungsfragen bezüglich weiterer Funktionen von /nu:/ als Diskursmarker im Obersächsischen aufwirft.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Diskursmarker, Regionalität, Obersächsisch, Dialekt, „Nu(n)“, /nu:/, /nu:n/, Auer (2016), Standardsprache, deiktisch, Modalpartikel, Korpusanalyse, sprachliches Stereotyp.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Konrad Altmann (Author), 2018, Diskursmarker und Regionalität. Das Wort "nu(n)" im obersächsischen Dialekt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437611