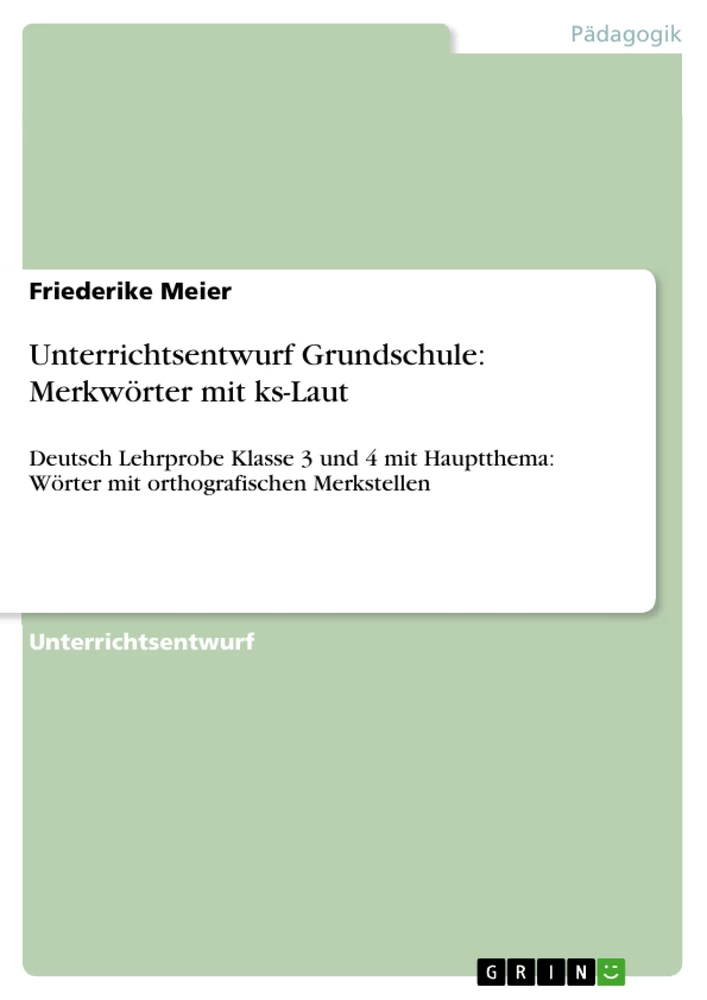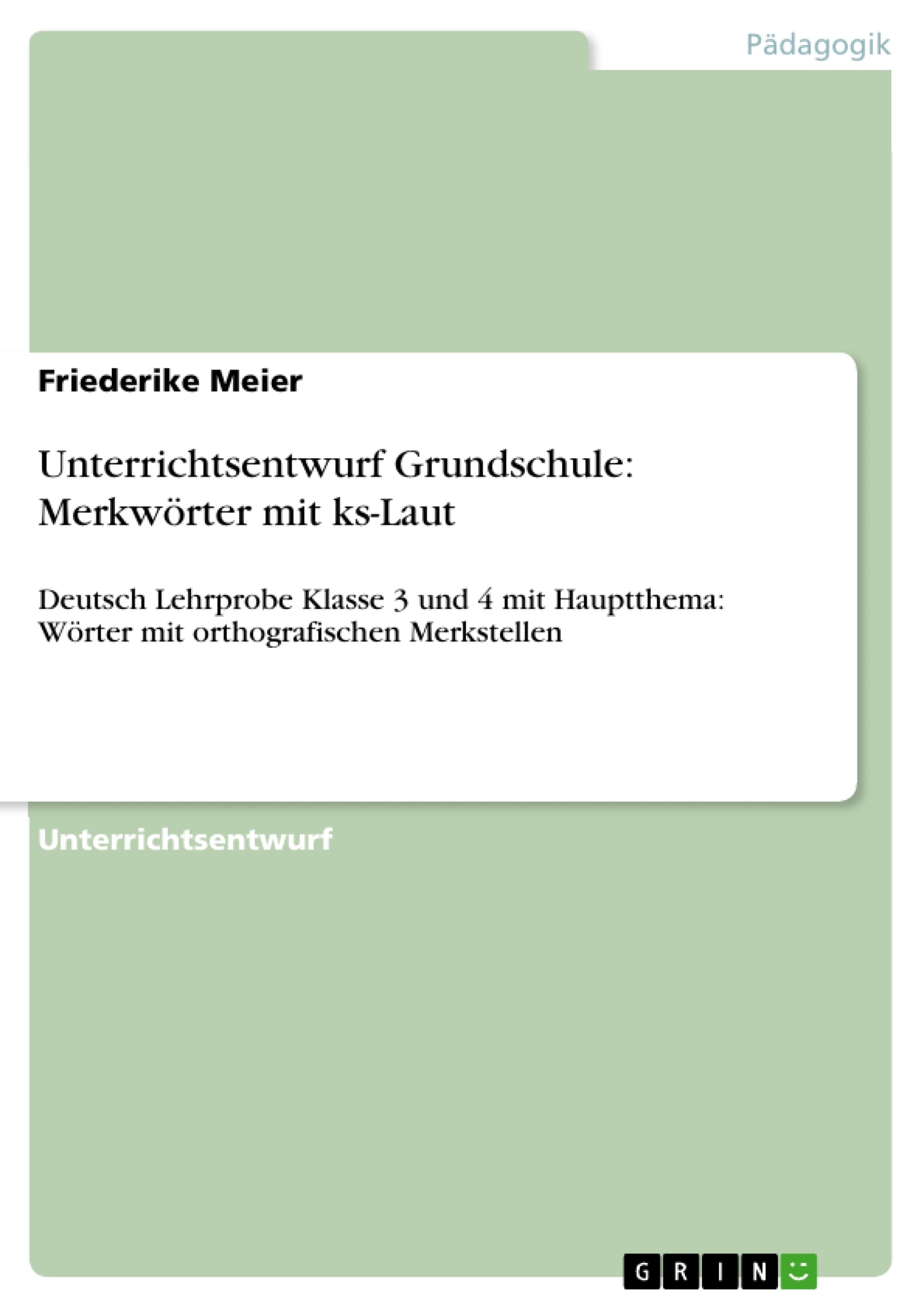Die Schüler und Schülerinnen (fortan SuS) der Evangelischen Grundschule in Xxxx lernen in jahrgangsgemischten Gruppen. Die insgesamt 14 SuS der Klasse 3/4 setzen sich so aus neun Drittklässlern und fünf Viertklässlern zusammen. Der Unterricht erfolgt in allen Fächern gemeinsam und differenziert. In der Klasse 3/4 werden wöchentlich zwei Fachstunden in Deutsch erteilt, zusätzlich üben die SuS morgens täglich circa eine Schulstunde individuell zu Themen des Deutschunterrichts im Rahmen der Täglichen Übung und der Freiarbeit. Die SuS sind mir seit Oktober 2015 durch ein Praktikum und einer Vertretung im Hortbereich bekannt. Im September 2017 übernahm ich vertretend die Klassenleitung bis zum Februar 2018, innerhalb der ich auch den Deutschunterricht übernahm. Die Klassenleitung trat anschließend erneut meine Mentorin Xxxx an.
Bedingt durch den reformpädagogischen Ansatz der Schule weisen alle SuS eine hohe Selbstständigkeit auf. In den Phasen der Täglichen Übung und der Freiarbeit üben die SuS täglich die selbstständige Einschätzung und Auswahl passender Übungsmaterialien, deren Aneignung und Kontrolle der eigenen Ergebnisse. Diese Kompetenz nutzen SuS auch im Fachunterricht, in denen sich Phasen des selbstständigen Lernens und des Frontalunterrichts abwechseln. Bei Problemen oder Fragen greifen die SuS oft zur Hilfe untereinander, welche durch jahrgangsgemischte Gruppe vor allem für die Drittklässler von Nutzen ist. Gruppen- und Partnerarbeit werden von den meisten SuS geschätzt, problematisch ist jedoch oft die Gruppenfindung selbst. In der Klasse 3/4 gab es im Schuljahr 17/18 starke Probleme innerhalb des Klassengefüges, welche auch das Unterrichtsgeschehen beeinflussten, vor allem im Hinblick auf Partner- und Gruppenarbeit. Die SuS nehmen vom Lehrer bestimmte Partner und Gruppen seit dem eher an. Einige Schüler bevorzugen zudem Einzelarbeit.
Im Bereich der Rechtschreibung sind den SuS bereits die meisten Rechtschreibregeln und Sonderfälle bekannt, da diese als Teil einer Rechtschreibwerkstatt und der Täglichen Übung selbstständig und im Einzelnen im Fachunterricht durch den Lehrer vermittelt wurden. Im gemeinsamen Formulieren von Merksätzen im Fachunterricht sind die meisten SuS geübt. Das Rätseln und Knobeln als Übungsform ist ihnen besonders aus der Täglichen Übung und der Freiarbeit bekannt. Das Spiel als Form der Übung und Sicherung ist oft Teil des Fachunterrichts und der Freiarbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Bedingungsanalyse
- 1.1. Bedingungen der Lerngruppe
- 1.2. Besonderheiten einzelner Schüler
- 1.3. Schulische Bedingungen
- 2. Sachanalyse
- 3. Didaktische Analyse
- 3.1. Einordnung der Unterrichtsstunde in die Einheit
- 3.2. Legitimation
- 3.3. Didaktische Reduktion
- 3.4. Gegenwartsbedeutung
- 3.5. Zukunftsbedeutung
- 3.6. Exemplarische Bedeutung
- 3.7. Didaktische Struktur
- 4. Lernzielformulierung
- 5. Methodische Analyse
- 6. Tabellarischer Verlaufsplan
- 7. Anhang
- 8. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert eine Unterrichtsstunde zum Thema "Der ks-Laut" in einer jahrgangsgemischten Klasse 3/4. Ziel ist es, die Bedingungen der Lerngruppe, die didaktische Planung und die methodische Umsetzung der Stunde detailliert zu beschreiben und zu reflektieren. Die Analyse umfasst die Bedingungsanalyse der Lerngruppe mit ihren individuellen Stärken und Schwächen, die sachliche Analyse des Themas, und die didaktische Planung und Umsetzung der Stunde.
- Heterogenität der Lerngruppe und deren Auswirkungen auf den Unterricht
- Didaktische und methodische Gestaltung des Unterrichts zur Förderung des Rechtschreiblernens
- Analyse der individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler
- Differenzierung im Unterricht
- Förderung der Selbstständigkeit der Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
1. Bedingungsanalyse: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Bedingungen der Lerngruppe, bestehend aus 14 Schülern der Klassen 3 und 4 einer Evangelischen Grundschule. Es wird auf die jahrgangsgemischte Zusammensetzung, die Heterogenität der Lernvoraussetzungen und die individuellen Stärken und Schwächen der Schüler eingegangen. Besondere Aufmerksamkeit wird den Problemen im Klassengefüge und den daraus resultierenden Schwierigkeiten bei der Gruppenarbeit gewidmet. Die bisherigen Erfahrungen der Schüler im Rechtschreibunterricht, die Selbstständigkeit im Lernen und die Vorlieben für verschiedene Arbeitsformen (Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit) werden ebenfalls analysiert. Die Beschreibung der einzelnen Schüler umfasst ihre Leistungsfähigkeit in Deutsch, ihre Mitarbeit im Unterricht und ihre spezifischen Schwierigkeiten im Rechtschreiben und Lesen. Die Analyse legt den Grundstein für die didaktische Planung der Unterrichtsstunde.
Schlüsselwörter
Jahrgangsgemischte Klasse, Rechtschreibung, ks-Laut, Didaktische Analyse, Methodische Analyse, Differenzierung, Lernvoraussetzungen, Heterogenität, Selbstständigkeit, Rechtschreibfehler, Individuelle Förderung.
Häufig gestellte Fragen zur Unterrichtsanalyse: "Der ks-Laut"
Was ist der Inhalt dieser Unterrichtsanalyse?
Die Analyse beschreibt detailliert eine Unterrichtsstunde zum Thema "Der ks-Laut" in einer jahrgangsgemischten Klasse 3/4. Sie beinhaltet eine Bedingungsanalyse der Lerngruppe, eine Sachanalyse des Themas, eine didaktische und methodische Analyse der Unterrichtsplanung und -durchführung sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Aspekte werden in der Bedingungsanalyse behandelt?
Die Bedingungsanalyse umfasst die Lerngruppe (14 Schüler der Klassen 3 und 4), die Heterogenität der Lernvoraussetzungen, individuelle Stärken und Schwächen der Schüler, Probleme im Klassengefüge, Erfahrungen im Rechtschreibunterricht, Selbstständigkeit im Lernen und Vorlieben für verschiedene Arbeitsformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit). Die Leistungsfähigkeit in Deutsch, die Mitarbeit im Unterricht und spezifische Schwierigkeiten im Rechtschreiben und Lesen einzelner Schüler werden ebenfalls analysiert.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Analyse behandelt?
Die Analyse konzentriert sich auf die Heterogenität der Lerngruppe und deren Auswirkungen auf den Unterricht, die didaktische und methodische Gestaltung des Unterrichts zur Förderung des Rechtschreiblernens, die Analyse der individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler, die Differenzierung im Unterricht und die Förderung der Selbstständigkeit der Schüler.
Wie ist die Analyse strukturiert?
Die Analyse ist in verschiedene Kapitel gegliedert: Bedingungsanalyse, Sachanalyse, Didaktische Analyse (Einordnung, Legitimation, Reduktion, Gegenwarts-/Zukunftsbedeutung, exemplarische Bedeutung, didaktische Struktur), Lernzielformulierung, Methodische Analyse, tabellarischer Verlaufsplan, Anhang und Literaturverzeichnis. Ein Inhaltsverzeichnis gibt einen detaillierten Überblick.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Analyse am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Jahrgangsgemischte Klasse, Rechtschreibung, ks-Laut, Didaktische Analyse, Methodische Analyse, Differenzierung, Lernvoraussetzungen, Heterogenität, Selbstständigkeit, Rechtschreibfehler, Individuelle Förderung.
Welches Ziel verfolgt die Unterrichtsanalyse?
Ziel der Arbeit ist es, die Bedingungen der Lerngruppe, die didaktische Planung und die methodische Umsetzung der Stunde zum Thema "Der ks-Laut" detailliert zu beschreiben und zu reflektieren.
Für wen ist diese Analyse gedacht?
Diese Analyse ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Unterrichtsmethoden und -inhalten. Sie ist insbesondere für Lehramtsstudierende und Lehrerinnen und Lehrer relevant.
- Quote paper
- Friederike Meier (Author), 2018, Unterrichtsentwurf Grundschule: Merkwörter mit ks-Laut, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437620