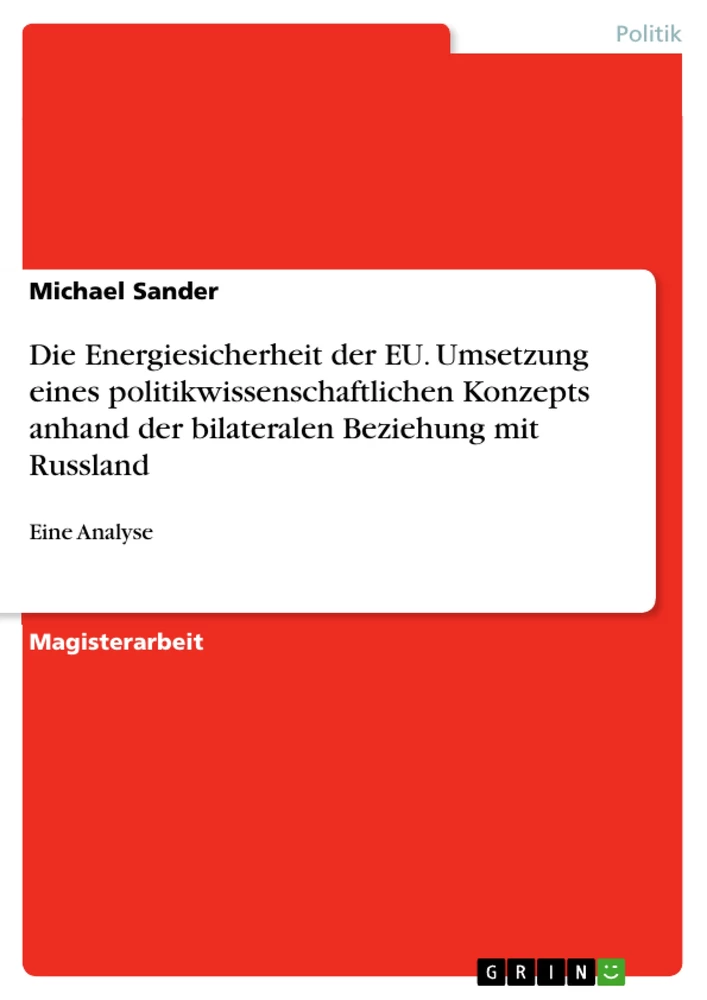Die Energiebeziehungen zwischen der Russischen Föderation (RF) und der Europäischen Union (EU) zeichnen sich durch ein hohes Maß ökonomischer Kontakte bei gleichzeitig geringer politischer Institutionalisierung aus.
Die vorliegende Arbeit geht den Gründen für diesen Befund nach. Dabei verwendet sie die rationale Verhandlungstheorie von Andrew Moravcsik, die Verhandlungsprozesse anhand eines Drei-Stufen-Modells analysiert. Die Stufen sind:
1. Innerstaatliche Präferenzbildung
2. Internationale Verhandlungsprozesse
3. Institutionalisierung der Verhandlungsergebnisse
Anhand dieses Modells werden folgende Thesen aufgestellt, die den geringen Institutionalisierungsgrad erklären sollen:
1. Auf der Ebene innerstaatlicher Präferenzen überwiegen bei der EU ökonomische, bei der RF jedoch geopolitische Erwägungen.
2. Auf der Ebene internationaler Verhandlungsprozesse ergibt sich eine grundlegende Zielkonkurrenz aus der jeweiligen Position als Produzent bzw. Konsument energetischer Rohstoffe. Beide Systeme verfolgen daher miteinander inkompatible Strategieansätze.
3. Auf der Ebene der Teilung bzw. Delegation von Souveränität vertreten beide Systeme grundsätzlich verschiedenen Kosten-/Nutzenanalysen, die sich aus ihren unterschiedlichen internen Präferenzen ergeben.
Zusammengefasst lautet die zentrale These dieser Arbeit:
Zwischen der EU und der RF besteht eine grundlegende Politikinkongruenz auf verschiedenen Ebenen, die sich negativ auf eine institutionalisierte Zusammenarbeit auswirkt.
Diese These soll in zwei Schritten untersucht werden. Zunächst wird eine Einteilung der RF und der EU in die rationale Verhandlungstheorie vorgenommen. Hierzu werden im Rahmen einer Querschnittsuntersuchung empirische Daten zu Präferenzbildungsprozessen in beiden Einheiten sowie zu ihrer internationalen Energiepolitik dargestellt und ausgewertet. Damit soll die Frage nach Politikinkongruenzen beider Systeme beantwortet werden. In dieser Einordnung liegt der empirische Hauptteil der Arbeit. Die Ergebnisse dieses Teils werden anhand zweier Fallbeispiele überprüft. Diese sind:
1. Die Ratifizierung des Transportprotokolls der internationalen Energiecharta 2. Die Unterstützung der EU für den Beitritt der RF zur Welthandelsorganisation (World Trade Organisation/ WTO) im Gegenzug zur Ratifikation des Kyotoprotokolls.
Inhaltsverzeichnis
- Fragestellung und Aufbau der Arbeit
- Theoretischer Rahmen der Analyse
- Die rationale Verhandlungstheorie nach Moravcsik
- Grundannahmen der rationalen Verhandlungstheorie nach Moravcsik
- Innerstaatliche Präferenzbildung
- Geopolitische Interessen als Grundlage staatlicher Präferenzen
- Politisch-ökonomische Interessen als Basis der Präferenzbildung
- Internationale Verhandlungsprozesse
- Institutionalisierung der Verhandlungsergebnisse
- Energieversorgungssicherheit als politikwissenschaftliches Konzept
- Konzepte und Definition von Energieversorgungssicherheit
- Politiktheoretische Bedrohungskonzeptionen
- Politikwissenschaftliche Systematisierung von Bedrohungsszenarien
- Importspezifische Strategien der Herstellung von Energiesicherheit
- Strategien der Dependenzreduktion
- Stabilisierung des politisch-ökonomischen Umfelds
- Direkte Kontrolle relevanter Ressourcen
- Zusammenführung der vorgestellten Ansätze
- Innerstaatliche Präferenzbildung
- Internationale Verhandlungsprozesse
- Institutionalisierung der Verhandlungsergebnisse
- Die rationale Verhandlungstheorie nach Moravcsik
- Einordnung EU-russischer Energiebeziehungen anhand der entwickelten Kriterien
- Innerstaatliche Präferenzbildung
- Russische Föderation
- Staatsinterne Akteure
- Interne Konfliktlinien
- Europäische Union
- Interne Akteure
- Interne Konfliktlinien
- Russische Föderation
- Internationale Verhandlungsprozesse
- Rahmenbedingungen der bilateralen Energiebeziehungen
- Struktur der weltweiten Märkte für Erdöl und Gas
- Präferenzen und Institutionen der bilateralen Beziehungen
- Handlungsoptionen und Politikstrategien der RF
- Reserven und Export energetischer Rohstoffe
- Transportwege
- Präferenzen und Politik der RF
- Handlungsoptionen und Politikstrategien der EU
- Energieressourcen und -bedarf
- Prognosen für das Jahr 2020
- Präferenzen und Politik der EU
- Rahmenbedingungen der bilateralen Energiebeziehungen
- Einordnung der EU und der RF in die rationale Verhandlungstheorie
- Innerstaatliche Präferenzbildung
- Internationale Verhandlungsprozesse
- Zusammenfassende Bewertung
- Überprüfung der Einordnung anhand der Fallbeispiele
- Die Verhandlungen zum Energiechartavertrag und zum Transit-Protokoll
- Entstehungsgeschichte und wesentliche Inhalte des Energiechartavertrags
- Präferenzen der EU und der RF
- Machtpotentiale und Verhandlungsstrategien auf internationaler Ebene
- Bewertung des Fallbeispiels
- Kyoto-Protokoll und WTO-Beitritt
- Energiepolitische Bezüge der Vertragswerke
- Präferenzen der EU und der RF
- Machtpotentiale und Verhandlungsstrategien auf internationaler Ebene
- Bewertung des Fallbeispiels
- Die Verhandlungen zum Energiechartavertrag und zum Transit-Protokoll
- Innerstaatliche Präferenzbildung
- Zusammenfassende Bewertung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Energiesicherheit der Europäischen Union im Kontext der bilateralen Beziehungen mit der Russischen Föderation. Ziel ist es, die praktische Umsetzung des politikwissenschaftlichen Konzepts der Energiesicherheit anhand des Fallbeispiels der EU-russischen Energiebeziehungen zu untersuchen.
- Die rationale Verhandlungstheorie nach Moravcsik als analytisches Instrument
- Die Bedeutung von innerstaatlichen Präferenzen für internationale Verhandlungsprozesse
- Die Rolle von Energieversorgungssicherheit als politikwissenschaftliches Konzept
- Analyse der EU-russischen Energiebeziehungen anhand der entwickelten Kriterien
- Bewertung der Fallbeispiele des Energiechartavertrags und des Kyoto-Protokolls
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit der Definition der Fragestellung und der Darlegung des Aufbaus. Im zweiten Kapitel wird der theoretische Rahmen der Analyse vorgestellt. Hierbei wird die rationale Verhandlungstheorie nach Moravcsik erläutert und das Konzept der Energieversorgungssicherheit aus politikwissenschaftlicher Perspektive definiert. Das dritte Kapitel widmet sich der Einordnung der EU-russischen Energiebeziehungen anhand der entwickelten Kriterien. Hierbei werden die innerstaatlichen Präferenzbildungsprozesse sowie die internationalen Verhandlungsprozesse zwischen EU und RF analysiert. Das vierte Kapitel untersucht die Einordnung der EU-russischen Energiebeziehungen anhand von Fallbeispielen, wie dem Energiechartavertrag und dem Kyoto-Protokoll. Die Arbeit endet mit einer zusammenfassenden Bewertung und einem Ausblick.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Energiesicherheit, rationale Verhandlungstheorie, internationale Beziehungen, Energiepolitik, EU-russische Beziehungen, Energieversorgungssicherheit, innerstaatliche Präferenzbildung, internationale Verhandlungsprozesse, Energiechartavertrag, Kyoto-Protokoll.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die institutionelle Zusammenarbeit zwischen EU und Russland im Energiesektor so gering?
Die Arbeit führt dies auf eine grundlegende Politikinkongruenz zurück, bei der die EU ökonomische und Russland geopolitische Interessen priorisiert.
Was ist die rationale Verhandlungstheorie nach Moravcsik?
Dieses Modell analysiert Verhandlungen in drei Stufen: innerstaatliche Präferenzbildung, internationale Verhandlungsprozesse und Institutionalisierung der Ergebnisse.
Welche Rolle spielt der Energiechartavertrag in den Beziehungen?
Der Vertrag und sein Transportprotokoll dienen als Fallbeispiel für die schwierige Ratifizierung und die unterschiedlichen Interessenlagen beider Partner.
Wie hängen das Kyoto-Protokoll und der WTO-Beitritt Russlands zusammen?
Die EU unterstützte Russlands WTO-Beitritt im Gegenzug zur russischen Ratifikation des Kyoto-Protokolls, was als machtpolitisches Verhandlungsergebnis analysiert wird.
Was sind die Hauptstrategien zur Herstellung von Energiesicherheit?
Dazu zählen die Reduktion von Abhängigkeiten (Dependenzreduktion), die Stabilisierung des Umfelds und die direkte Kontrolle von Ressourcen.
- Quote paper
- Michael Sander (Author), 2005, Die Energiesicherheit der EU. Umsetzung eines politikwissenschaftlichen Konzepts anhand der bilateralen Beziehung mit Russland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43765