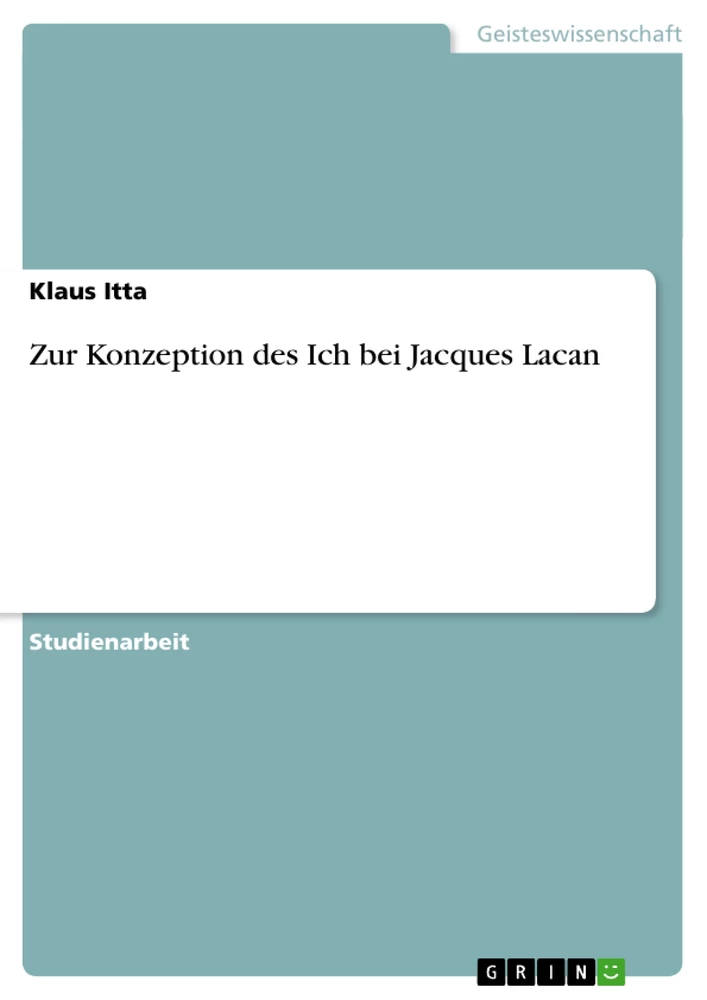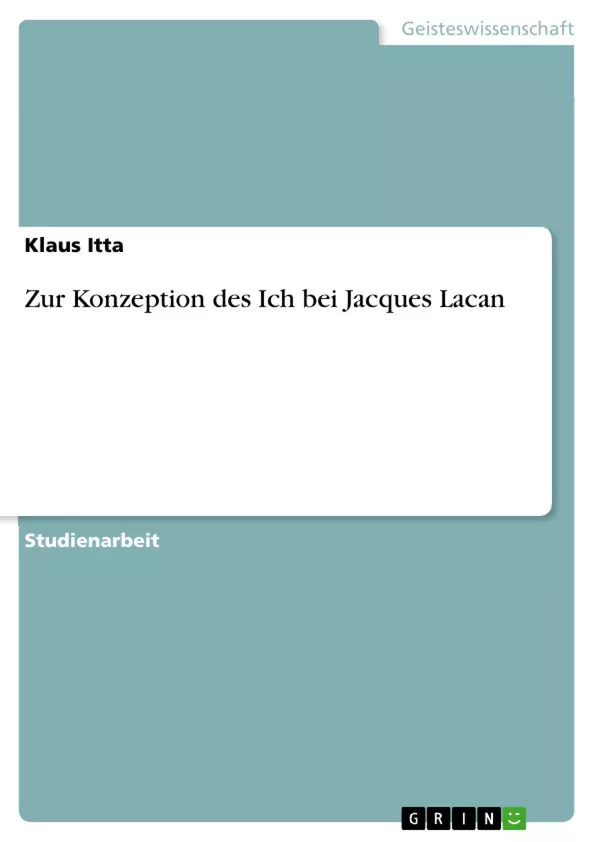Als wesentlich für die Lacansche Theorie der Ich-Bildung gilt seine Bestimmung der conditio humana, die er als Erfahrung des Mangels und somit als Seinsverfehlung beschreibt. Hieraus bedingt sich ein Begehr nach Ganzheit und Identität, das sich im Spiegelstadium in eine Einheit hineintäuscht, die das Subjekt nie hatte. In der Dialektik des Spiegelns spaltet sich das "Ich" in ein Gegenüber auf und wird sich so selbst zum Objekt, das paradoxerweise Einheit verspricht und von dem es begehrt begehrt zu werden, um so in jene Einheit zurückzukehren aus der es sich als herausgefallen erlebt. Diese narzisstische Identifizierung mit dem wahrgenommenen Bild eines anderen bildet die Matrix für die Konstitution des "Ich". Somit ist das "Ich", das Einheit verspricht, ein anderes (ein imaginäres "Ich", ein Phantsma), das entsteht in der Verkennung im Imaginären. Das "Ich" verfestigt sich konstitutiv in dieser Illusion und besteht allein in der kontinuierlichen Bezugnahme auf diese Täuschung.
Die strukturalistische Tätigkeit Lacans dezentriet das Subjekt, demaskiert das "Ich" als Illusion, entlarvt das Selbstbewusstsein als imaginäre Struktur... Das methodische Vorgehen, das Lacan hierzu anwendet, gestattet es dem Leser indes nicht auf zusammenhängende Argumentations- und Gedankengänge zu stossen, um auf diesem Wege zu einem Erkennen zu finden, sondern mutet ein Wirrwarr von Gedanken zu, die umherkreisen, abreissen und wieder auftauchen, Klärung versprechen, wieder vernebeln und in Frustration zurücklassen...
Lacan vollzieht in seinem Schreib- und Sprachstil die Auflösung von imaginärer Ganzheit und Einheit, die Auflösung von Ego- und Logozentrismus, indem er das Subjekt aus seiner selbstgenügsamen Haltung herauszustossen sucht, welche der Täuschung unterliegt ein an sich bestehender Kern einer Persönlichkeit oder autonomer Gestalter seines Verhältnisses zur Welt zu sein.
Dies ist nun in der Tat eine der westlichen Denktradition verpflichtete sehr befremdliche und wohl auch nicht ganz willkommene Auffassung, aber ebendies fasziniert und gruselt zugleich und es drängt sich förmlich auf, von hier aus an die indische Philosophie anzuknüpfen, was in einigen Fussnoten und Randbemerkungen zur vorliegenden Auseinandersetzung auch geschehen soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Im Anfang war der Mangel (und das Begehr)
- Das Spiegelstadium – Die Entstehung des imaginären Ich
- Zusammenfassung
- Das Unbewusste und die Sprache
- Ödipuskomplex und Sprache
- Das Unbewusste ist strukturiert wie eine Sprache
- Vom Auge zum Ohr
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Lacans Konzeption des Ichs. Ziel ist es, Lacans Gedankengänge zu seiner Theorie der Ich-Bildung nachzuvollziehen und die zentralen Argumente zu analysieren. Dabei wird der Fokus auf die Rolle des Mangels, des Spiegelstadiums und der Sprache gelegt.
- Lacans Verständnis des Menschen als Mängelwesen
- Die Entstehung des Ichs im Spiegelstadium
- Der Zusammenhang zwischen Unbewusstem und Sprache
- Die Rolle des Begehrens in der Ich-Bildung
- Die Kritik an der westlichen Denktradition
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt Lacans dezentrierende und dekonstruktivistische Herangehensweise an das Subjekt und das Ich. Sie skizziert die methodische Vorgehensweise Lacans und kündigt die Struktur der Arbeit an, die sich mit dem Mangel, dem Spiegelstadium und der sprachlichen Struktur des Unbewussten auseinandersetzt. Die Einleitung deutet zudem einen Vergleich mit der indischen Philosophie an, insbesondere dem Buddhismus, um die Lacansche Perspektive zu kontextualisieren und zu erweitern.
Im Anfang war der Mangel (und das Begehr): Dieses Kapitel beginnt mit der Beschreibung des Menschen als konstitutionelle Frühgeburt, gekennzeichnet durch einen Mangel an Selbstständigkeit und der Unfähigkeit zur Unterscheidung von Selbst und Umwelt. Aus diesem Urzustand des Mangels entsteht ein Begehren nach Ganzheit und Identität. Der Spiegel dient als Illusion einer Ganzheit, mit der sich das Kind identifiziert, obwohl diese Einheit fiktiv ist. Das Kapitel erläutert Lacans Konzept des Aufklaffens zwischen realer Befriedigung und imaginärer Erfüllung, wobei das Begehren nach einem „Mehr an Lust“ im Zentrum steht. Die Unmöglichkeit, Bedürfnis und Begehren in Deckung zu bringen, definiert den Menschen als Mängelwesen. Der Text vergleicht Lacans Theorie mit Ansätzen der indischen Philosophie, in denen das Begehren als Quelle des Leidens gesehen wird.
Das Spiegelstadium – Die Entstehung des imaginären Ich: (Diese Zusammenfassung wird aufgrund der Kürze des Originalskizze im Text ausgelassen.)
Das Unbewusste und die Sprache: Dieses Kapitel erörtert die Bedeutung der Sprache für die Struktur des Unbewussten nach Lacan. Es wird der Ödipuskomplex im Kontext der sprachlichen Entwicklung beleuchtet. Lacans These, dass das Unbewusste wie eine Sprache strukturiert ist, wird erklärt und die Verschiebung vom visuellen zum auditiven Bereich in der psychosexuellen Entwicklung thematisiert. Der Fokus liegt auf der Analyse, wie die Sprache die Gefangenheit des Menschen in seiner Selbsttäuschung aufdeckt und eine befreiende Sprache erfordert.
Schlüsselwörter
Jacques Lacan, Ich, Spiegelstadium, imaginäres Ich, Unbewusstes, Sprache, Begehren, Mangel, Ödipuskomplex, westliche Denktradition, indische Philosophie, conditio humana.
Häufig gestellte Fragen zu: Lacans Theorie des Ichs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert Jacques Lacans Konzeption des Ichs. Der Fokus liegt auf der Rolle des Mangels, des Spiegelstadiums und der Sprache bei der Ich-Bildung.
Welche Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen sind Lacans Verständnis des Menschen als Mängelwesen, die Entstehung des Ichs im Spiegelstadium, der Zusammenhang zwischen Unbewusstem und Sprache, die Rolle des Begehrens in der Ich-Bildung und ein Vergleich mit der indischen Philosophie (insbesondere dem Buddhismus).
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit verfolgt das Ziel, Lacans Gedankengänge zu seiner Theorie der Ich-Bildung nachzuvollziehen und die zentralen Argumente zu analysieren. Es soll ein Verständnis für Lacans dezentrierende und dekonstruktivistische Herangehensweise an das Subjekt und das Ich vermittelt werden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über den Mangel und das Begehren, ein Kapitel über das Spiegelstadium und die Entstehung des imaginären Ichs, ein Kapitel über das Unbewusste und die Sprache sowie eine Schlussbetrachtung und einen Ausblick.
Was ist die Kernaussage des Kapitels "Im Anfang war der Mangel (und das Begehr)"?
Dieses Kapitel beschreibt den Menschen als konstitutionelle Frühgeburt mit einem Mangel an Selbstständigkeit und der Unfähigkeit zur Unterscheidung von Selbst und Umwelt. Aus diesem Mangel entsteht ein Begehren nach Ganzheit und Identität, wobei der Spiegel als Illusion einer Ganzheit dient. Die Unmöglichkeit, Bedürfnis und Begehren in Deckung zu bringen, definiert den Menschen als Mängelwesen. Vergleiche mit der indischen Philosophie werden gezogen.
Was wird im Kapitel "Das Spiegelstadium – Die Entstehung des imaginären Ichs" behandelt?
Eine detaillierte Zusammenfassung dieses Kapitels wurde aufgrund der Kürze des Originalskizzes im Text ausgelassen.
Welche Rolle spielt die Sprache in Lacans Theorie?
Das Kapitel "Das Unbewusste und die Sprache" erörtert die Bedeutung der Sprache für die Struktur des Unbewussten. Es beleuchtet den Ödipuskomplex im Kontext der sprachlichen Entwicklung und Lacans These, dass das Unbewusste wie eine Sprache strukturiert ist. Die Verschiebung vom Visuellen zum Auditiven in der psychosexuellen Entwicklung wird thematisiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für das Verständnis der Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Jacques Lacan, Ich, Spiegelstadium, imaginäres Ich, Unbewusstes, Sprache, Begehren, Mangel, Ödipuskomplex, westliche Denktradition, indische Philosophie und conditio humana.
Wie wird die Arbeit methodisch angegangen?
Die Einleitung skizziert die methodische Vorgehensweise Lacans und kündigt die Struktur der Arbeit an, die sich mit dem Mangel, dem Spiegelstadium und der sprachlichen Struktur des Unbewussten auseinandersetzt. Ein Vergleich mit der indischen Philosophie dient der Kontextualisierung und Erweiterung der Lacanschen Perspektive.
- Citation du texte
- Klaus Itta (Auteur), 2005, Zur Konzeption des Ich bei Jacques Lacan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43767