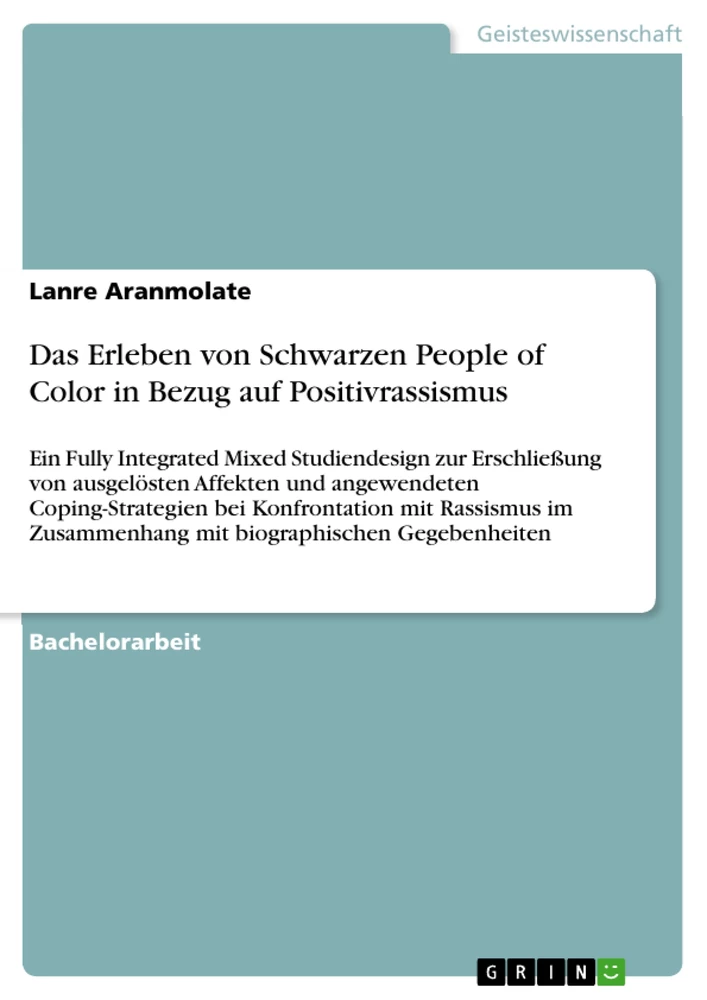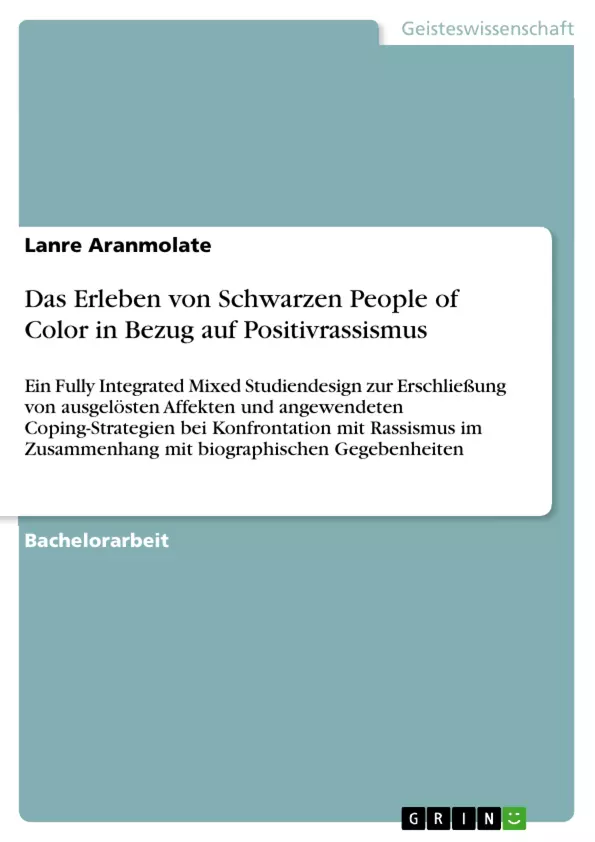People of Color (PoC) werden in Deutschland regelmäßig mit Rassismus konfrontiert. Der Begriff People of Color bezieht sich auf Menschen, die Rassismus-Erfahrungen miteinander teilen. Er ist ein politischer Begriff, der sich nicht auf kulturelle, nationale, ethnische oder religiöse Zugehörigkeit stützt und so eine Solidarität zwischen Menschen ermöglicht, die verschiedene Formen der Diskriminierung erleben. Rassismus hat Folgen für die Beteiligten. Auf der Seite der ihn Erlebenden kann es zum Auftreten von traumatischen Stress-Symptomen kommen, wie Carter (2007) berichtet. Sie reichen von Depression, Vermeidung und Intrusionen über Ärger, Übererregung und physischen Reaktionen bis zu einem geringen Selbstwert. Zudem ist ähnlich einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) die Erfahrung von Rassismus mit negativen und unangenehmen Gefühlen verbunden, liegt außerhalb der eigenen Kontrolle und tritt plötzlich auf. Zudem kann Rassismus auf mehreren Ebenen auftreten, nämlich auf einer institutionellen, kulturellen, umweltbedingten und/oder interpersonellen.
Diese Arbeit soll dazu beitragen, die Art und Weise, wie PoCs rassistische Übergriffe in einem interpersonellen Kontext erleben, abzubilden. Ihre Sichtweise wurde in Deutschland unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten bisher nur wenig beleuchtet und diskutiert. Ich behandele hier ausschließlich die Perspektive Schwarzer PoCs, da ich selbst einen schwarzen-deutschen Hintergrund habe und meine eigenen Erfahrungen in einer Weißdominierten Mehrheitsgesellschaft für den wissenschaftlichen Prozess dieser Arbeit bedeutsam sind. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsfragen
- Methoden
- Untersuchungen
- Voruntersuchungen der Studie
- Stichprobenbeschreibung der Hauptuntersuchung
- Hypothesen, dazugehörige Messinstrumente und ihre statistische Prüfung
- Untersuchungen
- Ergebnisse
- Berechnungen der Mittelwerte von positivem und negativem Affekt
- Varianzanalysen
- Auswertung der qualitativen Daten
- Diskussion
- Affektive Valenz und Rassismus
- Coping und Rassismus
- Affektivität hinsichtlich Rassismus unter Berücksichtigung des Geburtsortes
- Ausblick
- Abstract
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht das Erleben von Schwarzen People of Color in Bezug auf Positivrassismus. Sie zielt darauf ab, die Affekte und Coping-Strategien zu analysieren, die bei Konfrontation mit rassistischen Aussagen und Handlungen auftreten, sowohl negativ als auch positiv. Die Studie integriert dabei biografische Aspekte der Probanden und beleuchtet die Erfahrungen von Schwarzen People of Color aus ihrer eigenen Perspektive.
- Erleben von Positivrassismus durch Schwarze People of Color
- Ausgelöste Affekte bei rassistischen Begegnungen
- Angewendete Coping-Strategien im Umgang mit Rassismus
- Einfluss von biografischen Gegebenheiten auf das Erleben von Rassismus
- Sichtbarmachung der Lebensrealität von Schwarzen People of Color in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert den theoretischen Hintergrund und die Forschungsfragen. Im Methodenteil werden die Untersuchungsschritte, die Stichprobe und die statistische Analyse beschrieben. Der Ergebnisteil präsentiert die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Datenauswertung, wobei insbesondere die affektive Valenz und die angewendeten Coping-Strategien im Fokus stehen. Die Diskussion interpretiert die Ergebnisse im Kontext der bisherigen Forschung und beleuchtet den Einfluss des Geburtsortes auf das Erleben von Rassismus. Der Ausblick gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen und Handlungsmöglichkeiten.
Schlüsselwörter
Positivrassismus, Schwarze People of Color, Rassismus, Affekte, Coping-Strategien, Lebensrealität, biografische Gegebenheiten, Deutschland, Empirie, qualitative und quantitative Forschung, gesellschaftliche Strukturen, soziale Ungleichheit.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff "Positivrassismus"?
Positivrassismus bezeichnet vermeintlich positive Zuschreibungen oder Komplimente, die dennoch auf rassistischen Stereotypen basieren und diskriminierend wirken.
Welche Auswirkungen hat Rassismus auf die psychische Gesundheit?
Er kann zu traumatischen Stress-Symptomen, Depressionen, geringem Selbstwertgefühl und physischen Reaktionen führen.
Warum wird in der Arbeit die Perspektive Schwarzer PoCs fokussiert?
Um die spezifische Lebensrealität und die bisher wenig beleuchteten Erfahrungen dieser Gruppe in der weißdominierten deutschen Gesellschaft sichtbar zu machen.
Welche Coping-Strategien werden im Umgang mit Rassismus untersucht?
Die Studie analysiert, wie Betroffene emotional und handlungsorientiert auf rassistische Übergriffe reagieren, um die Belastung zu bewältigen.
Welche Rolle spielt der Geburtsort bei der Erfahrung von Rassismus?
Die Arbeit untersucht, ob es Unterschiede in der Affektivität und Wahrnehmung gibt, je nachdem, ob die Personen in Deutschland oder im Ausland geboren wurden.
- Citar trabajo
- Lanre Aranmolate (Autor), 2018, Das Erleben von Schwarzen People of Color in Bezug auf Positivrassismus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437802