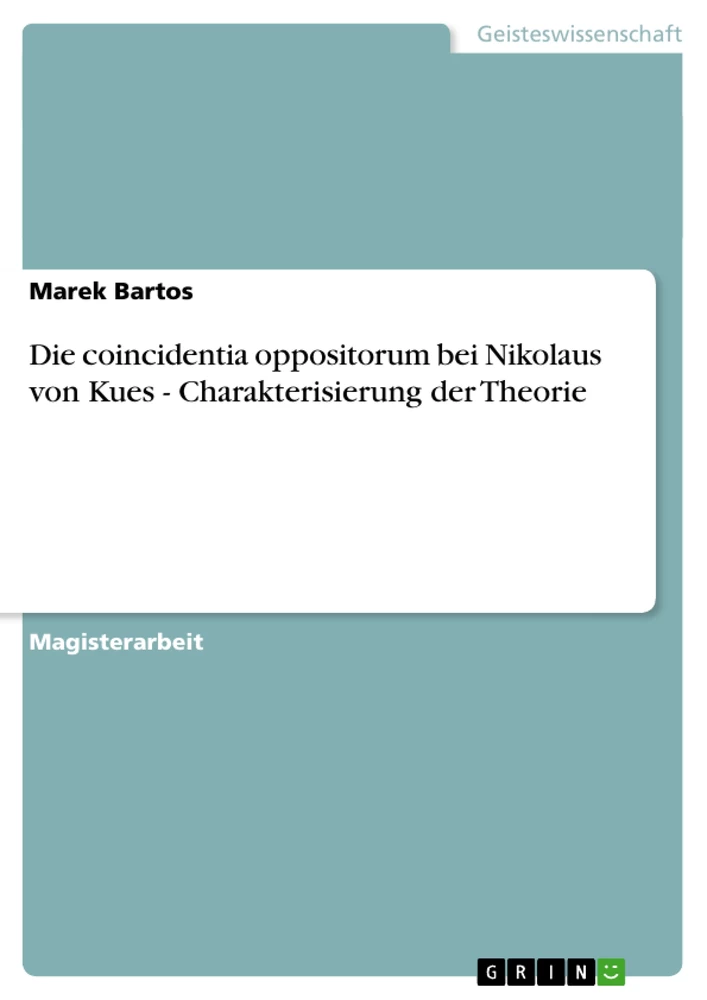Nikolaus von Kues (1401 – 1464) gilt als der bedeutendste Philosoph seines Jahrhunderts. Als Kardinal und Bischof von Brixen hatte er zudem für die Theologie seiner Zeit große Wichtigkeit. Trotz dem von der Theologie geprägten Denken ist seine Vorgehensweise immer darauf bedacht gewesen streng philosophischen Ansprüchen zu genügen. Sein Denken lässt sich nicht leicht in eine bestimmte Epoche eingliedern, da es sowohl von mittelalterlichem Gedankengut und ihren spezifischen Problematiken geprägt ist, als auch bereits moderne Denkformen der beginnenden Renaissance enthält.
Zur zentralen Problemstellung wird ihm die Frage nach dem Verhältnis des Menschen zu Gott, bzw. die Frage nach der erkenntnistheoretischen Möglichkeit des Erfassens dieses Verhältnisses und der Grenzen dieses Erfassens.
Diese Arbeit widmet sich dem cusanischen Kerngedanken, der coincidentia oppositorum und seiner Herkunft.
Zu Beginn soll daher gezeigt werden, wie das Thema der Gegensätze die Philosophiegeschichte seit ihren Anfängen zentral beschäftigt hat. Dabei wird zu erörtern sein, wie die von Cusanus im besonderen rezipierte neuplatonische Tradition sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat.
Aus dem Mittelalter, das vom Konflikt zwischen Metaphysik und Logik geprägt war, ist dann exemplarisch das Denken des Johannes Scotus Eriugena und Meister Eckharts ausgewählt worden. Zum Abschluss des historischen Abrisses soll noch die Entstehung des Begriffes der Koinzidenz und der cusanischen coincidentia oppositorum angeführt werden.
Nach einer systematischen Vorbemerkung zur Vorgehensweise des Nikolaus von Kues wird die erste inhaltliche Formulierung des Koinzidenzgedankens in De docta ignorantia sowie seine Präzisierungen in De coniecturis betrachtet. Dadurch tritt im folgenden Abschnitt die Frage nach dem Verständnis der coincidentia oppositorum auf, welche sich mit den Grenzen des aristotelischen Nichtwiderspruchsprinzips befasst. Im weiteren werden die besonderen Gottesnamen posse ipsum und non aliud des Kusaners betrachtet. Abschließend wird auf das Verhältnis von negativer Theologie zu affirmativer Theologie und der Überwindung beider bei Cusanus eingegangen sowie gezeigt, dass seine Philosophie systematisch als Geistmetaphysik verstanden werden kann.
Diese Arbeit versteht sich auch als Einführung in die für Nikolaus von Kues spezifische und immer noch aktuelle Problematik des Verhältnisses zwischen Logik und Metaphysik bzw. dessen Lösungsversuch im cusanischen Denken.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Philosophiegeschichtlicher Abriss der Herkunft des Themas der Koinzidenz
- 1. Prinzip der Gegensätze
- 2. Prinzip des Einen
- 3. Metaphysik und Logik
- 4. Der Begriff der Koinzidenz
- III. Die coincidentia oppositorum bei Nikolaus von Kues - Charakterisierung der Theorie
- 1. Systematische Vorbemerkung
- 2. maximum und minimum
- 3. coincidentia contrariorum und contradictorium
- 4. Die Gültigkeit des Nichtwiderspruchsprinzips
- 5. Vertiefung der Methode
- 6. Die Gottesnamen
- 7. Überwindung der negativen Theologie
- 8. Geistmetaphysik
- IV. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den zentralen Gedanken der „coincidentia oppositorum“ bei Nikolaus von Kues. Sie verfolgt das Ziel, die Charakteristik dieser Theorie zu beleuchten und ihren philosophiegeschichtlichen Ursprung zu skizzieren. Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Themas von den Vorsokratikern bis zu Kues, um ein besseres Verständnis der cusanischen Konzeption zu ermöglichen und interpretatorische Herausforderungen aufzuzeigen.
- Die Entwicklung des Prinzips der Gegensätze in der Philosophiegeschichte.
- Die Rolle des neuplatonischen Denkens (Plotin, Proklos, Pseudo-Dionysios Areopagita) für Kues' Konzept.
- Die Beziehung zwischen Metaphysik und Logik im Denken Kues'.
- Die Charakterisierung der „coincidentia oppositorum“ bei Nikolaus von Kues.
- Die Bedeutung der Gottesnamen und die Überwindung der negativen Theologie bei Kues.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Magisterarbeit ein und stellt Nikolaus von Kues als bedeutenden Philosophen und Theologen vor. Sie hebt die zentrale Bedeutung der „coincidentia oppositorum“ in seinem Werk hervor und erläutert das Ziel der Arbeit: die Charakterisierung dieses Gedankens und die Darstellung seiner historischen Entwicklung. Die Einleitung benennt die Herausforderungen der Interpretation von Kues' Denken und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, welcher die philosophiegeschichtliche Entwicklung des Themas der Gegensätze beleuchtet und die Rezeption neuplatonischer Traditionen einbezieht. Die Einleitung legt somit den Rahmen für die detaillierte Auseinandersetzung mit Kues' Konzept der „coincidentia oppositorum“ in den folgenden Kapiteln fest.
II. Philosophiegeschichtlicher Abriss der Herkunft des Themas der Koinzidenz: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung des Koinzidenzgedankens, beginnend bei den Vorsokratikern. Es verfolgt den Weg des Themas durch verschiedene philosophische Schulen, wobei der Schwerpunkt auf dem neuplatonischen Denken liegt. Die Darstellung umfasst die Auseinandersetzung mit dem Prinzip der Gegensätze bei den Vorsokratikern, Platon und Aristoteles, und die Verlagerung des Schwerpunktes hin zum „Einen“ bei Plotin, Proklos und Pseudo-Dionysios Areopagita. Das Kapitel analysiert den Konflikt zwischen Metaphysik und Logik in den folgenden Jahrhunderten, unter Berücksichtigung von Johannes Scotus Eriugena und Meister Eckhart, die als wichtige Vorläufer für Kues' Denken betrachtet werden. Der Abriss endet mit einer Betrachtung der Entstehung des Begriffs der Koinzidenz, um den Weg zum Verständnis der cusanischen „coincidentia oppositorum“ zu ebnen.
Schlüsselwörter
Coincidentia oppositorum, Nikolaus von Kues, Neuplatonismus, Metaphysik, Logik, Gegensätze, Gott, Negatives Theologie, Affirmative Theologie, Geistmetaphysik, Nichtwiderspruchsprinzip.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der "Coincidentia Oppositorum" bei Nikolaus von Kues
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den zentralen Gedanken der „coincidentia oppositorum“ (Zusammenfall der Gegensätze) bei Nikolaus von Kues. Sie untersucht die Charakteristik dieser Theorie und ihren philosophiegeschichtlichen Ursprung, von den Vorsokratikern bis hin zu Kues.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die cusanische Konzeption der „coincidentia oppositorum“ zu beleuchten, ihr Verständnis zu verbessern und interpretatorische Herausforderungen aufzuzeigen. Sie skizziert die philosophiegeschichtliche Entwicklung des Themas und untersucht die Rezeption neuplatonischer Traditionen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Prinzips der Gegensätze in der Philosophiegeschichte, die Rolle des neuplatonischen Denkens (Plotin, Proklos, Pseudo-Dionysios Areopagita) für Kues' Konzept, die Beziehung zwischen Metaphysik und Logik bei Kues, die Charakterisierung der „coincidentia oppositorum“ bei Nikolaus von Kues und die Bedeutung der Gottesnamen sowie die Überwindung der negativen Theologie bei Kues.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum philosophiegeschichtlichen Abriss der Koinzidenz (mit Unterkapiteln zu den Prinzipien der Gegensätze und des Einen, Metaphysik und Logik sowie dem Begriff der Koinzidenz), ein Kapitel zur „coincidentia oppositorum“ bei Nikolaus von Kues (mit Unterkapiteln zur Systematik, maximum und minimum, coincidentia contrariorum und contradictorium, dem Nichtwiderspruchsprinzip, der Methode, den Gottesnamen, der Überwindung der negativen Theologie und der Geistmetaphysik) und einen Schluss.
Welche philosophischen Strömungen werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt das Denken der Vorsokratiker, Platons, Aristoteles', die neuplatonische Tradition (Plotin, Proklos, Pseudo-Dionysios Areopagita), Johannes Scotus Eriugena und Meister Eckhart, um den historischen Kontext von Kues' Denken zu beleuchten.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Coincidentia oppositorum, Nikolaus von Kues, Neuplatonismus, Metaphysik, Logik, Gegensätze, Gott, Negative Theologie, Affirmative Theologie, Geistmetaphysik, Nichtwiderspruchsprinzip.
Was ist die Kernaussage des Kapitels zum philosophiegeschichtlichen Abriss?
Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung des Koinzidenzgedankens von den Vorsokratikern bis hin zu Kues, mit Schwerpunkt auf dem neuplatonischen Denken. Es analysiert den Konflikt zwischen Metaphysik und Logik und die Entstehung des Begriffs der Koinzidenz als Vorarbeit zum Verständnis der cusanischen "coincidentia oppositorum".
Was ist in der Einleitung enthalten?
Die Einleitung stellt Nikolaus von Kues vor, hebt die Bedeutung der „coincidentia oppositorum“ hervor, erläutert das Ziel der Arbeit (Charakterisierung des Gedankens und Darstellung seiner historischen Entwicklung), benennt interpretatorische Herausforderungen und skizziert den methodischen Ansatz.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Es werden Zusammenfassungen der Einleitung und des Kapitels zum philosophiegeschichtlichen Abriss der Koinzidenz gegeben, welche die jeweiligen Inhalte und Argumentationslinien detailliert beschreiben.
- Citar trabajo
- Marek Bartos (Autor), 2003, Die coincidentia oppositorum bei Nikolaus von Kues - Charakterisierung der Theorie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43788