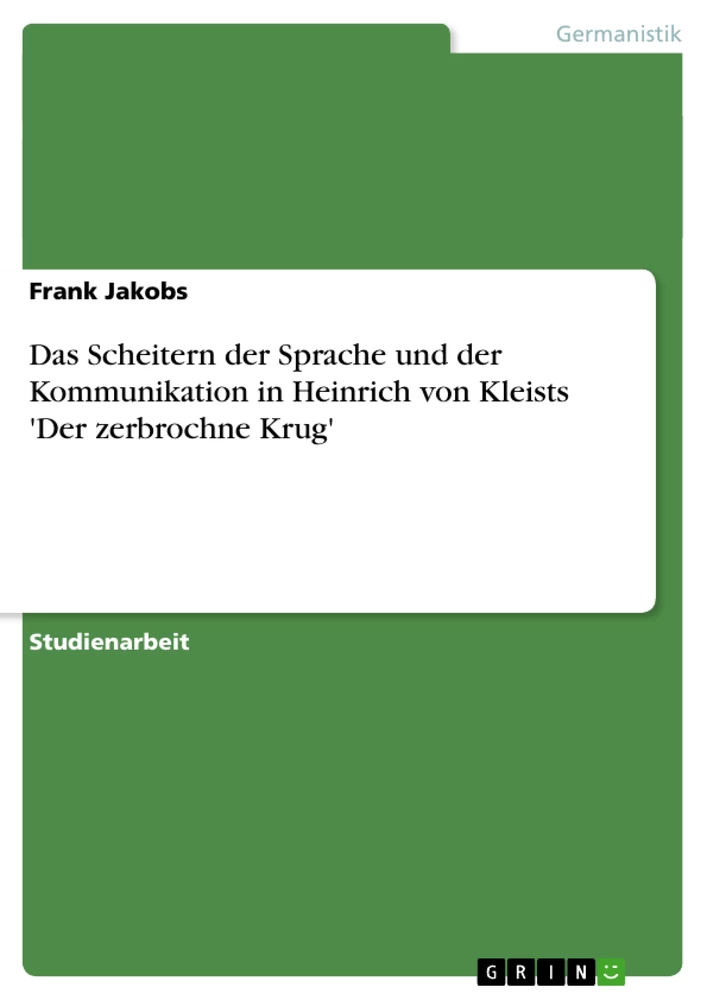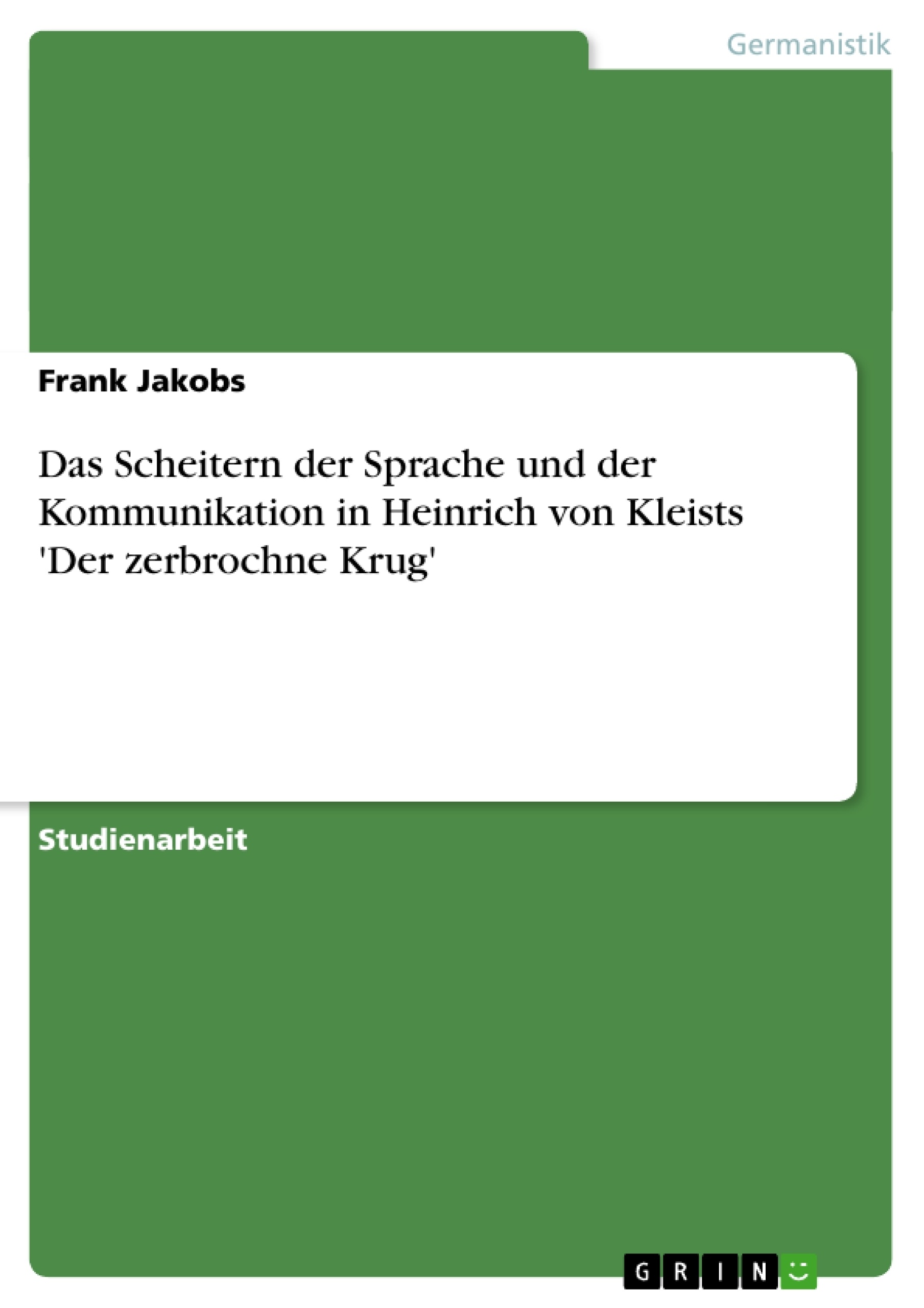Sprache dient dazu sich zu verständigen, sich mitzuteilen, Dinge zu beschreiben, Sachverhalte aufzuklären oder diese - in ihrer negativen Umkehr - zu verschleiern. Im zerbrochenen Krug versucht die Hauptfigur, der Dorfrichter Adam, sich aus seiner misslichen Lage mit Verwirrung stiftenden gar fantastischen Erklärungen und Geschichten, einfach gesagt mit Lügen, zu winden. Dem Leser oder dem Zuschauer wird aber sehr schnell klar, dass Adam, je mehr er versucht sich aus der Situation herauszuwinden, immer mehr ins „straucheln" gerät und letztendlich fällt.
Die Zweideutigkeit der Sprache, die sich hier offenbart, ist bezeichnend für das gesamte Stück. Kleist verwendet die Sprache um die Problematik aufzuzeigen, die in der Sprache selbst liegt. Um diese Problematik dreht es sich in den folgenden Ausführungen. Liegt es tatsächlich in der Sprache selbst, dass sie scheitert oder ist das Scheitern der Sprache und der Kommunikation gewolltes Mittel Adams seine Schuld im Dunkeln zu lassen und sich den Konsequenzen seiner Tat an Eve Rull zu entziehen? Was führt zum Scheitern der Sprache? Diese und ähnliche Fragen sind es, die sich stellen, wenn man sich mit diesem Thema in Kleists Lustspiel auseinandersetzt.
Die zwei Fassungen, die 1811 gedruckte Kurzfassung und die 1808 von Goethe inszenierte Langfassung, die Kleist als Variant der Kürzeren beifügte, machen die Komplexität dieses Stückes deutlich. Hier soll nur auf die kurze Fassung eingegangen werden. Aus den unzähligen Interpretationen, die sich in der Kleist Forschung aufgetan haben und zum Teil sehr widersprüchlich sind, lässt sich herauslesen, dass eine alles aufdeckende Deutung offensichtlich bisher noch keinem gelungen ist und wahrscheinlich auch nicht gelingen wird. Deshalb soll lediglich ein Ausblick auf die möglichen Interpretationsansätze gegeben werden, die sich hinsichtlich dieses Themas ergeben.
Dieser Ausblick klärt zunächst einmal die Begriffe Sprache und Kommunikation und wirft ein Licht auf das Verhältnis Heinrich von Kleists zur Sprache. Die Symbolik, die Kleist den Namen seiner Figuren beigemessen hat, ist ein weiterer Untersuchungsgegenstand. Schließlich werde ich am Beispiel Adams und seiner Gegenspieler die Problematik der Sprache und Kommunikation im „zerbrochenen Krug" verdeutlichen um schließlich ein Resümee der gewonnenen Ergebnisse und Einblicke zu ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprache und Kommunikation
- Das Verhältnis Heinrich von Kleists zur Sprache
- Namensymbolik im Zerbrochenen Krug
- Dorfrichter Adam
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Problematik der Sprache und Kommunikation in Heinrich von Kleists "Der zerbrochene Krug". Der Fokus liegt auf dem Scheitern der Sprache als Mittel der Verständigung und dem Einfluss dieser Problematik auf die Handlung des Stückes.
- Die Bedeutung von Sprache und Kommunikation in der Darstellung von Kleist
- Die Mehrdeutigkeit und manipulative Kraft von Sprache
- Die Rolle der sozialen und gesellschaftlichen Strukturen in der Kommunikation
- Die Analyse der Figuren und ihrer Sprachhandlungen
- Die Bedeutung von Namensymbolik und literarischen Gestaltungsmitteln
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung skizziert die zentrale Fragestellung der Arbeit: Das Scheitern der Sprache und Kommunikation in Kleists "Der zerbrochene Krug". Kleist nutzt die Mehrdeutigkeit der Sprache, um die Problematik des Missverständnisses und der bewussten Täuschung aufzuzeigen. Durch die Analyse der Sprache der Figuren und die Berücksichtigung der sozialen und gesellschaftlichen Strukturen wird die Komplexität der Kommunikationsdynamik im Stück verdeutlicht.
Sprache und Kommunikation
Dieses Kapitel beleuchtet die grundlegende Definition von Sprache und Kommunikation. Sprache wird als Mittel der Verständigung, des Ausdruckes von Gedanken und des Wissensbewahrens betrachtet. Kommunikation setzt die gemeinsame Verwendung von Sprache und die Übereinstimmung in der Bedeutung von Zeichen voraus. Die Frage des Scheiterns der Kommunikation wird im Kontext der sozialen und gesellschaftlichen Strukturen im Stück beleuchtet.
Das Verhältnis Heinrich von Kleists zur Sprache
In diesem Kapitel wird Kleists Verhältnis zur Sprache als literarisches Gestaltungsmittel und als Spiegel der menschlichen Gesellschaft untersucht. Kleists Verwendung der Sprache als Mittel der Satire, der Ironie und der Kritik wird beleuchtet.
Namensymbolik im Zerbrochenen Krug
Die Symbolik der Namen der Figuren in "Der zerbrochene Krug" wird in diesem Kapitel analysiert. Kleists Verwendung der Namen wird im Kontext ihrer Bedeutung und ihrer Funktion im Gesamtgeschehen des Stückes betrachtet.
Dorfrichter Adam
Das Kapitel konzentriert sich auf die Figur des Dorfrichters Adam, um die Problematik der Sprache und Kommunikation anhand seines Verhaltens zu beleuchten. Adams Umgang mit Sprache als Mittel zur Täuschung und Selbstdarstellung wird analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Sprache, Kommunikation, Scheitern, Mehrdeutigkeit, Ironie, Satire, Namensymbolik, soziale Strukturen, gesellschaftliche Hierarchien und Figurencharakteristik im Kontext von Heinrich von Kleists "Der zerbrochene Krug".
- Citar trabajo
- Frank Jakobs (Autor), 2005, Das Scheitern der Sprache und der Kommunikation in Heinrich von Kleists 'Der zerbrochne Krug', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43794