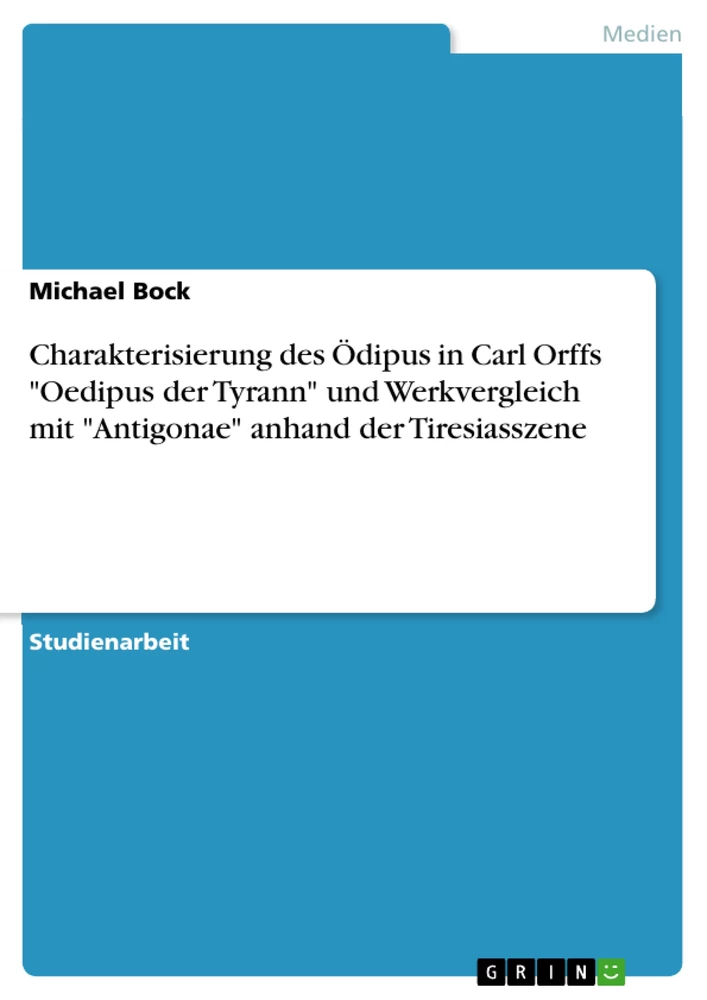Carl Orffs Vertonung von "Oedipus der Tyrann" ist eine Weiterentwicklung von "Antigonae" (1949). In "Oedipus der Tyrann" wird der Deklamationsstil auf die Spitze getrieben. Was im Vergleich der beiden Werke seltsam anmutet ist die Reihenfolge der thebanischen Trilogie. In dem Werk von Sophokles findet sich Antigone im letzten Teil und König Ödipus im ersten Teil. Orff vertonte zuerst Antigonae, dann, zehn Jahre später, Oedipus der Tyrann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorzeichen im Zusammenhang mit der Charakterentwicklung des Ödipus'
- Erläuterung der Symbole in Tabelle I.
- Tonartliche Entwicklung des Ödipus'
- Interpretation der Vorzeichnung
- Werkvergleich am Beispiel der Szene des Tiresias'
- Begründung der Szenenwahl
- Vergleich und Analyse
- Zusammenfassung
- Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Werkanalyse untersucht die musikalische Entwicklung des Ödipus in Carl Orffs "Oedipus der Tyrann" anhand der tonartlichen Veränderungen. Der Fokus liegt auf der Verbindung zwischen musikalischer Gestaltung und der inneren Entwicklung des Protagonisten. Darüber hinaus wird der Vergleich mit Orffs "Antigonae" herangezogen, um die Stilistik und die Dramaturgie der beiden Werke zu beleuchten.
- Die tonartliche Entwicklung des Ödipus' als Spiegel seiner inneren Konflikte und Erkenntnisse
- Die Rolle der Generalvorzeichnung in der musikalischen Gestaltung von Orffs "Oedipus der Tyrann"
- Der Vergleich der tonartlichen Gestaltung in "Oedipus der Tyrann" und "Antigonae"
- Die Verwendung von archaischen Topoi zur Vermittlung des griechischen Dramas
- Die Verbindung von Deklamation und Musik in Orffs Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Einleitung und die Kritik an Orffs "Oedipus der Tyrann" bei der Uraufführung. Es werden die Besonderheiten des Werkes im Vergleich zu "Antigonae" beleuchtet, sowie die künstlerische Intention Orffs, die antike griechische Tragödie neu zu interpretieren.
Im zweiten Kapitel wird die Generalvorzeichnung im Zusammenhang mit der Charakterentwicklung des Ödipus' erläutert. Die Tabelle im Anhang (Tabelle I.) visualisiert die unterschiedlichen Vorzeichen für die verschiedenen Rollen und ihren Bezug zur Handlung. Die Bedeutung der Vorzeichen für die Darstellung des Ödipus' wird detailliert analysiert.
Das dritte Kapitel behandelt den Werkvergleich am Beispiel der Szene des Tiresias. Es wird die Begründung für die Szenenwahl erläutert und die Unterschiede in der musikalischen Gestaltung von "Oedipus der Tyrann" und "Antigonae" analysiert. Die Zusammenfassung fasst die Erkenntnisse des Vergleichs zusammen.
Schlüsselwörter
Carl Orff, Oedipus der Tyrann, Antigonae, Generalvorzeichnung, Tonartliche Entwicklung, Charakterentwicklung, Deklamation, Musiktheater, Antike Tragödie, Werkvergleich, Hölderlin-Übersetzung, Symbolismus.
- Citation du texte
- Michael Bock (Auteur), 2017, Charakterisierung des Ödipus in Carl Orffs "Oedipus der Tyrann" und Werkvergleich mit "Antigonae" anhand der Tiresiasszene, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/438016