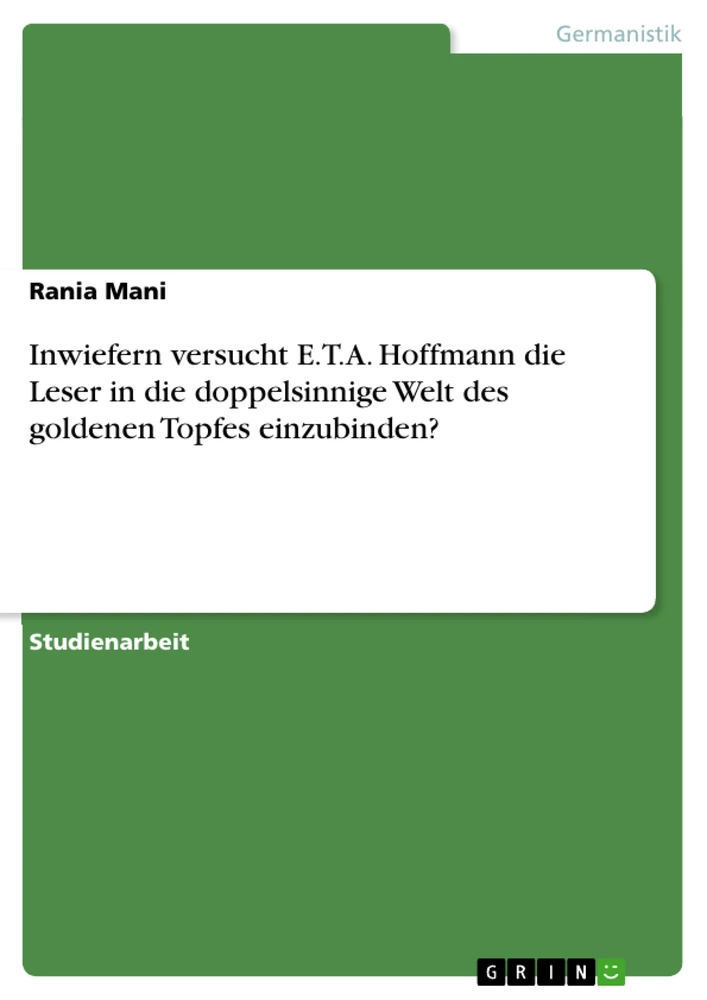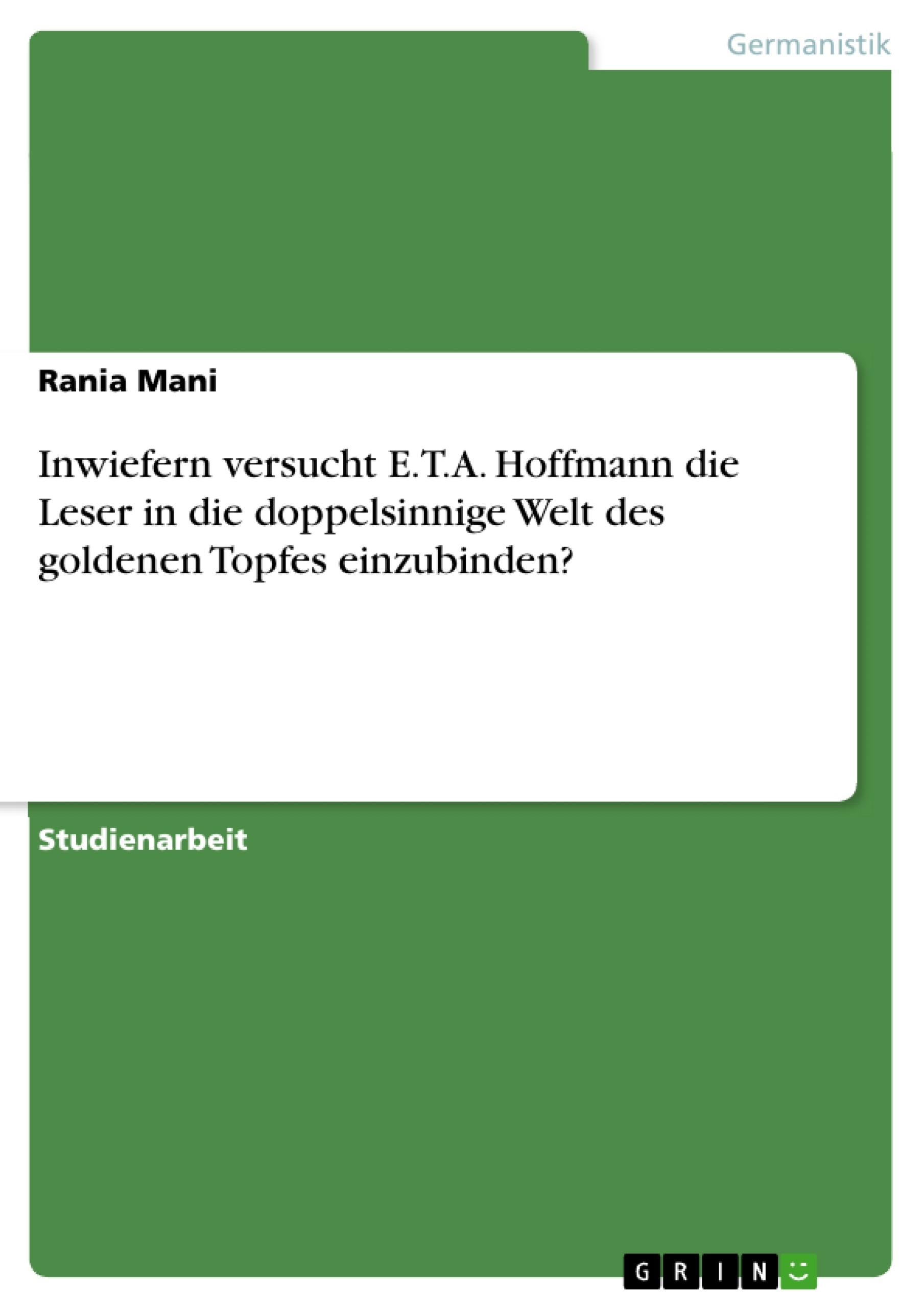Der Literat E.T.A Hoffmann (1776-1822) gilt als ein vorzüglicher Repräsentant der deutschen Dichtung, indem er durch seine Werke zu einer entfernten historischen Figur geworden ist. „Der goldne Topf“, mit dem Untertitel „Ein Märchen aus der neuen Zeit“, welches 1813 entstand, gilt als das bedeutendste Stück aus Hoffmanns Werken in „Die Fantasiestücke in Collot´s Manier.“ Der goldne Topf thematisiert die Entwicklung einer Künstlerfigur und ihr Verhältnis zur Realität. Eines der bedeutsamsten Inhalte des Märchens ist die Darstellung der doppelsinnigen Welt durch die Verknüpfung von wunderbaren und realen Elementen. Inwiefern gelingt es Hoffmann jedoch die Leser in die doppelsinnige Welt des goldenen Topfes einzubinden?
Gegenstand dieser Arbeit ist eine Auseinandersetzung mit dem Märchen, um einen Überblick in die Struktur, der Figuren und der Motivik zu erhalten. Die Frage nach der Wirklichkeit ist für eine Betrachtung von Hoffmanns Werk von zentraler Bedeutung. Hierbei dient der Kontrast zwischen der Realität und der phantastischen für die Analyse als interessanten Einblick in das Gesamtwerk und in die Forschung dieser Gegenüberstellung. Auch wird das Ästhetikmodell angesprochen, welches die Bereiche „Künstler und Wahnsinn“ und „Duplizität des Seins“ aufgreift. Der goldne Topf basiert auf dem Modell der negativen Ästhetik. Es wird als poetisches Gedicht bezeichnet und vermittelt zwischen Kunst und Leben. Dem folgen Ausführungen zu Symbolen, Elemente und Metaphern des Märchens. Eine Untersuchung der Figuren und Erzählebene soll die Frage beantworten, inwiefern diese Aspekte in Hoffmanns Poetik realisiert werden. Eine Erörterung von weiteren Aspekten rundet die Untersuchung ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau
- Formenanalyse
- Personenkonstellation
- Analyse
- Ästhetikmodell
- Der Atlantis-Mythos
- Die zwei Welten
- Zweideutigkeit der Wirklichkeit
- Höhere Welt
- Dualismus zwischen phantastischer und bürgerlicher Welt
- Sprache und Natur
- Alchemie und Magnetismus
- Tiere, Symbole und Metaphern
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit E.T.A. Hoffmanns „Der goldne Topf“, um zu untersuchen, wie er die Leser in die doppelsinnige Welt des Märchens einbindet. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Struktur, der Figuren und der Motivik des Märchens, wobei insbesondere der Kontrast zwischen Realität und phantastischer Welt untersucht wird. Die Arbeit befasst sich außerdem mit dem Ästhetikmodell des „Goldenen Topfs“ und betrachtet die Bedeutung von Symbolen, Elementen und Metaphern für die Gestaltung der Geschichte.
- Die Konstruktion der doppelsinnigen Welt im „Goldenen Topf“
- Die Rolle des Erzählers und seine Interaktion mit dem Leser
- Die Verbindung von Realität und Phantasie in der Figurenkonstellation
- Die Darstellung der „negativen Ästhetik“ im Märchen
- Die Bedeutung von Symbolen und Metaphern für die Interpretation der Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor. Kapitel 2 befasst sich mit dem Aufbau des „Goldenen Topfs“, analysiert die Form des Märchens und die Personenkonstellation. Kapitel 3 geht detailliert auf die Analyse des Märchens ein. Dabei werden das Ästhetikmodell, der Atlantis-Mythos und die beiden Welten der Realität und der Phantasie beleuchtet. Des Weiteren wird die Zweideutigkeit der Wirklichkeit, die höhere Welt, der Dualismus zwischen phantastischer und bürgerlicher Welt sowie Sprache und Natur analysiert.
Schlüsselwörter
E.T.A. Hoffmann, „Der goldne Topf“, Märchen, doppelsinnige Welt, Realität und Phantasie, Ästhetikmodell, „negative Ästhetik“, Symbolismus, Metaphern, Figurenkonstellation, Erzähler, Leserinteraktion, Atlantis-Mythos, Dualismus.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in E.T.A. Hoffmanns "Der goldne Topf"?
Das Märchen thematisiert die Entwicklung des Studenten Anselmus zur Künstlerfigur und seinen Konflikt zwischen bürgerlicher Realität und einer phantastischen Welt.
Was bedeutet die "doppelsinnige Welt" im Werk?
Es beschreibt die Verknüpfung von wunderbaren Elementen (wie sprechenden Schlangen) mit der alltäglichen, realen Welt Dresdens.
Wie bindet Hoffmann den Leser in die Geschichte ein?
Durch einen Erzähler, der den Leser direkt anspricht und die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit verschwimmen lässt.
Was ist der Atlantis-Mythos im "Goldenen Topf"?
Atlantis steht für eine höhere, poetische Welt, nach der sich der Künstler sehnt und die im Kontrast zur nüchternen bürgerlichen Existenz steht.
Was versteht man unter "negativer Ästhetik" in diesem Kontext?
Dies bezieht sich auf ein Ästhetikmodell, das Themen wie Wahnsinn, Duplizität des Seins und die Zerrissenheit des Künstlers aufgreift.
- Arbeit zitieren
- Rania Mani (Autor:in), 2016, Inwiefern versucht E.T.A. Hoffmann die Leser in die doppelsinnige Welt des goldenen Topfes einzubinden?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/438273