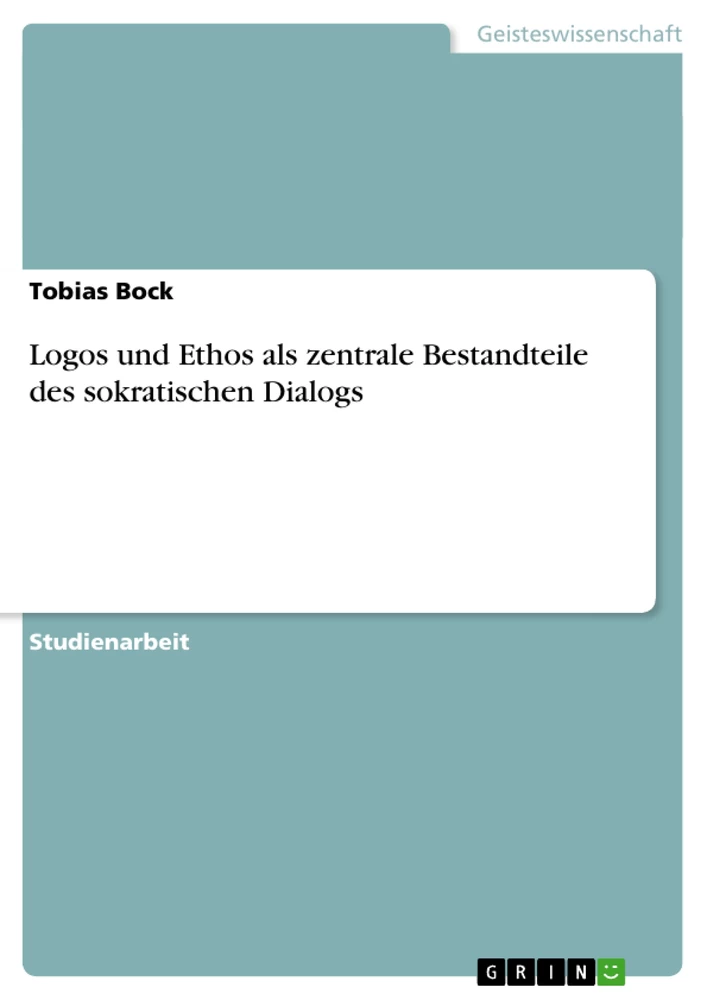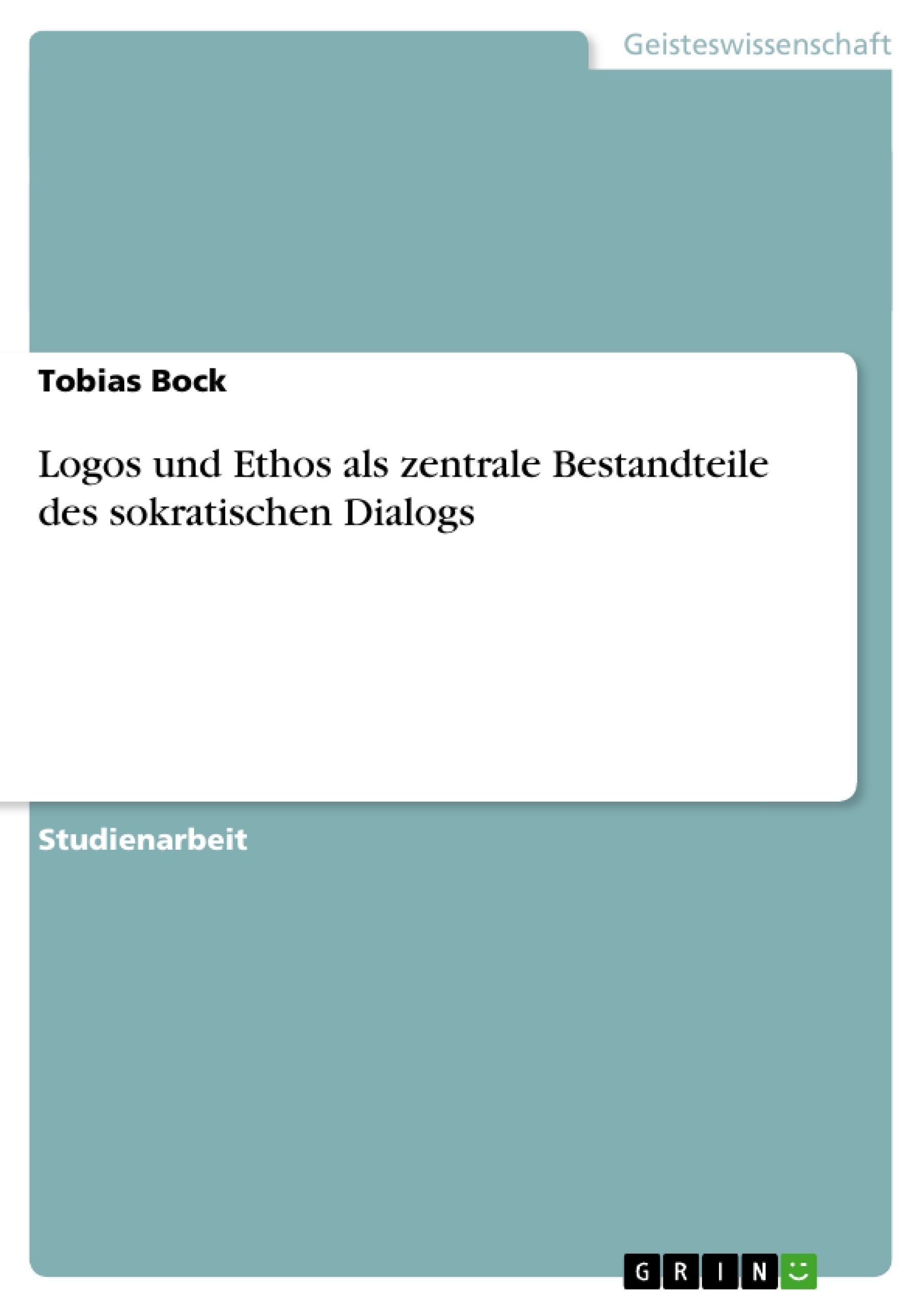Im Laufe der philosophischen Beschäftigung mit Sokrates (470 v. Chr. - 399 v. Chr.) ist seine Gestalt in vielfacher Weise Interpretationen und Deutungen ausgesetzt gewesen. Zunächst scheint es den Anschein zu haben, „daß die Frage nach Persönlichkeit und Werk des geschichtlichen Sokrates praktisch unbeantwortbar ist.“
So wurde Sokrates von Georg Hamann, einem untypischen Zeitgenossen der Aufklärung, nicht als Protagonist der Aufklärung, gedeutet, der die Menschen auf Unwissenheit und Vorurteile aufmerksam machen will um sie in Wissen zu überführen, sondern als der „selbst unwissende Prophet der christlichen Wahrheit“. Für Immanuel Kant nimmt Sokrates einen exponierten Status in der Philosophiegeschichte ein, weil er es war, „welcher dem philosophischen Geiste und allen spekulativen Köpfen eine ganz neue praktische Richtung gab. Auch ist er unter fast allen Menschen der einzige gewesen, dessen Verhalten der Idee eines Weisen am nächsten kommt.“
Für Hegel, der die Weiterentwicklung der Vernunft in der Geschichte zeigen will, ist Sokrates Teil einer Bewegung des Denkens, die mit den Sophisten begann. In Sokrates zeigt sich die Subjektivität des Denkens, er ist für ihn der „Hauptwendepunkt des Geistes in sich selbst“.
Eine eher existenzialistische Deutung erfuhr Sokrates bei Kierkegaard, wo die Betonung seines Nichtwissens als symptomatischer Ausdruck einer existentiellen Haltlosigkeit angesehen wird. „Sokrates ist für Kierkegaard der einzige vorchristliche existenzielle Denker“5.
Der Streit um die Person des Sokrates hat sich im 20. Jahrhundert weiter entfaltet, und man kann sagen, daß er bis heute andauert. Diese weiteren Auseinandersetzungen zu skizzieren würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen und auch dem Thema meiner Arbeit nicht gerecht werden. Allerdings bleibt bei solch einer Vielfalt der Sokratesbilder die Frage offen, wo die Gründe so unterschiedlicher Deutungen liegen könnten.
Eine Antwort auf diese Frage muss wahrscheinlich zweierlei berücksichtigen. Zum Einen das Wesen eines Interpretationsvorganges selbst, zum Anderen die historische Quellensituation.
Der Vorgang des Interpretierens kommt vielleicht der Tätigkeit des Dolmetschens nahe. Das Fremde wird in das Eigene übersetzt, und diese Übersetzung wird als die Aussage des anderen angesehen. Aber, abgesehen von dieser „natürlichen“ Verfremdung während einer Interpretation, gibt es noch den Faktor der Selektivität des Interpreten.
Inhaltsverzeichnis
- 1) „Logos“ und „Ethos\" als zentrale Bestandteile der sokratischen Dialoge
- 1.1)Quellenprobleme und philosophische Interpretation
- 1.2)Wandel vom Mythos zum Logos in der Zeit der Naturphilosophen/Sophisten
- 2) Der logos als Element der sokratischen Dialoge
- 2.1) Der Begriff des Logos
- 2.2) Methoden: Dialog und induktive Schlüsse
- 3) Der Ethos als Element der sokratischen Dialoge
- 3.1) Motivation der sokratischen Philosophie -Das ethisches Verständnis-
- 3.2) Widerspruch zwischen „Wissen um das Gute\" und Erkenntnis des Nichtwissens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text befasst sich mit dem Wandel von Mythos zu Logos in der griechischen Geistesgeschichte und untersucht „Logos“ und „Ethos“ als zentrale Bestandteile der sokratischen Dialoge. Ziel ist es, die Entwicklung des rational-wissenschaftlichen Denkens zu beleuchten und die Bedeutung des sokratischen Dialogs für die Philosophie zu analysieren.
- Die Vielfalt der Sokratesdeutungen und die Quellenprobleme
- Der Übergang von mythischen Erklärungsmodellen zu einem rationalen Weltverständnis
- Der Logos als Element der sokratischen Dialoge und die Methode des Dialogs
- Der Ethos als Motivator der sokratischen Philosophie und der Widerspruch zwischen Wissen und Nichtwissen
- Die Bedeutung des sokratischen Denkens für die Entwicklung der Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Vielfalt der Sokratesdeutungen in der Philosophiegeschichte. Es wird gezeigt, wie unterschiedlich Sokrates von verschiedenen Denkern interpretiert wurde, von Georg Hamann bis Immanuel Kant und Hegel. Das Kapitel geht auf die Quellenprobleme ein und stellt die Frage nach der Authentizität der Sokratesquellen, insbesondere der Schriften von Platon und Xenophon.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Wandel vom Mythos zum Logos in der Zeit der Naturphilosophen und Sophisten. Es wird erklärt, wie der Übergang von einer mythischen zu einer rational-wissenschaftlichen Sichtweise die Entwicklung der Philosophie prägte. Der Fokus liegt auf der Entstehung des „Logos“ als Erkenntnisprinzip und den Auswirkungen auf die griechische Geistesgeschichte.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Textes sind Sokrates, Dialog, Logos, Ethos, Mythos, Naturphilosophie, Sophisten, Vernunft, Philosophiegeschichte, Interpretation, Quellenkritik, griechische Geistesgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeuten Logos und Ethos bei Sokrates?
Logos steht für die rationale Vernunft und Argumentation im Dialog, während Ethos die sittliche Haltung und die Lebensführung des Denkers beschreibt.
Warum ist Sokrates' Nichtwissen so berühmt?
Sein Bekenntnis zum Nichtwissen („Ich weiß, dass ich nichts weiß“) ist der Ausgangspunkt seiner Philosophie, um durch Fragen zu wahrer Erkenntnis zu gelangen.
Was war der Wandel vom Mythos zum Logos?
Es bezeichnet den Übergang von einer religiös-mythischen Welterklärung hin zu einer rationalen, wissenschaftlichen Untersuchung der Natur und des Menschen.
Welche Methode nutzte Sokrates in seinen Dialogen?
Er nutzte die Mäeutik (Hebammenkunst) und induktive Schlüsse, um seine Gesprächspartner durch gezielte Fragen selbst zur Einsicht zu führen.
Warum gibt es so viele verschiedene Sokratesbilder?
Da Sokrates selbst nichts schrieb, basieren alle Bilder auf Interpretationen von Zeitgenossen wie Platon oder Xenophon, was zu unterschiedlichen Deutungen (z.B. bei Kant oder Hegel) führt.
- Arbeit zitieren
- Tobias Bock (Autor:in), 2000, Logos und Ethos als zentrale Bestandteile des sokratischen Dialogs, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43847