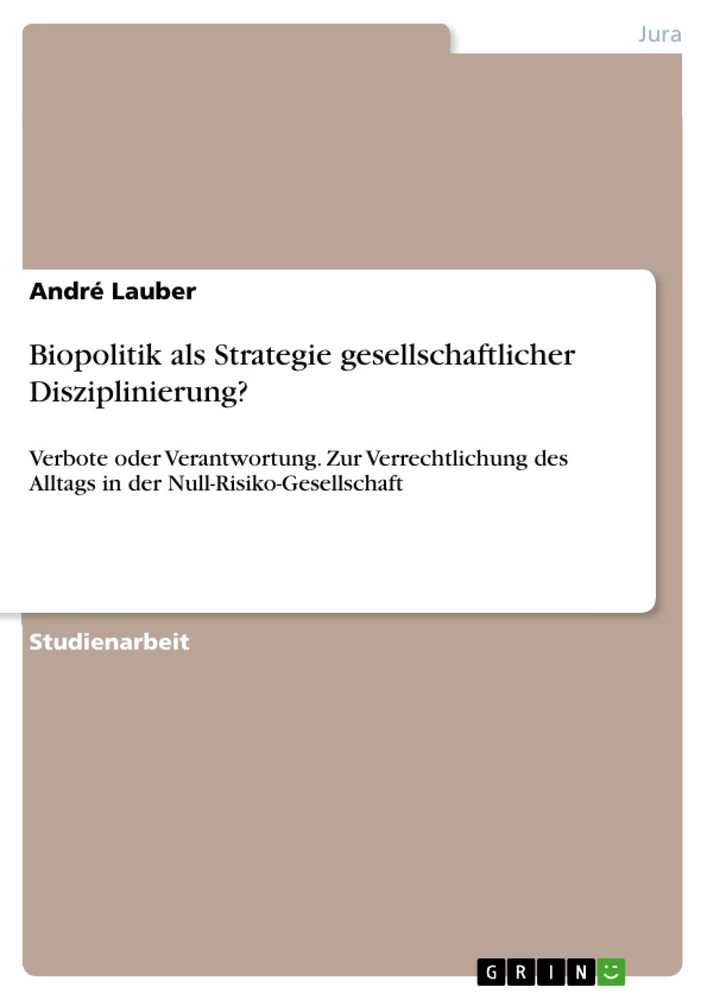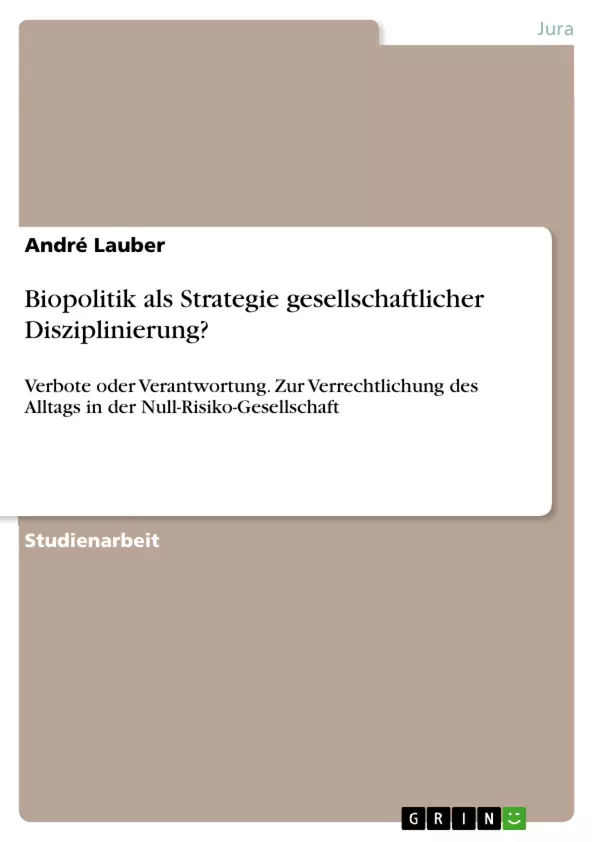Diese Arbeit beschäftigt sich mit Michel Foucaults Begriff der Biopolitik in der heutigen Zeit.
Die Griechen verstanden zu Aristoteles Zeiten «Leben» zum einen als Tatsache des Lebens von Mensch, Tier und Göttern und nannten das «zoe». Zum anderen beschrieben sie mit «bios» die Lebensweise, die einem Menschen oder einer Gruppe eigen ist. Diese Daseinsform findet auf mehreren Ebenen statt, zum Beispiel als soziales und politisches Leben («bios politikos»). Bezeichnenderweise kennt das Altgriechische kein Plural für «zoe»; Das biologische, reproduktive Leben existiert nun mal nicht auf verschiedenen Ebenen (Agamben, 2002). Das von Aristoteles beschriebene «lebende Tier, das auch zu einer politischen Existenz fähig ist» – das «politikon zoon» – kehrte Michel Foucault in sein Gegenteil. Der moderne (liberale) Staat vereinnahmt das Lebewesen («zoe») als Teil seiner Staatsmacht. «Bios» frisst «zoe» und verleibt sich seine Gene ein. Der heutige Mensch «ist ein Tier, in dessen Politik sein Leben als Lebewesen auf dem Spiel steht.» (Foucault, 1977). Es geht um Macht, Politik, Bevölkerung und Individuum. Das ist das Spielfeld von Michel Foucaults Biopolitik. Foucault entwickelte den Begriff der «Biopolitik» durch sorgfältige Analyse der Veränderung der Lebensweise der Menschen und der Launenhaftigkeit der Machtverhältnisse (Foucault, 1999). Um «Biopolitik» zu begreifen, muss man wissen, was Foucault unter Macht verstanden hat.
Inhaltsverzeichnis
- Das politische Tier
- Was ist Macht?
- Die Souveränitätsmacht - Sterben machen und Leben lassen
- Die Disziplinarmacht und die Individualisierung
- Die Gouvernementalität - Disziplinarmacht trifft auf Biomacht
- Die Biopolitik - hin zur Normalisierung
- Der Tod ist nicht mehr das, was er früher einmal war
- ...und das Leben schon gar nicht - Leben machen und Sterben lassen
- Biopolitik ist nicht unbedingt Biomacht
- Biopolitik heute und in Zukunft
- Michel Foucault - Eine Kurzbiografie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert den Begriff der Biopolitik, wie ihn Michel Foucault prägte. Sie erörtert, wie sich die Machtverhältnisse von der Souveränitätsmacht hin zur Disziplinarmacht und Biomacht verschoben haben. Die Arbeit untersucht, wie die Lebensweise der Menschen und die Machtverhältnisse durch die Biopolitik beeinflusst werden.
- Die Entwicklung des Machtbegriffs von der Souveränitätsmacht zur Disziplinarmacht und Biomacht
- Die Rolle von Wissen und Überwachung in der Biopolitik
- Die Auswirkungen der Biopolitik auf die Lebensweise und Individualisierung des Menschen
- Die Normalisierungsprozesse und die Bedeutung des Lebens und des Todes in der Biopolitik
- Der Einfluss von Michel Foucaults Werk auf die heutige Diskussion um Biopolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet das politische Tier in der Antike und stellt es dem modernen Menschen entgegen, der durch die Biopolitik als Lebewesen in den Fokus der Staatsmacht rückt. Kapitel 2 definiert den Begriff der Macht nach Michel Foucault und zeigt die Entwicklung von der Souveränitätsmacht zur Disziplinarmacht auf. Kapitel 3 erklärt die Biopolitik als Normalisierungsprozess und diskutiert die Veränderung der Bedeutung von Leben und Tod. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Biopolitik im heutigen Kontext und beleuchtet die zukünftige Entwicklung der Biomacht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter der Seminararbeit sind: Biopolitik, Michel Foucault, Macht, Disziplinarmacht, Biomacht, Souveränitätsmacht, Normalisierung, Leben, Tod, Überwachung, Wissen, Individualisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Michel Foucault unter Biopolitik?
Biopolitik bezeichnet eine Regierungsform, bei der das biologische Leben der Bevölkerung (Geburtenraten, Gesundheit, Hygiene) zum zentralen Gegenstand politischer Macht und Steuerung wird.
Was ist der Unterschied zwischen "zoe" und "bios"?
Im antiken Griechenland bezeichnete "zoe" das nackte, biologische Leben (Mensch und Tier), während "bios" die spezifische Lebensweise eines Individuums oder einer Gruppe in der Gesellschaft (bios politikos) meinte.
Wie wandelte sich die Macht von der Souveränität zur Biomacht?
Die alte Souveränitätsmacht durfte "sterben machen oder leben lassen". Die moderne Biomacht hingegen ist darauf ausgerichtet, "leben zu machen und sterben zu lassen" – also das Leben zu optimieren und zu verwalten.
Welche Rolle spielt die Disziplinarmacht in Foucaults Theorie?
Die Disziplinarmacht konzentriert sich auf den einzelnen Körper (Abrichtung, Überwachung), während die Biopolitik auf die gesamte Bevölkerung als biologische Masse abzielt. Beide ergänzen sich in der modernen Gouvernementalität.
Was bedeutet "Normalisierung" im Kontext der Biopolitik?
Normalisierung ist der Prozess, durch den der Staat Standards für Gesundheit und Verhalten festlegt, um die Bevölkerung effizienter steuerbar zu machen und Abweichungen zu minimieren.
- Quote paper
- Dr. med. André Lauber (Author), 2018, Biopolitik als Strategie gesellschaftlicher Disziplinierung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/438622