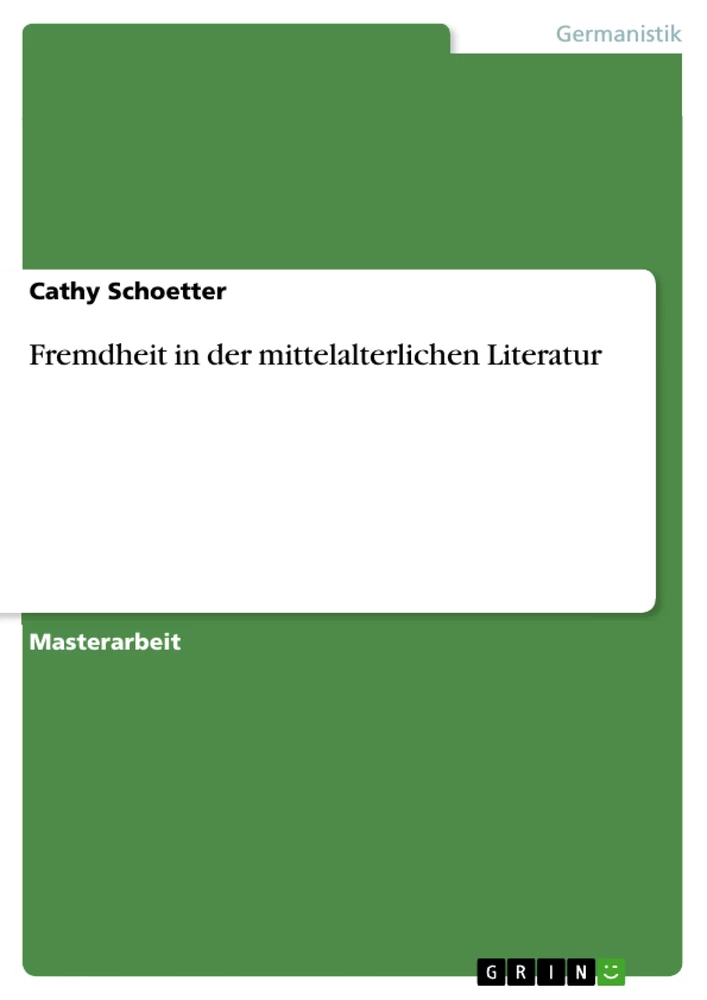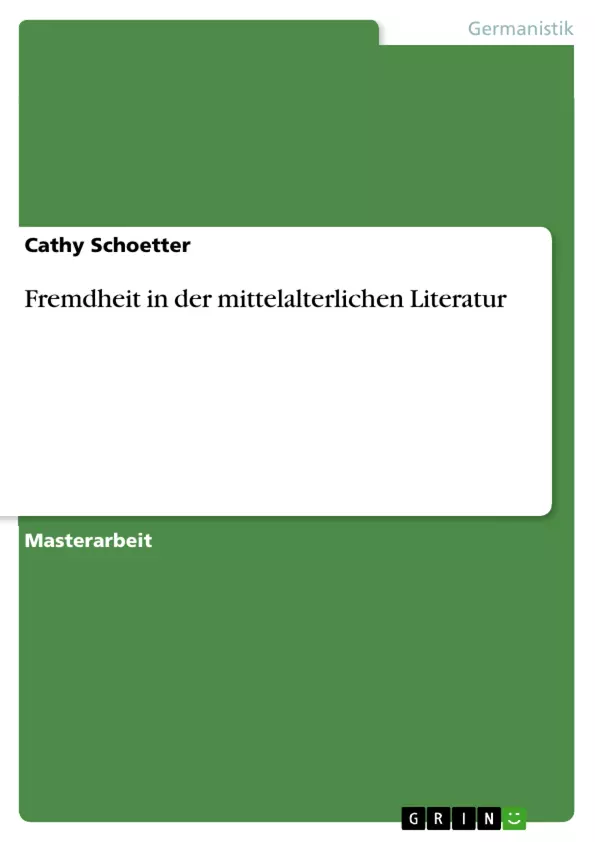Die Fremdheit im Mittelalter umfasst ein derart großes Spektrum, welchem der Umfang einer Masterarbeit nicht gerecht werden kann. Neben den damaligen Reisen in ferne Länder zählen auch wundersame Elemente und unerklärliche Begebenheiten, wie Zauber und Magie, zu der fremden Welt des Mittelalters.
Diese Arbeit konzentriert sich auf den Aspekt der religiösen Andersheit. Das Thema der Fremdheit war bereits im Mittelalter ein beliebtes literarisches Motiv. Anhand der Untersuchung von akademischen Veröffentlichungen wie dem mittelhochdeutschen Wörterbuch oder theologischen Skripten soll versucht werden, sich mit den Denkweisen der vergangenen Zeit auseinanderzusetzen. Es eignet sich hier besonders, einen Vergleich zwischen theoretischen Vorgaben und literarischer Umsetzung zu schaffen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zum Begriff der Fremdheit - Versuch einer Definition
- 2.1 Fremdwahrnehmung – das Eigene und das Fremde
- 2.2 Hintergründe der Identität- und Alteritätsforschung
- 2.2.1 Einblicke in die interkulturelle Literaturwissenschaft
- 3. Das fremde Mittelalter
- 3.1 Der „vremde“ im Mittelalter
- 3.1.1 Religiöser Pluralismus
- 3.1.2 Fremdheit zur Zeit der Kreuzzüge
- 3.2 Toleranzdenken in mittelhochdeutscher Literatur
- 4. Das Rolandslied des Pfaffen Konrad - Text und Forschungsstand
- 4.1 Die Darstellung der Heiden und Christen
- 4.1.1 Die Heiden alias „des tuvelis kint“
- 4.1.2 Die Christen als „gotes helede“
- 4.2 Ablehnung oder Akzeptanz?
- 5. Wolframs von Eschenbach Willehalm - Text und Forschungsstand
- 5.1 Das Verhalten und die Positionsbestimmungen
- 5.1.1 Willehalm
- 5.1.2 Arabel, die getaufte Frau Gyburc
- 5.1.3 Rennewart
- 5.2 Duldung oder Feindlichkeit?
- 6. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Umgang mit Fremdheit und Andersheit in der mittelalterlichen Literatur, fokussiert auf den Aspekt religiöser Andersheit. Analysiert werden die Primärtexte „Willehalm“ von Wolfram von Eschenbach und das „Rolandslied“ des Pfaffen Konrad, um den Umgang mit religiöser Andersheit in beiden Werken zu vergleichen. Die Arbeit beleuchtet, wie sich die Darstellung von Fremdheit in der Literatur im Laufe der Zeit verändert hat.
- Der Begriff der Fremdheit im Mittelalter
- Religiöser Pluralismus und Toleranzdenken in mittelhochdeutscher Literatur
- Darstellung von Heiden und Christen im Rolandslied
- Verhalten und Positionierung verschiedener Figuren im Willehalm gegenüber Fremden
- Vergleich der Darstellung von Fremdheit in beiden Werken
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Fremdheit im Mittelalter ein und grenzt den Fokus der Arbeit auf religiöse Andersheit ein. Sie benennt die Primärtexte, „Willehalm“ und das „Rolandslied“, und erläutert die methodische Vorgehensweise, die einen Vergleich der beiden Texte beinhaltet, um die Entwicklung der Darstellung von Fremdheit im Laufe der Zeit zu untersuchen. Die Aktualität des Themas wird durch den Bezug auf aktuelle Konflikte hervorgehoben.
2. Zum Begriff der Fremdheit - Versuch einer Definition: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Fremdheit und untersucht die Fremdwahrnehmung im Kontext des Eigenen und des Fremden. Es bietet Einblicke in die Identitäts- und Alteritätsforschung sowie die interkulturelle Literaturwissenschaft, um ein umfassendes Verständnis des Begriffs zu schaffen. Es wird darauf hingewiesen, eine unkritische Übertragung des modernen Toleranzverständnisses auf das Mittelalter zu vermeiden.
3. Das fremde Mittelalter: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Facetten von Fremdheit im Mittelalter, insbesondere den religiösen Pluralismus und die Fremdheit im Kontext der Kreuzzüge. Es beleuchtet das Toleranzdenken in der mittelhochdeutschen Literatur und legt den Grundstein für die anschließende Analyse der Primärtexte.
4. Das Rolandslied des Pfaffen Konrad - Text und Forschungsstand: Die Zusammenfassung dieses Kapitels beschreibt die Darstellung von Heiden und Christen im Rolandslied und analysiert die zugrundeliegende Ideologie. Es untersucht die Frage der Akzeptanz oder Ablehnung von Fremden im Kontext des Textes und setzt dies in Beziehung zum historischen Hintergrund der Kreuzzüge.
5. Wolframs von Eschenbach Willehalm - Text und Forschungsstand: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Zusammenfassung des Willehalms, fokussiert auf die Darstellung von Fremdheit und Andersheit. Es analysiert das Verhalten und die Positionierung verschiedener Figuren, wie Willehalm, Arabel und Rennewart, im Umgang mit Fremden und untersucht die Frage nach Duldung oder Feindlichkeit im Werk.
Schlüsselwörter
Fremdheit, Mittelalter, religiöse Andersheit, Identitätsforschung, Alteritätsforschung, Toleranz, Wolfram von Eschenbach, Willehalm, Pfaffen Konrad, Rolandslied, Kreuzzüge, mittelhochdeutsche Literatur, interkulturelle Literaturwissenschaft, religiöser Pluralismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Masterarbeit: Fremdheit in der mittelhochdeutschen Literatur
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den Umgang mit Fremdheit und Andersheit in der mittelhochdeutschen Literatur, insbesondere im Hinblick auf religiöse Andersheit. Der Fokus liegt auf einem Vergleich der Primärtexte „Willehalm“ von Wolfram von Eschenbach und dem „Rolandslied“ des Pfaffen Konrad.
Welche Texte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Epik „Willehalm“ von Wolfram von Eschenbach und das „Rolandslied“ des Pfaffen Konrad. Der Vergleich dieser beiden Texte soll die Entwicklung der Darstellung von Fremdheit im Laufe der Zeit aufzeigen.
Welche Fragestellungen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit folgenden Fragen: Wie wird Fremdheit im Mittelalter definiert? Wie manifestiert sich religiöser Pluralismus und Toleranzdenken in der mittelhochdeutschen Literatur? Wie werden Heiden und Christen im Rolandslied dargestellt? Wie verhalten sich die Figuren im Willehalm gegenüber Fremden? Wie lassen sich die Darstellungen von Fremdheit in beiden Werken vergleichen?
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Definition des Begriffs Fremdheit, Das fremde Mittelalter, Analyse des Rolandslieds, Analyse des Willehalm und Schlussbetrachtungen. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Thematik.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Literaturanalyse der beiden Primärtexte. Sie stützt sich auf die Identitäts- und Alteritätsforschung sowie die interkulturelle Literaturwissenschaft, um ein umfassendes Verständnis des Begriffs Fremdheit im mittelalterlichen Kontext zu entwickeln. Ein unkritischer Bezug auf modernes Toleranzverständnis wird vermieden.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Fremdheit, Mittelalter, religiöse Andersheit, Identitätsforschung, Alteritätsforschung, Toleranz, Wolfram von Eschenbach, Willehalm, Pfaffen Konrad, Rolandslied, Kreuzzüge, mittelhochdeutsche Literatur, interkulturelle Literaturwissenschaft, religiöser Pluralismus.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Arbeit bietet Zusammenfassungen für jedes Kapitel: Einleitung (Einführung in das Thema und die Methodik), Definition von Fremdheit (Kontextualisierung des Begriffs), Das fremde Mittelalter (religiöser Pluralismus und Kreuzzüge), Rolandslied (Darstellung von Heiden und Christen), Willehalm (Verhalten der Figuren gegenüber Fremden) und Schlussbetrachtungen (Zusammenfassung der Ergebnisse).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Umgang mit Fremdheit und religiöser Andersheit in der mittelhochdeutschen Literatur zu untersuchen und zu vergleichen, indem sie die Darstellung von Fremdheit in "Willehalm" und dem "Rolandslied" analysiert und die Entwicklung dieser Darstellung im Laufe der Zeit beleuchtet.
- Quote paper
- Cathy Schoetter (Author), 2018, Fremdheit in der mittelalterlichen Literatur dargestellt am "Willehalm" Wolframs von Eschenbach und am "Rolandslied" des Pfaffen Konrad, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/438676