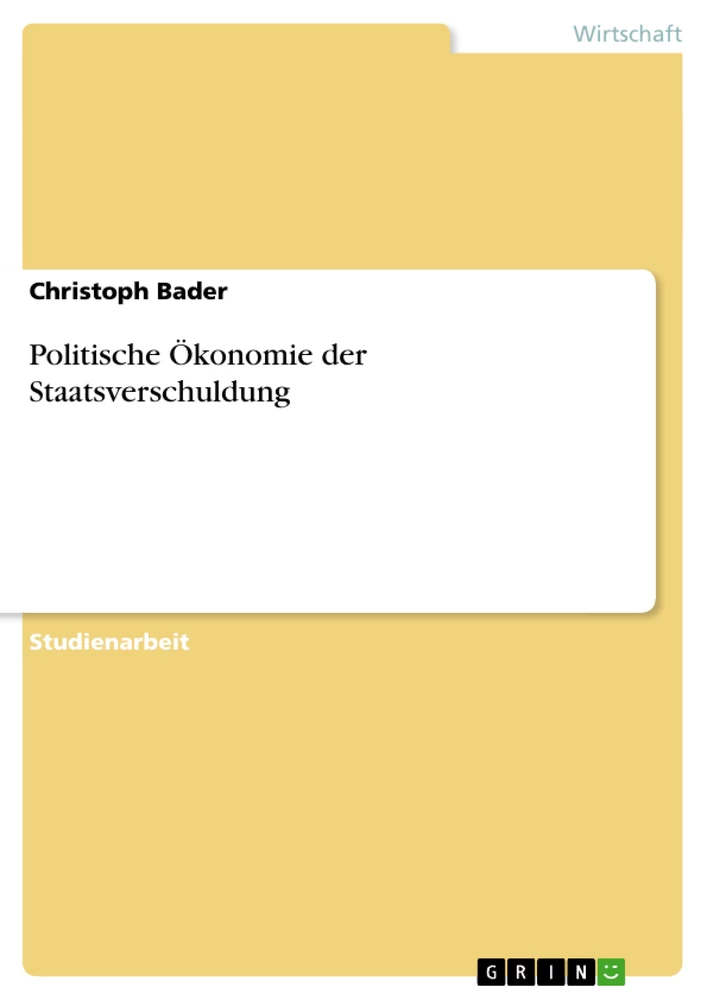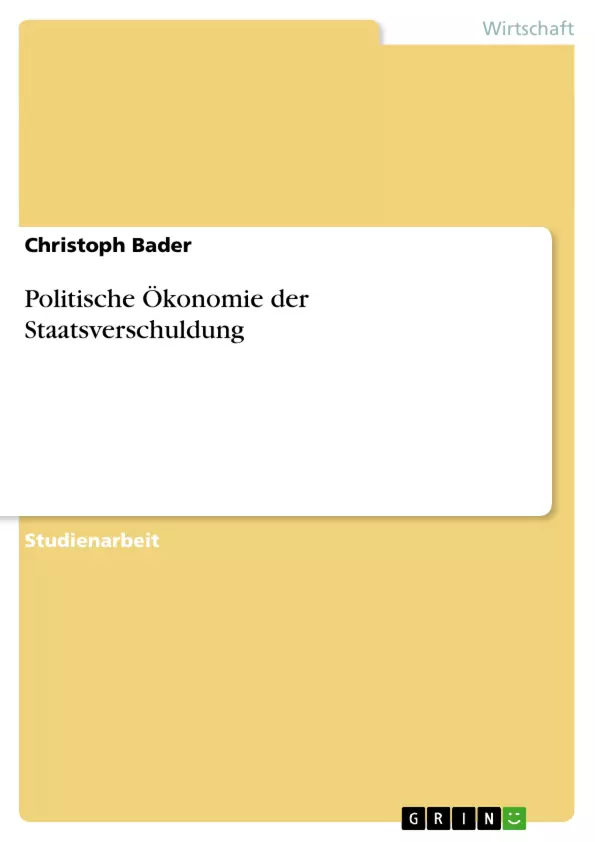Seit den 70er Jahren ist ein kontinuierlicher Anstieg der Staatsverschuldung in den Ländern der OECD zu beobachten. Diese Entwicklung wird in zunehmendem Maße auch von der Öffentlichkeit als bedrohlich angesehen. Allerdings scheint eine Verringerung des Schuldenstandes weitaus schwieriger als von vielen Politikern angenommen. So ist es zum Beispiel Deutschland in den Jahren 2000-2003 nicht gelungen, die Neuverschuldung unter die nach EU-Stabilitätspakt zulässigen 3% des BIP zu drücken, auch für 2004 wird wieder ein Defizit von mehr als 3% erwartet. Warum ist es so schwierig, die staatliche Verschuldung zu reduzieren? Warum bereitet bereits der Versuch Schwierigkeiten den Anstieg der Verschuldung zu stoppen?
Aus ökonomischer Sicht sind Schulden zwar nicht grundsätzlich abzulehnen, allerdings sind sich fast alle Wissenschaftler einig darüber, dass sich eine zu hohe Verschuldung negativ auf die Wirtschaft auswirkt. (Wagschal, 1998) Die Gründe für die übermäßige staatliche Verschuldung insbesondere in den letzten dreißig Jahren sind also nicht ökonomischer Natur, sondern viel mehr in anderen Einflussfaktoren zu suchen, die sich auf das Verhalten politischer Entscheidungsträger auswirken.
Nach einer kurzen Einführung in die theoretischen Grundlagen in Teil 2 werden in den folgenden Abschnitten unterschiedliche politökonomische Modelle und Theorien über die Staatsverschuldung betrachtet. Teil 3 behandelt Theorien, die sich mit Verteilungsfragen zwischen unterschiedlichen Generationen und zwischen verschiedenen geographischen Regionen befassen. Im Teil 4 wird der Einfluss von Parteien und Regierungen auf die Verschuldung näher beleuchtet und Teil 5 betrachtet institutionelle Gründe für staatliche Defizite.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Äquivalenztheorie
- Steuerglättungstheorie
- Fiskalillusion
- Verteilungsgründe für erhöhte Staatsverschuldung
- Generationenverteilung
- Geographische Interessensverteilung
- Einfluss von Regierungen und Parteien auf die Verschuldung
- Strategische Rolle der Verschuldung (wechselnde Regierung)
- Verteilungskonflikt (Koalitionsregierung)
- Bedeutung starker Regierungen
- Einfluss von Parteien (links/rechts)
- Institutionelle Gründe für erhöhte Staatsverschuldung
- Politischer Konjunkturzyklus (Wahlen)
- Haushaltsgesetze
- Einfluss von Institutionen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die politökonomischen Ursachen der steigenden Staatsverschuldung. Sie befasst sich mit den Faktoren, die politisch motivierte Entscheidungen zur Verschuldung beeinflussen, und untersucht, wie diese Faktoren auf die Wirtschaftspolitik und das Haushaltsdefizit wirken.
- Theoretische Grundlagen der Staatsverschuldung (Äquivalenztheorie, Steuerglättungstheorie, Fiskalillusion)
- Verteilungsaspekte der Staatsverschuldung (Generationen, geographische Regionen)
- Einfluss von politischen Akteuren (Regierungen, Parteien) auf die Staatsverschuldung
- Institutionelle Faktoren, die die Staatsverschuldung beeinflussen (Haushaltsgesetze, politische Konjunkturzyklen)
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Staatsverschuldung ein und beleuchtet die aktuelle Debatte um deren Anstieg. Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen der Staatsverschuldung, indem es die Äquivalenztheorie, die Steuerglättungstheorie und die Fiskalillusion darstellt. In Kapitel 3 werden Verteilungsgründe für erhöhte Staatsverschuldung diskutiert, wobei der Fokus auf Generationen- und geographischen Interessensverteilungen liegt. Kapitel 4 widmet sich dem Einfluss von Regierungen und Parteien auf die Verschuldung, indem es die strategische Rolle der Verschuldung bei wechselnden Regierungen, den Verteilungskonflikt in Koalitionsregierungen und die Bedeutung starker Regierungen analysiert. Kapitel 5 betrachtet institutionelle Gründe für erhöhte Staatsverschuldung, darunter den Einfluss von Wahlzyklen, Haushaltsgesetzen und Institutionen. Der Schluss der Arbeit wird in dieser Vorschau nicht dargestellt, um keine Spoiler zu erzeugen.
Schlüsselwörter
Staatsverschuldung, Politökonomie, Äquivalenztheorie, Steuerglättungstheorie, Fiskalillusion, Generationenverteilung, Geographische Interessensverteilung, Einfluss von Regierungen, Parteien, Institutionen, Haushaltsgesetze, politische Konjunkturzyklen.
Häufig gestellte Fragen
Warum steigt die Staatsverschuldung in OECD-Ländern kontinuierlich an?
Neben ökonomischen Gründen spielen vor allem politökonomische Faktoren eine Rolle, wie das Wahlverhalten, Parteieninteressen und institutionelle Rahmenbedingungen.
Was besagt die Äquivalenztheorie (Ricardo-Äquivalenz)?
Sie besagt, dass Staatsverschuldung keine realen Auswirkungen hat, da Bürger antizipieren, dass heutige Schulden zu künftigen Steuererhöhungen führen und deshalb mehr sparen.
Was versteht man unter 'Fiskalillusion'?
Fiskalillusion tritt auf, wenn Wähler die Kosten staatlicher Programme unterschätzen, weil sie über Schulden statt über sichtbare Steuern finanziert werden.
Wie beeinflussen Wahlen die Staatsverschuldung?
Der 'politische Konjunkturzyklus' beschreibt, dass Regierungen vor Wahlen oft die Ausgaben erhöhen oder Steuern senken, um ihre Wiederwahlchancen zu verbessern, was das Defizit erhöht.
Welchen Einfluss haben Koalitionsregierungen auf das Defizit?
Koalitionsregierungen neigen oft zu höheren Defiziten, da verschiedene Parteien ihre jeweiligen Klientelinteressen durchsetzen wollen und Einsparungen schwieriger auszuhandeln sind.
- Arbeit zitieren
- Christoph Bader (Autor:in), 2004, Politische Ökonomie der Staatsverschuldung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43882