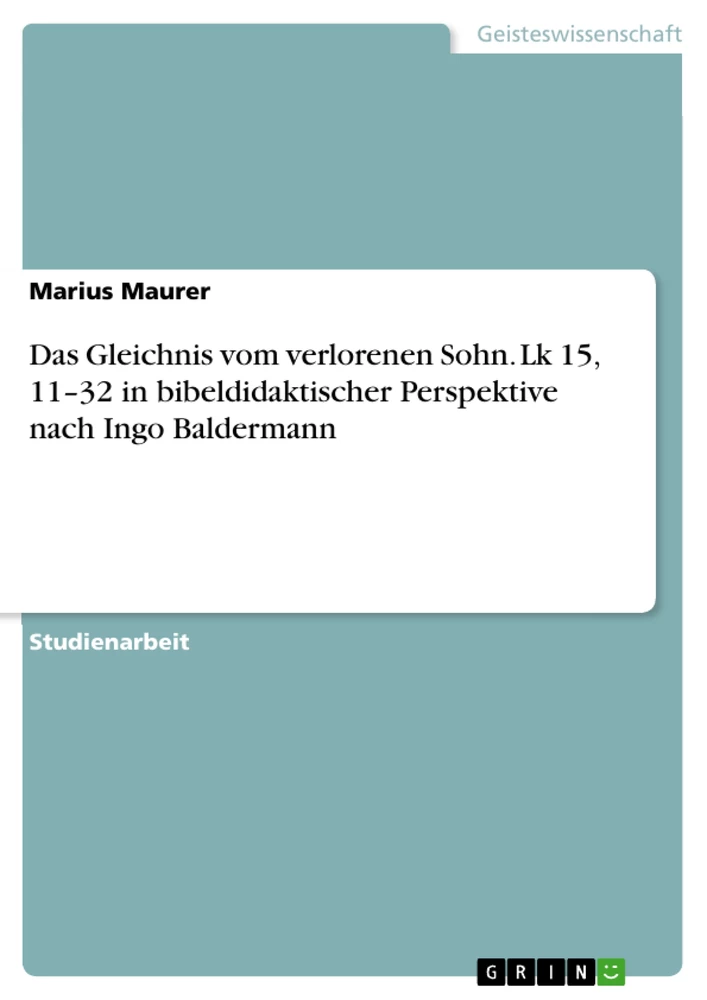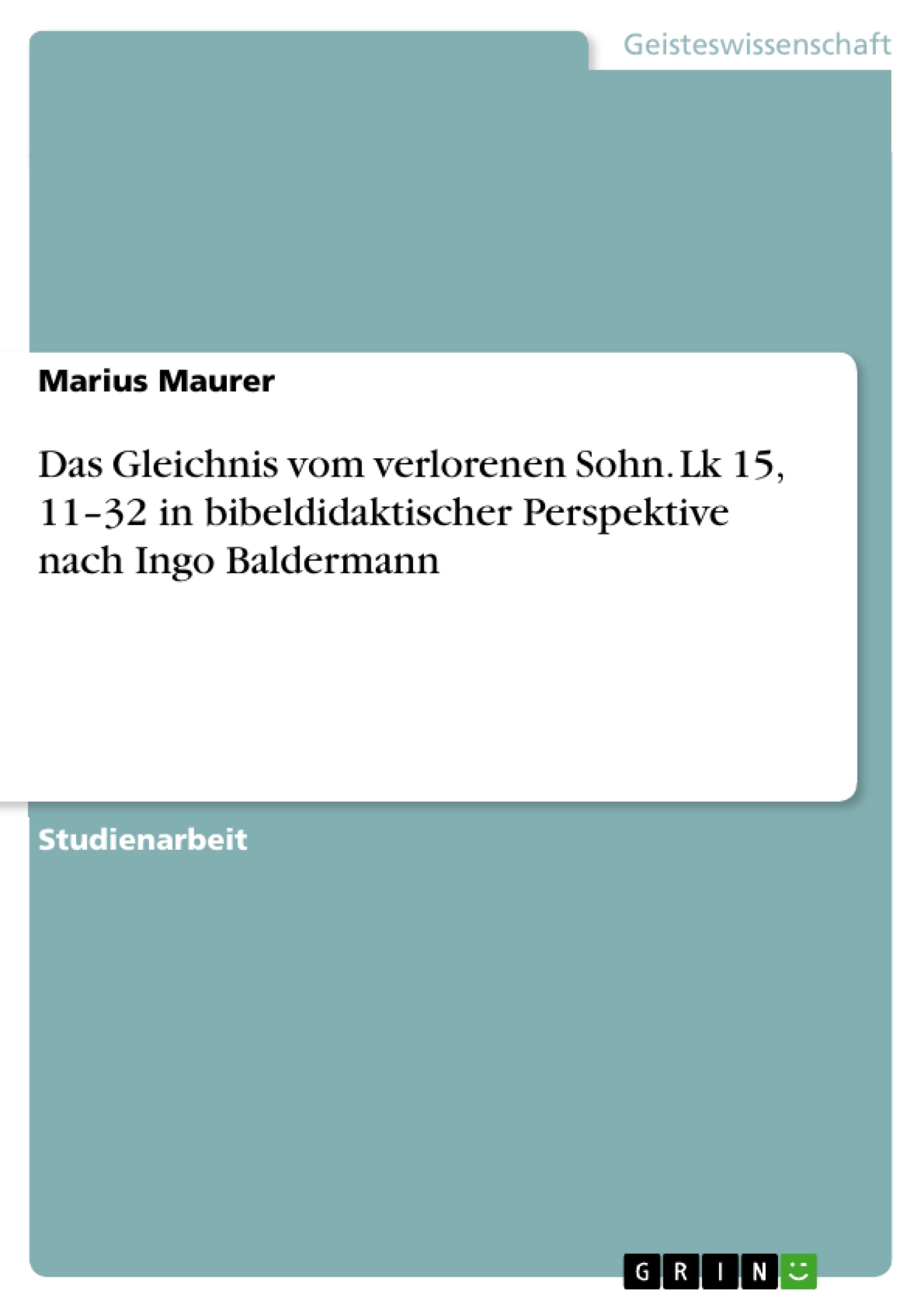In dieser religionspädagogischen Arbeit wird eines der bekanntesten Gleichnisse der Bibel zunächst umfassend exegetisch analysiert und dann auf den Bereich der Religionspädagogik, genauer gesagt den schulischen Bereich, angewendet. Der religionspädagogische Bezug erfolgt anhand des bibeldidaktischen Ansatzes von Ingo Baldermann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theologische Entfaltung des Gleichnisses
- Bibeldidaktische Perspektive nach Ingo Baldermann
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus Lukas 15,11-32 in bibeldidaktischer Perspektive nach Ingo Baldermann. Ziel ist es, Ansätze für eine mögliche Vermittlung des Gleichnisses innerhalb religiöser Lern- und Bildungsprozesse zu entwickeln. Dazu wird im ersten Teil des Essays eine ausführliche theologische Entfaltung des Gleichnisses vorgenommen und im zweiten Teil die Kernaussagen der biblischen Didaktik Baldermanns vorgestellt.
- Theologische Interpretation des Gleichnisses vom verlorenen Sohn
- Bibeldidaktische Ansätze zur Vermittlung des Gleichnisses
- Drei Kernaussagen des Gleichnisses
- Mögliche Lern- und Bildungsprozesse
- Einblicke in die religiöse Bedeutung des Gleichnisses
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Essay beginnt mit einer Einführung, die das Gleichnis vom verlorenen Sohn als eines der bekanntesten Gleichnisse Jesu vorstellt und dessen Bedeutung in Predigten, Bibelarbeiten, Kunst und Musik beleuchtet. Die Einleitung stellt die Zielsetzung des Essays dar und skizziert die methodischen Vorgehensweisen.
Theologische Entfaltung des Gleichnisses
Dieser Abschnitt befasst sich mit der theologischen Interpretation des Gleichnisses aus Lukas 15,11-32, wobei die Handlung des Gleichnisses und die Rolle der handelnden Personen im Vordergrund stehen. Dabei wird das Gleichnis im Kontext der „Gleichnisse vom Verlorenen“ in Lukas 15 und im Makrokontext des Weges nach Jerusalem betrachtet.
Bibeldidaktische Perspektive nach Ingo Baldermann
Das Gleichnis wird in Verbindung mit Ingo Baldermanns biblischer Didaktik gesetzt. Der Abschnitt fasst die Kernaussagen der Didaktik zusammen und präsentiert einen Ansatz zur Vermittlung des Gleichnisses, der auf drei verschiedenen Kernaussagen basiert, die aus dem dreigliedrigen Aufbau des Gleichnisses resultieren.
Schlüsselwörter
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, biblische Didaktik, Ingo Baldermann, Vermittlung, theologische Interpretation, religiöse Lern- und Bildungsprozesse, Kernaussagen, Handlungsverlauf, Sekundärliteratur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern des bibeldidaktischen Ansatzes von Ingo Baldermann?
Baldermanns Ansatz zielt darauf ab, biblische Texte so zu vermitteln, dass sie für die Lebenswelt der Lernenden relevant werden und religiöse Bildungsprozesse anstoßen.
Welche Bibelstelle wird in dieser Arbeit analysiert?
Die Arbeit befasst sich mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn aus dem Lukasevangelium (Lk 15, 11–32).
In welchem Kontext steht das Gleichnis im Lukasevangelium?
Es gehört zu den "Gleichnissen vom Verlorenen" in Lukas 15 und steht im Makrokontext des Weges Jesu nach Jerusalem.
Welche drei Kernaussagen werden für den Unterricht abgeleitet?
Die Arbeit entwickelt drei Kernaussagen, die auf dem dreigliedrigen Aufbau des Gleichnisses basieren und als Grundlage für Lernprozesse dienen.
Welche Rolle spielen die handelnden Personen in der Auslegung?
Die theologische Analyse beleuchtet die Rollen des jüngeren Sohnes, des Vaters und des älteren Bruders, um die Dynamik von Vergebung und Neid zu verstehen.
- Arbeit zitieren
- Marius Maurer (Autor:in), 2011, Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Lk 15, 11–32 in bibeldidaktischer Perspektive nach Ingo Baldermann, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/439400