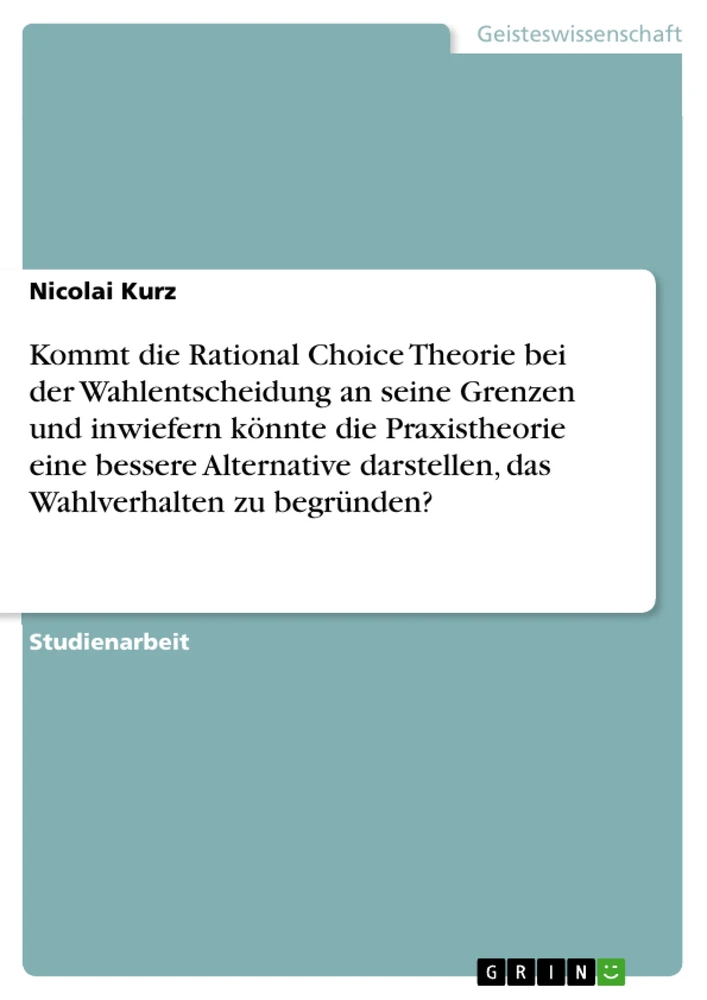Am 24. September 2017 findet die Wahl zum 19. Bundestag der Bundesrepublik Deutschland statt. Gemäß dem deutschen Wahlrecht dürfen alle deutschen Staatsbürger wählen, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland wohnen. Laut des Bundeswahlleiters sind für die Bundestagswahl 2017 insgesamt 61,5 Millionen Menschen wahlberechtigt. Diese dürfen über das personalisierte Verhältniswahlrecht über die Zusammensetzung des Bundestags sowie indirekt über den Bundeskanzler abstimmen. Mit der Erststimme wird ein Vertreter des Wahlkreises gewählt, derjenige mit den meisten Stimmen erhält dann einen Sitz im Bundestag. Mit der Zweitstimme wird eine Partei gewählt, die anhand des Ergebnisses dementsprechend viele Sitze im Bundestag zugesprochen bekommt. Nachdem der Bundestag direkt gewählt wurde, dürfen diese dann den Bundeskanzler wählen. Hierfür treten die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU, Martin Schulz von der SPD, Katrin Göring Eckard und Cem Özdemir von den Grünen sowie Dr. Sarah Wagenknecht und Dr. Dietmar Bartsch von den Linken zur Wahl an, um nur einige von den zehn Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers zu nennen. Die Ernennung der Spitzenkandidaten durch die Parteien spiegelt seit den 1970er Jahren die zunehmende Personalisierung der Politik wieder. Gerade mit den Spitzenkandidaten versuchen die Parteien die Wähler von sich zu überzeugen und so die Mehrheit im Bundestag für sich zu gewinnen. In Zeiten in denen eine zunehmende Politikverdrossenheit zu beobachten ist, erscheint dies ein geeignetes Mittel, Personen zu überzeugen sich an der kommenden Wahl zu beteiligen. Hier wird versucht über Sympathiewerte der Kandidaten auf Stimmenfang zu gehen und dadurch der sinkenden Wahlbeteiligung in Deutschland gegenzusteuern. Es stellt sich zum einen die Frage warum sich Menschen an einer Wahl beteiligen bzw. sich ihrer Stimme enthalten und zum anderen warum sich der Wähler für Partei A entscheidet anstatt für Partei B. Des Weiteren stellt sich die Frage inwiefern die Wahlentscheidung durch soziologische Handlungstheorien begründet werden kann?
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Theorien des Wahlverhaltens
- 1. Der soziologische Erklärungsansatz
- a) Mikrosoziologischer Ansatz
- b) Makrosoziologischer Ansatz
- 2. Individualpsychologischer Ansatz
- 3. Modell des Sozialen Mileus
- 4. Modell des rationalen Wählers
- 1. Der soziologische Erklärungsansatz
- C. Grundannahmen der Rational Choice Theorie
- 1. Methodologischer Individualismus
- 2. Rationalitätsprinzip
- 3. Präferenzgeleitetes Handeln
- 4. Nutzenmaximierung
- D. Zusammenfassung der Annahmen anhand des RREEMM-Modell
- E. Modell des rationalen Wählers
- F. Das Wahlparadoxon - Grenze des RCT
- G. Die Praxistheorie
- 1. Grundannahmen der Praxistheorie
- 2. Die Wahlentscheidung als politische Praktik
- H. Fazit - Vergleich Rational Choice Theorie und Praxistheorie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wahlentscheidung im Kontext der Bundestagswahl 2017 und analysiert, inwieweit die Rational Choice Theorie (RCT) adäquat ist, um das Wahlverhalten zu erklären. Darüber hinaus stellt sie die Praxistheorie als alternative Perspektive zur Erklärung von Wahlentscheidungen vor.
- Analyse der Grenzen der Rational Choice Theorie bei der Erklärung von Wahlentscheidungen
- Vorstellung der Praxistheorie als alternative Perspektive zur Erklärung von Wahlentscheidungen
- Vergleich der beiden Theorien im Hinblick auf ihre Eignung, das Wahlverhalten zu erklären
- Behandlung des Wahlparadoxons als zentrale Herausforderung für das Modell des rationalen Wählers
- Relevanz von soziologischen Handlungstheorien für die Analyse von Wahlentscheidungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Bundestagswahl 2017 beleuchtet und die zentrale Forschungsfrage formuliert. Anschließend werden vier grundlegende Ansätze zur Erklärung von Wahlverhalten vorgestellt: der soziologische Erklärungsansatz, der individualpsychologische Erklärungsansatz, das Modell des sozialen Mileus und das Modell des rationalen Wählers.
Das nächste Kapitel behandelt die Grundannahmen der Rational Choice Theorie, darunter methodologischer Individualismus, Rationalitätsprinzip, präferenzgeleitetes Handeln und Nutzenmaximierung. Die Zusammenfassung der Annahmen anhand des RREEMM-Modells wird vorgestellt. Anschließend wird das Modell des rationalen Wählers nach Downs erläutert, das auf der Annahme basiert, dass Wähler rational und nutzenmaximierend handeln.
Das Kapitel über das Wahlparadoxon untersucht die Grenzen der Rational Choice Theorie bei der Erklärung von Wahlentscheidungen. Es wird dargestellt, dass das Modell des rationalen Wählers in der Realität oft nicht zutreffend ist und warum es nicht immer gelingt, Wahlverhalten präzise zu prognostizieren.
Die Praxistheorie wird als alternative Perspektive zur Erklärung von Wahlentscheidungen vorgestellt. Die Grundannahmen der Praxistheorie und die Vorstellung von der Wahlentscheidung als politische Praktik werden im Detail beleuchtet.
Schlüsselwörter
Rational Choice Theorie, Praxistheorie, Wahlverhalten, Wahlentscheidung, Bundestagswahl, Wahlparadoxon, Modell des rationalen Wählers, politische Praktik, soziologische Handlungstheorien, methodologischer Individualismus, Nutzenmaximierung, Präferenzgeleitetes Handeln.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Wahlparadoxon“ der Rational Choice Theorie?
Es beschreibt das Problem, dass es für ein rationales Individuum kaum sinnvoll ist zu wählen, da die Kosten (Zeit, Aufwand) den minimalen Nutzen (Einfluss einer einzelnen Stimme) übersteigen.
Wie erklärt die Praxistheorie das Wahlverhalten anders?
Die Praxistheorie sieht Wählen als eine soziale und politische Praktik an, die in den Alltag eingebettet ist, anstatt nur eine rationale Nutzenkalkulation zu sein.
Welche Rolle spielte die Personalisierung bei der Bundestagswahl 2017?
Durch Spitzenkandidaten wie Merkel oder Schulz versuchten Parteien, über Sympathiewerte der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken und Wähler zu mobilisieren.
Was bedeutet „methodologischer Individualismus“?
Es ist die Grundannahme der Rational Choice Theorie, dass soziale Phänomene ausschließlich durch das Handeln einzelner Individuen erklärt werden können.
Was ist das RREEMM-Modell?
Es steht für Resourceful, Restricted, Expecting, Evaluating, Maximizing Man und fasst die Annahmen über das menschliche Handeln in der Soziologie zusammen.
- Citation du texte
- Nicolai Kurz (Auteur), 2017, Kommt die Rational Choice Theorie bei der Wahlentscheidung an seine Grenzen und inwiefern könnte die Praxistheorie eine bessere Alternative darstellen, das Wahlverhalten zu begründen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/439431