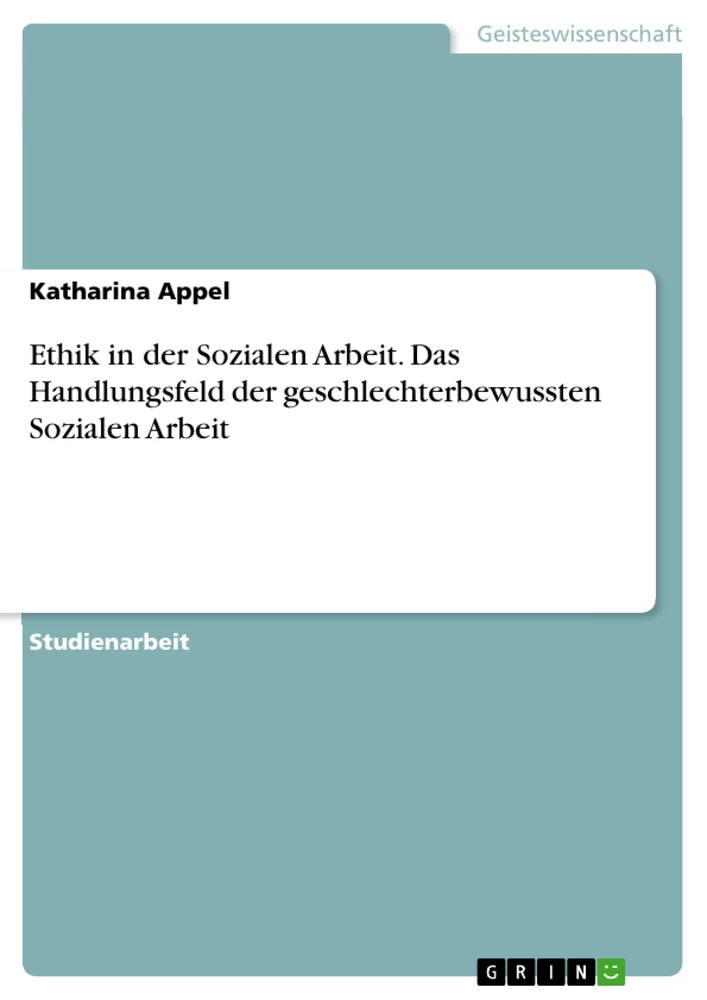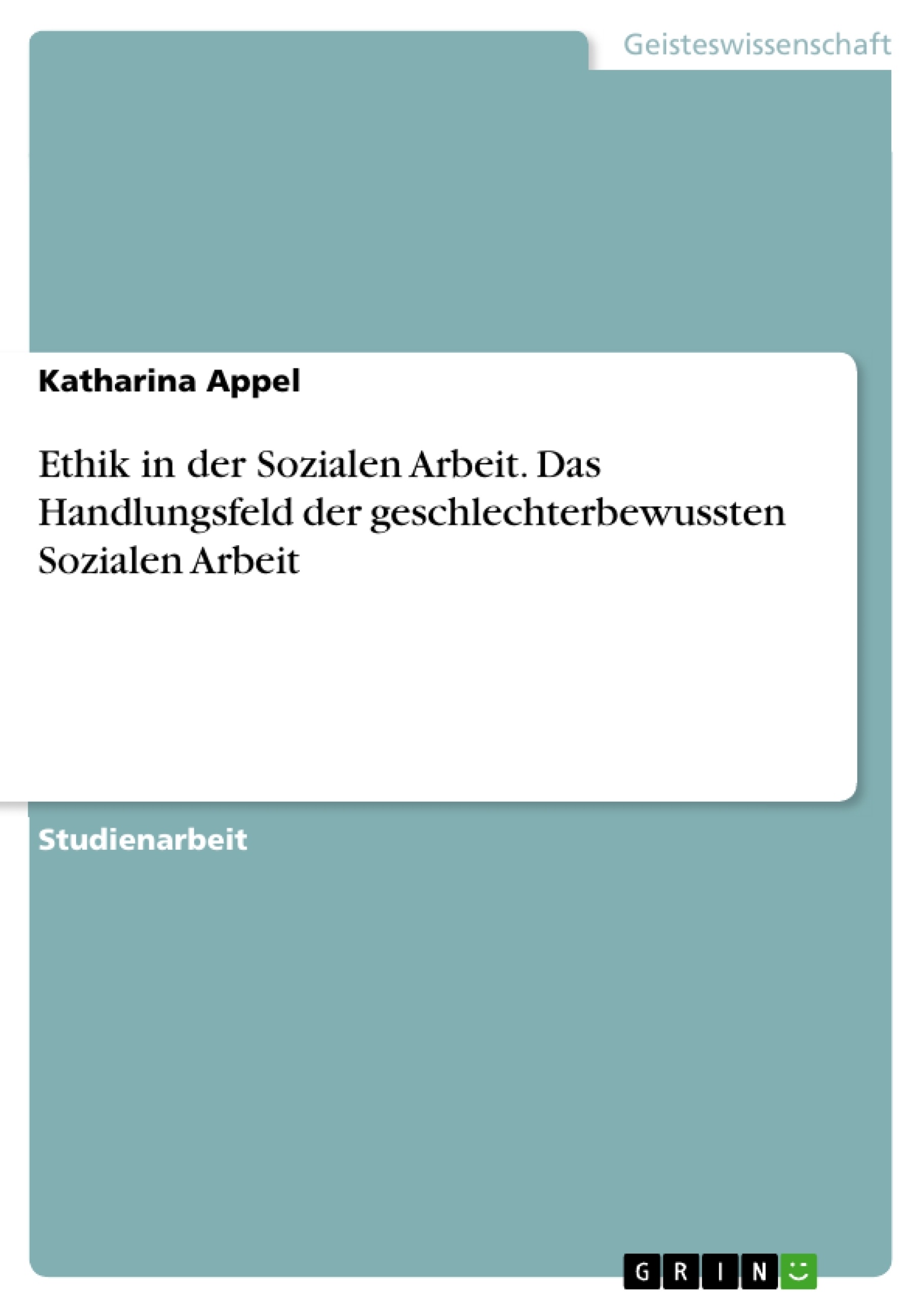Soziale Arbeit bedarf der ethischen Reflexion, weil der Alltag von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern häufig moralisch herausfordernde Situationen bereithält, die ein Abwägen von Werten nötig machen. Eine der Schwierigkeiten im Berufsalltag von Sozialarbeiterinnen ist, dass sie gleichzeitig die Rolle der Helferin und der Überwacherin innehaben und ihre Loyalität oft inmitten antagonistischer Interessen liegt. Gleichzeitig baut Soziale Arbeit auf verbindlichen Grundsätzen auf, die ihrerseits einer ethischen Betrachtung und Kritik bedürfen.
Sozialarbeiter müssen die Interessen der Klientel schützen und ihre unter Umständen anderen Einstellungen bezüglich Politik, Religion usw. anerkennen, ohne die eigene Position aufzugeben. Das Wahren der Klientelinteressen steht dabei oft im Widerspruch zu den gesellschaftlichen Anforderungen von Effizienz und Nutzen, ist aber unerlässlich um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Professionellen und Klienten zu ermöglichen.
In dieser Arbeit geht es zunächst um einen historischen Überblick der Ethik in der Sozialen Arbeit, um Ethik als Wissenschaft, den ethischen Prinzipien. Danach folgt die Übertragung des Themas auf die geschlechterbewusste Soziale Arbeit. nach einer Ausführung über die Veränderungen der Geschlechterverhältnisse in den letzten 40 Jahren und deren Auswirkungen auf Frauen und Männer, gebe ich einen Überblick über die Handlungsansätze und Methoden sowie die Ziele der geschlechtergerechten Sozialen Arbeit.
Hierbei stellen sich mir folgende Fragen: Wird in Zeiten der theoretisch erlangten Gleichberechtigung von Frauen und Männern noch eine Frauenquote benötigt? Bedeutet Gender Mainstreaming nicht, dass nun die Frauen bevorzugt und die Männer benachteiligt werden? Ist es vertretbar reine Mädchenprojekte anzubieten und Jungen, zumindest in diesem Bezug, auszuschließen? Wir damit nicht gegen das ethische Prinzip der sozialen Gerechtigkeit verstoßen? Ist eine einseitige Bevorteilung legitim, wenn sich den bis dato unterpriviligierten Frauen und Mädchen durch diese überhaupt erst die Chance ergibt, in den Bereichen des öffentlichen Lebens durch Teilhabe und Mitbestimmung ihren Platz einzunehmen?
Inhaltsverzeichnis
- Ethik in der Sozialen Arbeit und daraus resultierende Fragen zur Ethik der geschlechterbewussten Sozialen Arbeit
- Ethik in der Sozialen Arbeit
- Die Geschichte der Ethik in der Sozialen Arbeit
- Ethik als Wissenschaft
- Ethische Prinzipien der Sozialen Arbeit
- Menschenrechte und Menschenwürde
- Soziale Gerechtigkeit
- Streitbare Toleranz
- Geschlechterbewusste Soziale Arbeit
- Veränderung der Geschlechterverhältnisse
- Ziele, Handlungsansätze und Methoden geschlechterbewusster Sozialer Arbeit
- Ausblick: Soziale Gerechtigkeit unter den Geschlechtern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ethik in der Sozialen Arbeit, insbesondere im Kontext der geschlechterbewussten Sozialen Arbeit. Sie beleuchtet die historische Entwicklung ethischer Prinzipien in diesem Feld, analysiert relevante ethische Theorien und deren Anwendung in der Praxis. Die Arbeit befasst sich kritisch mit der Frage der Gleichberechtigung und der Notwendigkeit geschlechterspezifischer Maßnahmen.
- Historische Entwicklung der Ethik in der Sozialen Arbeit
- Ethische Prinzipien (Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, Streitbare Toleranz)
- Veränderungen der Geschlechterverhältnisse und deren Auswirkungen
- Handlungsansätze und Methoden der geschlechterbewussten Sozialen Arbeit
- Ethische Herausforderungen der Geschlechtergerechtigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Ethik in der Sozialen Arbeit und daraus resultierende Fragen zur Ethik der geschlechterbewussten Sozialen Arbeit: Dieses einleitende Kapitel führt in die Thematik ein und skizziert die Herausforderungen ethischen Handelns in der Sozialen Arbeit, insbesondere vor dem Hintergrund der Geschlechterverhältnisse. Es wird die Notwendigkeit ethischer Reflexion im Kontext antagonistischer Interessen und des Spannungsfeldes zwischen Klienteninteressen und gesellschaftlichen Anforderungen hervorgehoben. Die Arbeit selbst wird vorgestellt und die zentralen Forschungsfragen bezüglich Frauenquote, Gender Mainstreaming und geschlechterspezifischer Projekte werden formuliert.
Ethik in der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung ethischen Handelns in der Sozialen Arbeit und verortet diese im Kontext der Berufsstandards von IFSW und IASSW. Es wird die enge Verknüpfung der Sozialen Arbeit mit ethischen Prinzipien herausgestellt und die Notwendigkeit kontinuierlicher Reflexion des eigenen Handelns betont.
Die Geschichte der Ethik in der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der Ethik in der Sozialen Arbeit, beginnend mit den christlich geprägten Anfängen und der Nächstenliebe als zentralen Wert. Es wird die Entwicklung von der Almosengabe hin zu einem stärker auf den Hilfsbedürftigen fokussierten Ansatz dargestellt. Die Kapitel erläutert die Herausforderungen und den Wandel von der religiös motivierten Armenhilfe hin zu einem säkularisierten Verständnis. Kritisch beleuchtet wird die Rolle der Sozialarbeit im Dritten Reich als Beispiel für die Wandelbarkeit ethischer Werte im Kontext gesellschaftlicher Machtstrukturen.
Ethik als Wissenschaft: Dieses Kapitel definiert Ethik als wissenschaftliche Disziplin, die sich deskriptiv und normativ mit Moral und Ethos auseinandersetzt. Es differenziert zwischen deskriptiver Ethik, die die gelebte Moral beschreibt, und normativer Ethik, die moralische Urteile fällt. Der Begriff der advokatorischen Ethik wird als zentral für die Soziale Arbeit vorgestellt, wobei der Fokus auf der Vertretung der Interessen von Klienten liegt, auch wenn diese den eigenen Interessen der Sozialarbeiter widersprechen.
Ethische Prinzipien der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel behandelt zentrale ethische Prinzipien der Sozialen Arbeit, wie Menschenrechte und Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit und streitbare Toleranz. Es wird die Bedeutung dieser Prinzipien für das professionelle Handeln von Sozialarbeitern erläutert und ihre Anwendung im Kontext der Geschlechterverhältnisse angedeutet.
Geschlechterbewusste Soziale Arbeit: Dieses Kapitel thematisiert die geschlechterbewusste Soziale Arbeit vor dem Hintergrund der Veränderung von Geschlechterverhältnissen in den letzten 40 Jahren. Es beschreibt die Ziele, Handlungsansätze und Methoden einer solchen Praxis und setzt sich kritisch mit den Herausforderungen auseinander.
Schlüsselwörter
Ethik, Soziale Arbeit, Geschlechterbewusstsein, Gender Mainstreaming, Soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte, Menschenwürde, Advokatorische Ethik, Gleichberechtigung, Frauenquote, historische Entwicklung, ethische Prinzipien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ethik in der Sozialen Arbeit und die Ethik der geschlechterbewussten Sozialen Arbeit
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über die Ethik in der Sozialen Arbeit, mit besonderem Fokus auf die geschlechterbewusste Soziale Arbeit. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Text behandelt die historische Entwicklung ethischer Prinzipien in der Sozialen Arbeit, analysiert relevante ethische Theorien und deren praktische Anwendung, und befasst sich kritisch mit der Gleichberechtigung und geschlechterspezifischen Maßnahmen.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende zentrale Themen: die Geschichte der Ethik in der Sozialen Arbeit, ethische Prinzipien wie Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und streitbare Toleranz, Veränderungen der Geschlechterverhältnisse und deren Auswirkungen, Handlungsansätze und Methoden der geschlechterbewussten Sozialen Arbeit, ethische Herausforderungen der Geschlechtergerechtigkeit, Ethik als wissenschaftliche Disziplin (deskriptiv und normativ), und die advokatorische Ethik in der Sozialen Arbeit.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text ist in mehrere Kapitel gegliedert, die sich mit folgenden Themen befassen: Einleitung (Ethik in der Sozialen Arbeit und daraus resultierende Fragen zur Ethik der geschlechterbewussten Sozialen Arbeit), Ethik in der Sozialen Arbeit im Allgemeinen, die Geschichte der Ethik in der Sozialen Arbeit, Ethik als Wissenschaft, ethische Prinzipien der Sozialen Arbeit, geschlechterbewusste Soziale Arbeit und ein Ausblick auf soziale Gerechtigkeit unter den Geschlechtern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Textes prägnant beschreiben, sind: Ethik, Soziale Arbeit, Geschlechterbewusstsein, Gender Mainstreaming, Soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte, Menschenwürde, Advokatorische Ethik, Gleichberechtigung, Frauenquote, historische Entwicklung und ethische Prinzipien.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text untersucht die Ethik in der Sozialen Arbeit, insbesondere im Kontext der geschlechterbewussten Sozialen Arbeit. Er beleuchtet die historische Entwicklung ethischer Prinzipien, analysiert relevante ethische Theorien und deren Anwendung in der Praxis und befasst sich kritisch mit der Frage der Gleichberechtigung und der Notwendigkeit geschlechterspezifischer Maßnahmen.
Wer ist die Zielgruppe des Textes?
Die Zielgruppe des Textes sind Personen, die sich akademisch mit der Ethik in der Sozialen Arbeit und dem Thema Gender beschäftigen, z.B. Studierende der Sozialen Arbeit, Wissenschaftler*innen und Fachkräfte im Sozialwesen.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist übersichtlich strukturiert mit einem Inhaltsverzeichnis, einer Einleitung mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und einem Schluss mit Schlüsselbegriffen. Diese Struktur erleichtert das Verständnis und den Zugriff auf die relevanten Informationen.
Welche ethischen Prinzipien werden im Text behandelt?
Der Text behandelt zentrale ethische Prinzipien der Sozialen Arbeit, darunter Menschenrechte und Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit und streitbare Toleranz. Die Bedeutung dieser Prinzipien für das professionelle Handeln von Sozialarbeitern und deren Anwendung im Kontext der Geschlechterverhältnisse wird erläutert.
- Quote paper
- Katharina Appel (Author), 2010, Ethik in der Sozialen Arbeit. Das Handlungsfeld der geschlechterbewussten Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/439434