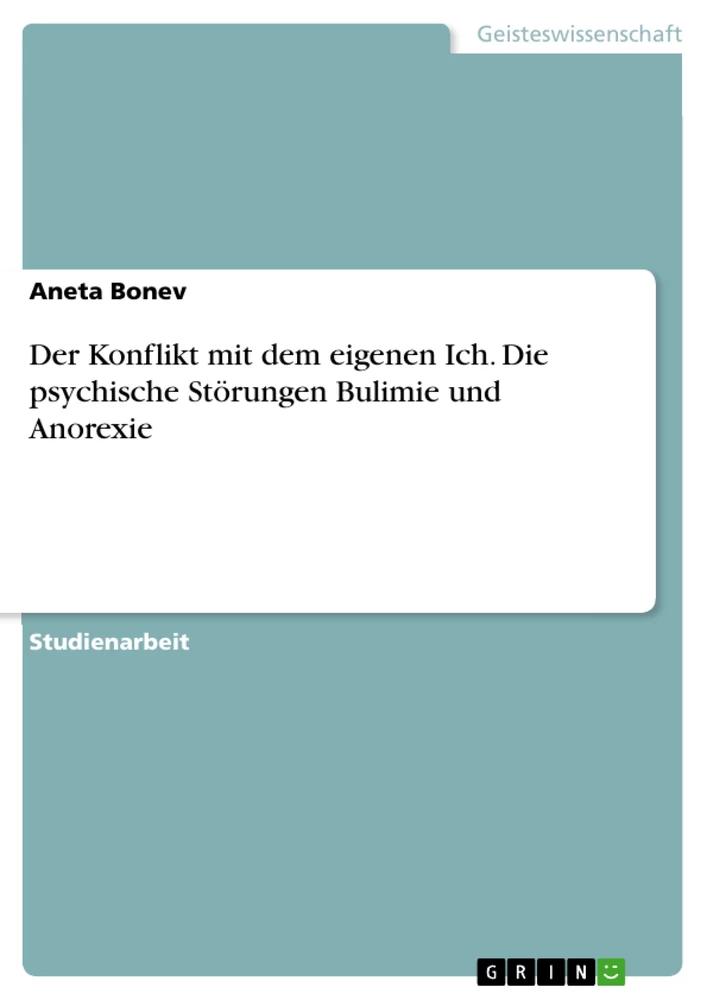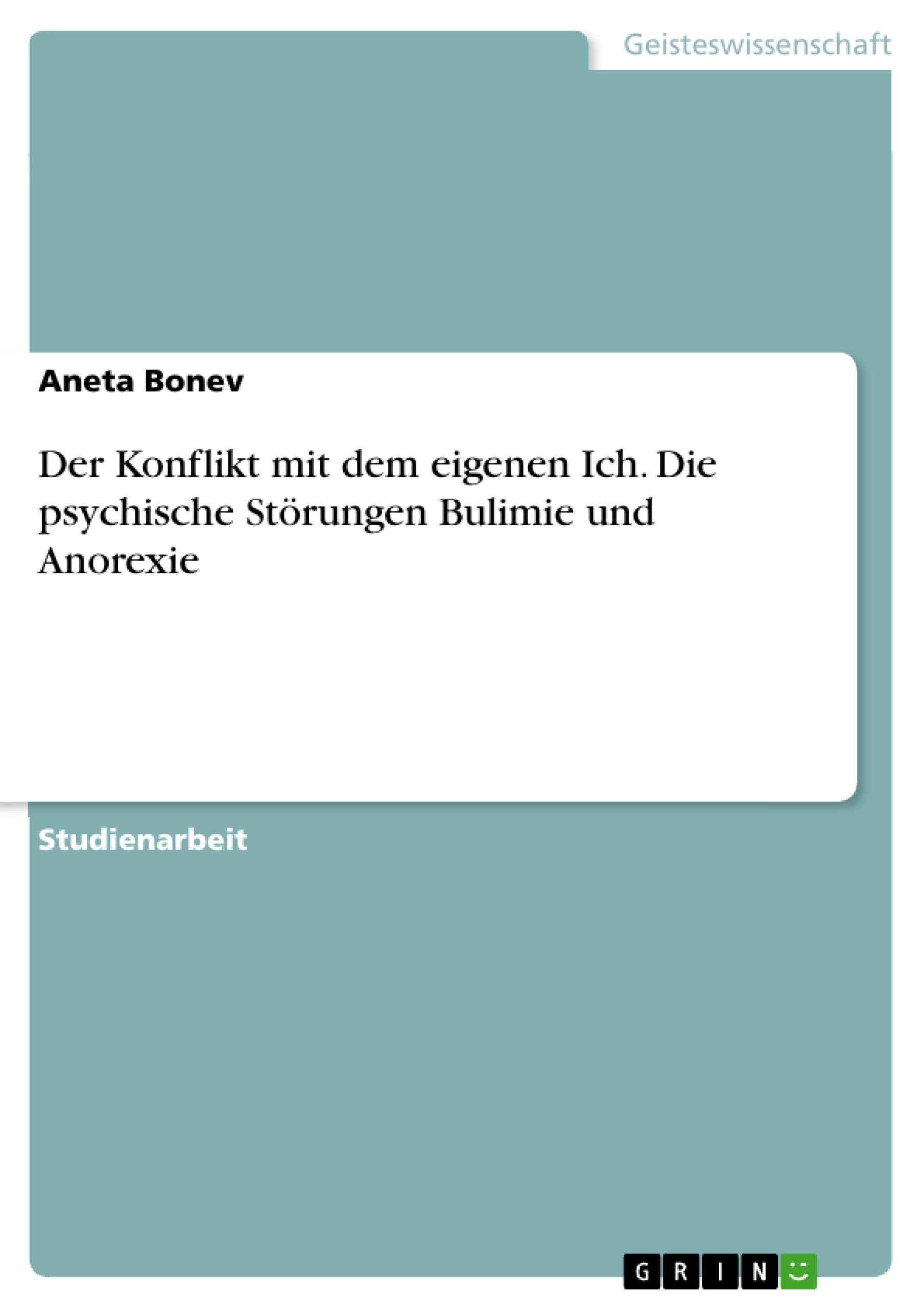Eines der fünf Existenzbedürfnisse des Menschen ist die Ernährung. Die Suche und Sicherung der Nahrung – unserer Energiequelle – ist seit Anbeginn der Zeit eine der Haupttriebkräfte in unserem Leben. Trotz Überproduktion an Lebensmitteln in einigen Regionen ist für viele Menschen auf der Welt die tägliche Mahlzeit nicht selbstverständlich. In den westlichen Industrieländern hingegen leben wir im Nahrungsüberfluss und doch gibt es Menschen, die freiwillig ihrem Körper die Energiezufuhr in einem lebensbedrohlichen Ausmaß entziehen – sie hungern. Dabei handelt es sich meistens um eine Essstörung.
Doch wie ist es möglich, sich etwas derartig Lebenswichtiges zum Feind zu machen? Welche Ursachen stecken dahinter? Was macht diese Störung mit der Psyche des Betroffenen? Wie bestimmt diese Krankheit das Leben dieses Menschens? Viele Wissenschaftler, Psychologen und Mediziner befassen sich mit diesem Problem, doch im gesellschaftlichen Alltag scheint es ein Tabu, obwohl die Anzahl der Betroffenen beträchtlich ist. Im Verlauf dieser Arbeit sollen diese und weitere Fragen bezüglich des Themas „Essstörungen“ und dem Konflikt zwischen dem inneren Erleben und dem Erscheinungsbild der Person geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitende Worte
- B. Essstörungen..
- I. Allgemeine Merkmale von Anorexie und Bulimie.......
- II. Unterschiede zwischen Anorexie und Bulimie.
- 1. Magersucht........
- 2. Bulimie....
- III. Ursachen von Anorexie und Bulimie
- 1. Genetische Dispositionen
- 2. Familiäre Hintergründe
- 3. Individuelle Erfahrungen.
- 4. Sozialkulturelle Gegebenheiten
- IV. Folgen.........
- V. Behandlungsmöglichkeiten
- C. Das Leben mit einer Essstörung: Die Lebens- und Krankheitsgeschichte von Gundis Zámbó 15
- D. Fazit..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema „Essstörungen“, insbesondere mit den Formen Anorexie und Bulimie. Das Ziel der Arbeit ist es, die Ursachen, Auswirkungen und Behandlungsmöglichkeiten dieser psychischen Störungen zu beleuchten. Zudem wird ein Einblick in die Lebensgeschichte einer Betroffenen gegeben, um die Krankheit aus der Perspektive einer Person mit eigener Erfahrung zu betrachten.
- Die Merkmale und Unterschiede zwischen Anorexie und Bulimie
- Die Ursachen von Essstörungen, darunter genetische Dispositionen, familiäre Hintergründe, individuelle Erfahrungen und soziokulturelle Einflüsse
- Die Folgen von Essstörungen auf die körperliche und psychische Gesundheit der Betroffenen
- Möglichkeiten zur Behandlung von Essstörungen
- Die Lebensgeschichte einer Frau mit Bulimie, die Einblicke in die persönlichen Erfahrungen mit dieser Krankheit bietet
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel gibt eine Einführung in das Thema Essstörungen und beleuchtet die allgemeinen Merkmale von Anorexie und Bulimie. Es werden die Ursachen, Folgen und Behandlungsmöglichkeiten dieser Störungen vorgestellt. Das zweite Kapitel widmet sich der Lebensgeschichte von Gundis Zámbó, die offen über ihre Erfahrungen mit Bulimie spricht.
Schlüsselwörter
Essstörungen, Anorexie, Bulimie, Magersucht, Ursachen, Folgen, Behandlungsmöglichkeiten, Lebensgeschichte, Gundis Zámbó, Körperbild, Selbstbild, Psychische Störung, Nahrungsaufnahme, Übergewicht, Untergewicht
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptunterschiede zwischen Anorexie und Bulimie?
Anorexie (Magersucht) ist durch extreme Nahrungsverweigerung und massives Untergewicht gekennzeichnet. Bulimie (Ess-Brech-Sucht) äußert sich durch Essanfälle mit anschließendem Erbrechen, wobei die Betroffenen oft normalgewichtig sind.
Welche Ursachen führen zu Essstörungen?
Die Ursachen sind vielfältig: genetische Dispositionen, familiäre Hintergründe (z.B. hoher Leistungsdruck), individuelle traumatische Erfahrungen und soziokulturelle Faktoren wie das herrschende Schlankheitsideal.
Welche psychischen Folgen haben Essstörungen?
Betroffene leiden oft unter einem massiv gestörten Körperbild, geringem Selbstwertgefühl, Depressionen und einer zwanghaften Kontrolle über die Nahrungsaufnahme.
Warum ist das Thema in der Gesellschaft oft noch ein Tabu?
Trotz der hohen Anzahl an Betroffenen herrscht oft Scham vor. Die Krankheit wird häufig versteckt, da sie mit Kontrollverlust und einem Konflikt zwischen innerem Erleben und äußerem Erscheinungsbild einhergeht.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Die Behandlung erfordert meist eine Kombination aus medizinischer Überwachung, Psychotherapie (Einzel- oder Gruppentherapie) und Ernährungsberatung, um die Ursachen aufzuarbeiten und ein gesundes Essverhalten zu erlernen.
- Quote paper
- Aneta Bonev (Author), 2016, Der Konflikt mit dem eigenen Ich. Die psychische Störungen Bulimie und Anorexie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/439444