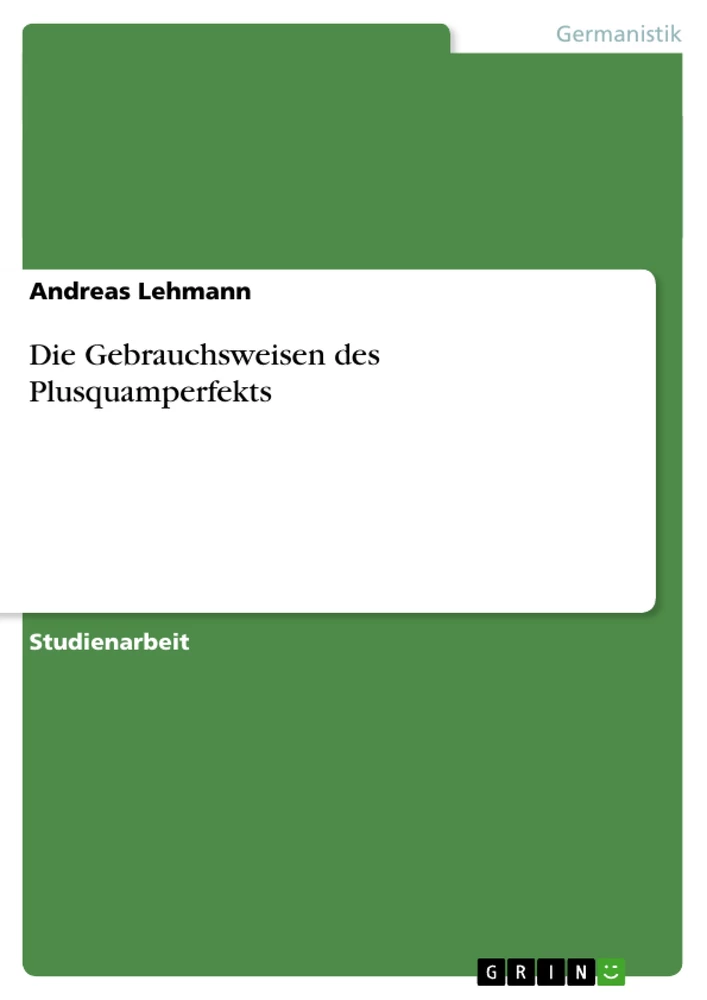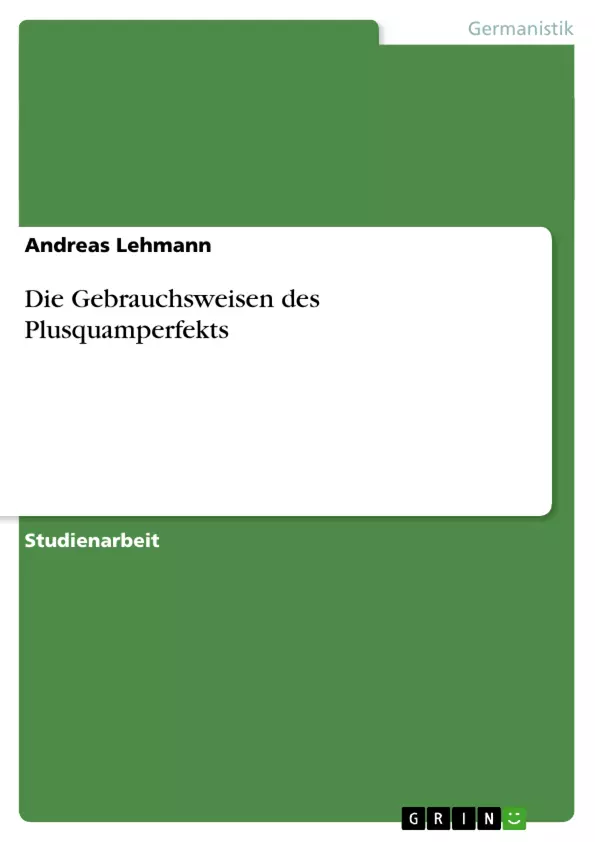Die Bandbreite an einschlägiger Literatur zum Plusquamperfekt ist, verglichen mit den anderen Vergangenheitstempora, sehr überschaubar. Diese „stiefmütterliche Behandlung“ (BREUER/ DOROW 1996: 1) ist unter anderem auf die scheinbare Problemlosigkeit des Plusquamperfekts zurückzuführen (dazu auch HAUSER-SUIDA/ HOPPE-BEUGEL 1972: 160). Dass dieses Urteil vorschnell ist, wird noch zu zeigen sein.
Besonders hervorzuheben im Zusammenhang mit der Darstellung des Plusquamperfekts sind neben den Arbeiten von HAUSER-SUIDA/ HOPPE-BEUGEL (1972), VATER (1994) und KROEGER (1977) vor allem die Untersuchungen von EROMS (1983 und 1984) und BREUER/ DOROW (1996). Die vorliegende Arbeit soll sich mit den unterschiedlichen Gebrauchsweisen beschäftigen, in denen das Plusquamperfekt auftaucht und diese anhand von Beispielen aus der neueren deutschen Literatur zu belegen versuchen. Diese ausdrückliche Beschränkung auf Belege aus der geschriebenen Sprache soll zum einen der von HENNIG (2000: 4) geäußerten Kritik an den meisten Tempus-Abhandlungen und deren stillschweigender Gleichsetzung von gesprochener und geschriebener Sprache Rechnung tragen; zum anderen setzt „die künstlerische Verwendung von Sprache ein in der Sprache angelegtes Potential“ (RAUH 1985: 63) frei, das im alltäglichen (also zumeist mündlichen) Sprachgebrauch nicht zum Tragen kommt. D. h. die verschiedenen Erscheinungsformen des Plusquamperfekts, das den anderen Tempora gegenüber ohnehin vergleichsweise selten auftritt (BREUER/ DOROW 1996: 1), sind am ehesten in literarischen Texten zu fassen1.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Das Plusquamperfekt – ein unproblematisches Tempus?
- 2. Bedeutung und Gebrauch des Plusquamperfekts
- 2.1. Semantik
- 2.2. Pragmatik
- 2.2.1. Plusquamperfekt und Perfekt
- 2.2.2. Relativer Gebrauch des Plusquamperfekts
- 2.2.2.1. Das „futurische“ Plusquamperfekt
- 2.2.2.2. Streckformen
- 2.2.3. Absoluter Gebrauch des Plusquamperfekts
- 3. Das Plusquamperfekt als Spiegel der Tempusproblematik
- Bibliographie
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die verschiedenen Gebrauchsweisen des Plusquamperfekts im Deutschen. Sie konzentriert sich dabei auf Beispiele aus der neueren deutschen Literatur, um die häufig vernachlässigten Aspekte dieses Tempus zu beleuchten und die Grenzen zwischen Semantik und Pragmatik im Gebrauch des Plusquamperfekts zu untersuchen. Die Arbeit berücksichtigt die Kritik an der Gleichsetzung von gesprochener und geschriebener Sprache in Tempusanalysen und nutzt literarische Texte, um das spezifische Potential des Plusquamperfekts in der künstlerischen Sprache aufzuzeigen.
- Untersuchung der semantischen Grundbedeutung des Plusquamperfekts
- Analyse der pragmatischen Faktoren, die den Gebrauch des Plusquamperfekts beeinflussen
- Differenzierung zwischen relativem und absolutem Gebrauch des Plusquamperfekts
- Behandlung des „futurischen“ Plusquamperfekts und seiner Interpretation
- Bewertung der bestehenden Kontroversen in der linguistischen Forschung zum Plusquamperfekt
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort erläutert die geringe Aufmerksamkeit, die das Plusquamperfekt in der linguistischen Literatur im Vergleich zu anderen Vergangenheitstempora erhält. Es werden wichtige Forschungsarbeiten zum Plusquamperfekt genannt und die Fokussierung der vorliegenden Arbeit auf Beispiele aus der neueren deutschen Literatur begründet, um das in der Alltagssprache oft nicht sichtbare Potential des Plusquamperfekts aufzuzeigen. Die Beschränkung auf geschriebene Sprache wird mit der Kritik an der Gleichsetzung von gesprochenem und geschriebenem Sprachgebrauch in Tempusanalysen und dem besonderen Potential künstlerischer Sprachverwendung gerechtfertigt.
1. Das Plusquamperfekt – ein unproblematisches Tempus?: Dieses Kapitel stellt die scheinbare Unproblematisierung des Plusquamperfekts in Frage. Es wird die weitgehend übereinstimmende Ansicht dargelegt, dass das Plusquamperfekt ein monosemes Tempus ist, dessen verschiedene Verwendungsweisen auf eine Grundbedeutung zurückführbar sind. Die Problematik liegt jedoch an der diffusen Grenze zwischen Semantik und Pragmatik, wobei Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Anzahl der Bedeutungen und der Rolle pragmatischer Faktoren auftreten. Die terminologische Uneinheitlichkeit in der Beschreibung des Plusquamperfekts wird ebenfalls hervorgehoben. Das Kapitel betont die Notwendigkeit, zwischen Bedeutung und Gebrauch des Plusquamperfekts zu unterscheiden, um die verschiedenen Erscheinungsformen zu verstehen.
2. Bedeutung und Gebrauch des Plusquamperfekts: Dieses Kapitel beschreibt die semantische Grundbedeutung des Plusquamperfekts, basierend auf Reichenbachs System, als ein Tempus, dessen Ereigniszeit vor der Referenzzeit und diese wiederum vor der Sprechzeit liegt. Die Abgeschlossenheit des vergangenen Geschehens wird durch das Partizip II markiert, der Bezug zur präteritalen Erzählebene durch die Präteritumform des Auxiliars. Es wird als relatives Tempus beschrieben, das in Bezug zu einer vergangenen Referenzzeit steht. Das Kapitel thematisiert die scheinbar der Grundbedeutung widersprechenden Erscheinungsformen, die im Bereich der Pragmatik erklärt werden sollen, und betont die Bedeutung einer kontextuellen Betrachtungsweise für ein vollständiges Verständnis des Plusquamperfekts.
Schlüsselwörter
Plusquamperfekt, Tempus, Semantik, Pragmatik, deutsche Grammatik, Literaturanalyse, Vergangenheitstempora, Relatives Tempus, Monosemie, Kontextualisierung, Linguistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Plusquamperfekts im Deutschen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die verschiedenen Verwendungsweisen des Plusquamperfekts im Deutschen, konzentriert sich dabei auf Beispiele aus der neueren deutschen Literatur und untersucht die Grenzen zwischen Semantik und Pragmatik dieses Tempus.
Welche Aspekte des Plusquamperfekts werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die semantische Grundbedeutung, die pragmatischen Einflussfaktoren auf den Gebrauch, die Unterscheidung zwischen relativem und absolutem Gebrauch, das „futurische“ Plusquamperfekt, und bewertet bestehende Kontroversen in der linguistischen Forschung.
Warum wird die Literaturanalyse verwendet?
Die Arbeit nutzt literarische Texte, um das spezifische Potential des Plusquamperfekts in der künstlerischen Sprache aufzuzeigen und die Kritik an der Gleichsetzung von gesprochener und geschriebener Sprache in Tempusanalysen zu berücksichtigen.
Wie wird die semantische Grundbedeutung des Plusquamperfekts definiert?
Die semantische Grundbedeutung wird basierend auf Reichenbachs System erklärt: Das Ereignis liegt vor der Referenzzeit, und diese wiederum vor der Sprechzeit. Die Abgeschlossenheit des Ereignisses wird durch das Partizip II, der Bezug zur präteritalen Erzählebene durch das Präteritum des Auxiliars markiert.
Was ist der Unterschied zwischen relativem und absolutem Gebrauch des Plusquamperfekts?
Die Arbeit differenziert zwischen dem relativen Gebrauch, der in Bezug zu einer vergangenen Referenzzeit steht, und dem absoluten Gebrauch, wobei die genauen Unterschiede im Text detailliert erläutert werden.
Was ist das „futurische“ Plusquamperfekt?
Die Arbeit behandelt das „futurische“ Plusquamperfekt und seine Interpretation, jedoch ohne nähere Einzelheiten im FAQ. Die Details sind im Text der Arbeit selbst nachzulesen.
Welche Rolle spielt die Pragmatik in der Analyse des Plusquamperfekts?
Die Pragmatik spielt eine entscheidende Rolle, da sie scheinbar der Grundbedeutung widersprechende Erscheinungsformen des Plusquamperfekts erklärt. Eine kontextuelle Betrachtungsweise ist für ein vollständiges Verständnis essentiell.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Plusquamperfekt, Tempus, Semantik, Pragmatik, deutsche Grammatik, Literaturanalyse, Vergangenheitstempora, Relatives Tempus, Monosemie, Kontextualisierung, Linguistik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in ein Vorwort, ein Kapitel zur scheinbaren Unproblematisierung des Plusquamperfekts, ein Kapitel zu Bedeutung und Gebrauch, ein Kapitel zum Plusquamperfekt als Spiegel der Tempusproblematik, eine Bibliographie und ein Quellenverzeichnis.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Gebrauchsweisen des Plusquamperfekts zu untersuchen und die oft vernachlässigten Aspekte dieses Tempus zu beleuchten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Untersuchung der Grenzen zwischen Semantik und Pragmatik.
- Quote paper
- Andreas Lehmann (Author), 2005, Die Gebrauchsweisen des Plusquamperfekts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43949