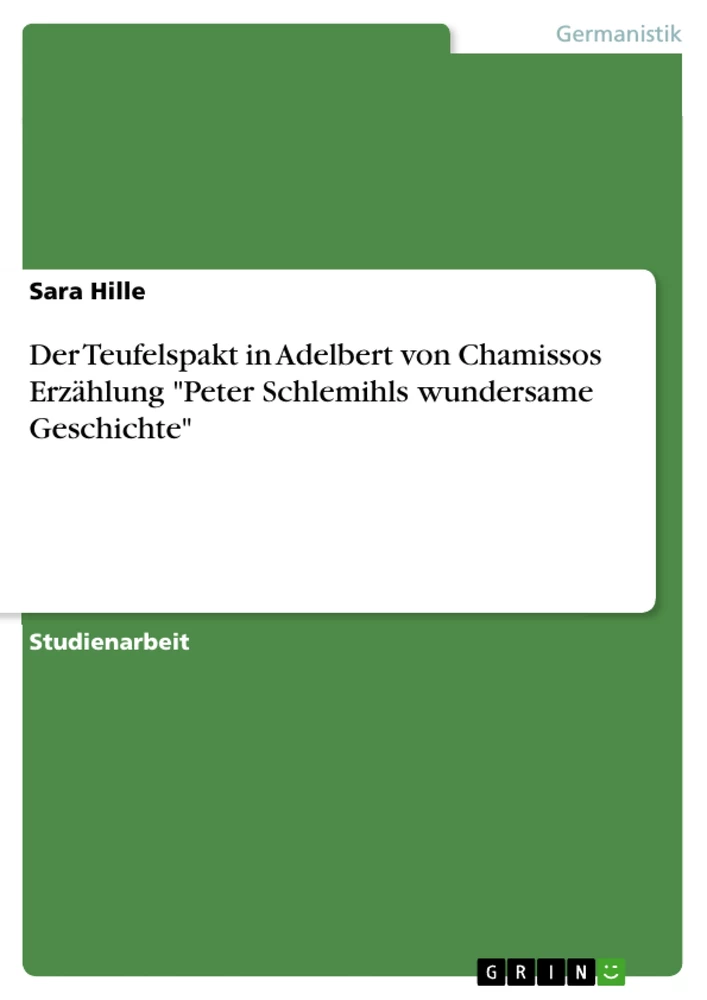Das Motiv des Teufelspakts taucht recht häufig in der Literatur auf und besonders in den Werken des Mittelalters erfreute es sich größter Beliebtheit. Es ist daher auch nicht weiter verwunderlich, dass auch in der Epoche der Romantik eine Vielzahl von Autoren wie etwa Wilhelm Hauff, E.T.A. Hoffman oder auch Friedrich de la Motte Fouqué auf dieses Motiv zurückgriffen, wird ihnen doch häufig eine rückschrittliche Verherrlichung des Mittelalters vorgeworfen.1Zwar hat sich auch Adelbert von Chamisso an der Wiederbelebung des Teufelspaktmotivs beteiligt, seine Verwendung des Motivs in der Novelle Peter Schlemihls wundersame Geschichte lässt jedoch nicht mehr viel von dem mittelalterlichen Ursprung des Motivs erkennen. Chamisso, der 1789 als Kind französischer Adliger vor den Revolutionären aus Frankreich fliehen musste, benutzt das Motiv als Metapher, um auf die gesellschaftlichen Veränderungen, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Deutschland auftraten, aufmerksam zu machen. Die konstitutionellen Reformen, die den Weg von einer feudalen zu einer bürgerlichen Gesellschaft ebneten, führten gleichzeitig zu einem ökonomischen Wandel, welcher die Industrialisierung und den Aufstieg des Kapitalismus einläutete. Unter Berücksichtigung dieses gesellschaftlichen Kontexts und mithilfe von Vergleichen mit dem Teufelsbündnis aus der Historia des Dr. Johann Fausten aus dem Jahr 1587 soll untersucht werden, wie und mit welchem Effekt Chamisso sich von der mittelalterlichen Tradition des Motivs entfernt. Bevor die verschiedenen Elemente von Chamissos Teufelspakt - nämlich die Teufelsfigur, der Verlauf des Pakts sowie sein Ende - dahingehend betrachtet und interpretiert werden, soll zunächst ein kurzer Überblick über die Motivgeschichte helfen, Chamissos Novelle besser einordnen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Teufelspakt in der Literatur
- Der „,Graue“
- Abschied von mittelalterlichen Traditionen
- ,,Der Mensch als des Menschen Teufel “
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Analyse untersucht die Verwendung des Teufelspaktmotivs in Adelbert von Chamissos Novelle „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“ im Kontext der gesellschaftlichen und literarischen Entwicklungen des frühen 19. Jahrhunderts. Es wird analysiert, wie Chamisso das Motiv des Teufelspakts von seinen mittelalterlichen Wurzeln löst und es zur Metapher für die gesellschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen seiner Zeit verwendet.
- Die Entwicklung des Teufelspaktmotivs in der Literatur
- Der Vergleich von Chamissos Teufelsfigur mit der Figur Mephostophiles aus der „Historia des Dr. Johann Fausten“
- Die Rolle des Teufelspakts als Metapher für gesellschaftliche Veränderungen
- Die Darstellung des Teufels als Mensch in Chamissos Novelle
- Die Interpretation des Teufelspakts als eine Kritik an der Oberflächlichkeit und der Verführung durch Reichtum und gesellschaftlichen Erfolg
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt das Motiv des Teufelspakts in der Literatur vor und beleuchtet seine Entwicklung von der Antike bis zur Romantik. Dabei wird insbesondere auf die Darstellung des Teufels und die verschiedenen Elemente des Paktes eingegangen. Das zweite Kapitel analysiert Chamissos Teufelsfigur, den „Grauen“, und vergleicht sie mit dem Teufel Mephostophiles aus der „Historia des Dr. Johann Fausten“. Es zeigt sich, dass Chamisso das Motiv des Teufelspakts von seinen streng religiösen Wurzeln löst und es zur Metapher für die gesellschaftlichen Veränderungen des frühen 19. Jahrhunderts verwendet.
Schlüsselwörter
Teufelspakt, Romantik, Adelbert von Chamisso, Peter Schlemihls wundersame Geschichte, Historia des Dr. Johann Fausten, Mephostophiles, Gesellschaftliche Veränderungen, Industrialisierung, Kapitalismus, Metapher, „Grauer“
- Citation du texte
- Sara Hille (Auteur), 2017, Der Teufelspakt in Adelbert von Chamissos Erzählung "Peter Schlemihls wundersame Geschichte", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/439557